Lesende

schreibkraft hat ein mail geschickt:
"edition schreibkraft sucht essayistische Beiträge für Heft 32, "Lesen"
Es gab eine Zeit, in der das leise Lesen angeblich verboten war. Der Grund für dieses Verbot lag in der Angst der Machthaber, die leise Lesenden würden die Macht zersetzende Inhalte aufnehmen. Daher wurde laut gelesen, denn nur so wurde offenbar, womit sich der Lesende beschäftigte. Lesen als vermeintlicher Akt der potenziellen Subversion hat demnach eine lange Tradition. Doch was kann Lesen noch sein? Ist es Therapie? Ist es Emanzipation? Ist es Identitätsbildung und Verortung innerhalb einer Gesellschaft? Oder ist Lesen einfach nur Zeitvertreib, je nach Lektüre schnöde Unterhaltung, intellektuelle Gaukelei oder eskapistische Weltflucht in den selbstbezogenen Raum hinein? Ist Lesen auch heute noch Widerstand, ist es Renitenz? Der Philosoph Konrad Paul Liessmann hat vor kurzem erst notiert, dass literarische Bildung, die einst im Zentrum der Curricula der höheren Schulen stand, nicht nur dort zu einem Fremdwort geworden sei, weil sie nicht in einem unmittelbaren Können, in einer handfesten Kompetenz münde. Belesenheit war und ist deshalb eine Provokation.
Wir fragen daher: Warum lesen wir, welche Motive gibt es, was treibt uns an? Wie lesen Rezensenten Bücher, die sie besprechen müssen, wie lesen sie Bücher, die sie in der Freizeit lesen?
Und stimmt es, dass Literatur Schnittflächen schafft? Und wenn ja, mit wem? Mit Freunden? Mit Fremden? Mit mir Unbekannten, deren Welt/Kultur sich mir eröffnet, noch bevor ich je den Lebens- und Kulturraum der mir Unbekannten betreten habe? Kann Literatur, die den Gesetzen des globalisierten Marktes folgt, diese Schnittflächen überhaupt noch schaffen, wenn die Inhalte so weichgespült und von kulturellen Spezifitäten befreit sind wie für den europäischen Gaumen aufbereitete thailändische Speisen? „Oder sind Bücher [sowieso] nur das Feigenblatt, das es uns gestattet, weiterzumachen wie immer, beim Lesen liberal zu sein und im Leben konservativ?“ (Tim Parks)
Und überhaupt: Ist unser Lesebegriff nicht schon längst von der Realität rechts überholt worden und es sind gar nicht mehr wir, die lesen und uns dadurch bilden, denn was genau hat es mit den modernen Lesegeräten auf sich, mit Errungenschaften wie RFID und Near Field Communication? Sind sie der endgültige Gott-sei-bei-uns, der alle unsere Schritte verortet, der uns nicht nur transparent macht, sondern aushöhlt? Lesen nicht wir, sondern werden vielmehr wir gelesen, ausgelesen? Und wer liest mit? Google? Der Arbeitgeber? Die Krankenkasse?
Und schließlich: Welche Rolle spielt der Alkohol, insbesondere der Wein, der ohne Lese gar nicht wäre.
Schreiben Sie uns!
Einsendeschluss ist der 26. November 2017. Einsendungen bitte elektronisch an: schreibkraft@mur.at
Die schreibkraft sucht ausschließlich bisher unveröffentlichte Texte. Die Redaktion trifft aus allen eingesendeten Texten eine Auswahl. Von der Redaktion zur Veröffentlichung ausgewählte Beiträge werden honoriert. Die Texte sollen nicht länger als 19.000 Zeichen (inkl. Leerzeichen) sein.
Bitte beachten Sie, dass wir vorrangig essayistische Beiträge suchen. Bitte vermerken Sie die Länge Ihres Textes am Ende des Dokuments und schreiben Sie in die Kopfzeile des Textdokuments Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse."

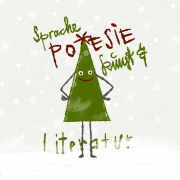
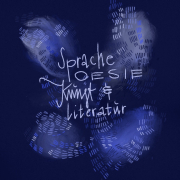
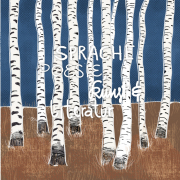
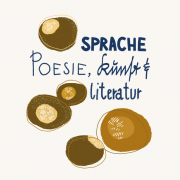



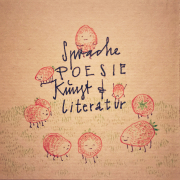
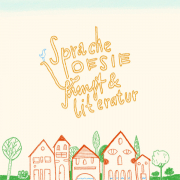
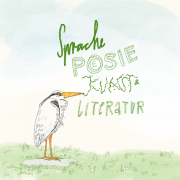
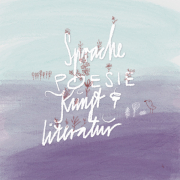
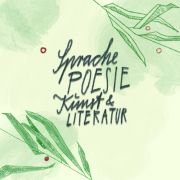
Neuen Kommentar schreiben