Was als Toast auf Ross Thomas angefangen hat, entwickelt sich zu einer Miniserie – Alkohol im Kriminalroman – enjoy!
 Reise in die Feuchtgebiete. Alkohol im Kriminalroman (II)
Reise in die Feuchtgebiete. Alkohol im Kriminalroman (II)
Sara Gran und ihre ungeniert alle möglichen Substanzen missbrauchende Ermittlerin Claire DeWitt ist auch deswegen ein „Hallo wach!“ für die Kriminalliteratur, weil wir alle heute doch eher weniger Bluna und insgesamt ziemlich rasend vernünftig geworden sind. „Das Ende der Welt“ kündigt der deutsche Titel von Sara Grans aktuellem Roman an, wo das Original doch nur „Claire DeWitt and the Bohemian Highway“ sieht. Das wird noch lustig, nebenbei, wenn „Dope“ bei uns wiederaufgelegt wird, ihr Porträt eines weiblichen Heroinjunkies im versifften New York der 1950er. Sara Gran jedenfalls und Ross Thomas mit seinem nun wieder vollständig vorliegenden Mac’s-Place-Quartett waren es, die mich veranlassten, der Kriminalliteratur einmal auf ihren feucht-fröhlich-derben Grund zu schauen.
 Es ist ein – wundern wir uns? – nicht gerade häufig behandeltes Thema, der Alkohol im Kriminalroman. Ich werde im nächsten Teil auf die spärliche Sekundärliteratur zurückkommen. Verglichen mit den heutigen kalorien- und gesundheitsbewussten Zeiten ging das Bechern den Protagonisten (wie auch den Autoren) der Kriminalliteratur schon deutlich leichter zu Hand. Ich bin zu der These versucht, dass Alkohol und andere Rauschmittel konstitutiv für die Entstehung des realtitätstüchtigen Kriminalromans waren und auch heute noch jene schartige Scherbe Ungemütliches beizusteuern vermögen, an der wir Welthaltiges erkennen.
Es ist ein – wundern wir uns? – nicht gerade häufig behandeltes Thema, der Alkohol im Kriminalroman. Ich werde im nächsten Teil auf die spärliche Sekundärliteratur zurückkommen. Verglichen mit den heutigen kalorien- und gesundheitsbewussten Zeiten ging das Bechern den Protagonisten (wie auch den Autoren) der Kriminalliteratur schon deutlich leichter zu Hand. Ich bin zu der These versucht, dass Alkohol und andere Rauschmittel konstitutiv für die Entstehung des realtitätstüchtigen Kriminalromans waren und auch heute noch jene schartige Scherbe Ungemütliches beizusteuern vermögen, an der wir Welthaltiges erkennen.

Wie im sich neu entwickelnden Medium Film mit allen seinen überraschenden Blickwinkeln und Wahrnehmungssprüngen, waren es nicht gerade die nüchternsten und spießigsten kreativen Köpfe, die den Krimi auf die Gosse brachten, also auf Alltagshöhe, weg vom Gärtnerschuppen und den Butlerhandschuhen.
Nur nebenbei erwähne ich, dass bei dem seit seinen Studententagen einem Zwitschern stets gerne zugeneigten Edgar Allan Poe „Ein Fass Amontillado“ herumstand und dass Dostojewskijs Kriminalroman „Schuld und Sühne“ ursprünglich „Der Trinker“ heißen sollte und dem Alkoholismus eine weit zentralere Rolle zugedacht war. Dostojewskij wollte Randexistenzen zeigen, vor denen die Gesellschaft die Augen verschloss. Sein Verleger Krajewski jedoch hielt das Thema für nicht literaturfähig. Dostojewskij verlegte daraufhin das Alkoholismusproblem in eine Nebenhandlung, suchte sich einen anderen Verlag. Neuer Held des Romans wurde Rodion Romanowitsch Raskolnikow, der die Gerechtigkeit Gottes hinterfragt. Dem verwitweten und dem Alkohol verfallenen Beamten Marmeladow begegnet er in einer Kneipe. Seine Tochter Sofja verkauft ihren Körper, um die Familie und die Trunksucht ihres Vaters zu finanzieren.

Warnung vor König Alkohol auf Plakaten und Flugschriften (Quelle: wikimedia commons, public domain)
Die Prohibition: Experiment mit nicht so noblem Ausgang
So viel in aller Kürze zu Russland, das, wie wir von Sarah Palin wissen, ja direkt neben Amerika liegt. Auch in der „Neuen Welt“ war Alkohol ein alltagsgegenwärtiges Dauerthema, man führe sich vor Augen, wie ein ganzes Filmgenre, das nicht umsonst alle Konstellationen der altgriechischen Dramenlehre durchdekliniert, immer wieder um einen einzigen Ort kreist: den Saloon. Auf Tisches- und Thekenlänge sind dort alle Konflikt- und Verbrechensvarianten menschlichen Beisammenseins versammelt. Und natürlich auch viele Grundkonstellationen der Kriminalliteratur: der Privatdetektiv, der einsame Ermittler, der Außenseiter, der Rächer, der Fremde in der Stadt.
Robert B. Parker, der über Chandler und Hammett promovierte, das Genre in- und auswendig kannte, unternahm nicht von ungefähr immer mal wieder einen Ausflug in den Westernroman. Seine Protagonisten Virgil Cole und Everett Hitch machen natürlich eine gute Figur – an jeder Bar.
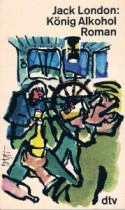 Jack Londons autobiografischer Roman „König Alkohol“ von 1913 (Originaltitel: John Barleycorn), ein zeitloser Klassiker der Suchtliteratur, kann auch als eine gesellschaftliche Bestandsaufnahme des amerikanischen Alkoholproblems gelesen werden. Am Ende des Buches befürwortete Jack London, was dann bald Realität werden sollte. Als der 18. Zusatzartikel zur Verfassung der Vereinigten Staaten (18. Amendment) im Januar 1920 in Kraft trat, glaubten die Verfechter damit die Kur für alles Üble in der Gesellschaft gefunden zu haben.
Jack Londons autobiografischer Roman „König Alkohol“ von 1913 (Originaltitel: John Barleycorn), ein zeitloser Klassiker der Suchtliteratur, kann auch als eine gesellschaftliche Bestandsaufnahme des amerikanischen Alkoholproblems gelesen werden. Am Ende des Buches befürwortete Jack London, was dann bald Realität werden sollte. Als der 18. Zusatzartikel zur Verfassung der Vereinigten Staaten (18. Amendment) im Januar 1920 in Kraft trat, glaubten die Verfechter damit die Kur für alles Üble in der Gesellschaft gefunden zu haben.
Als „The Noble Experiment“ (Das ehrenhafte Experiment) wurde die unter dem Druck der Enthaltungsbewegung zustandegekommene Prohibition bezeichnet. Aber Verbieten alleine hilft nicht, das zeigte sich auch hier. Landesweit ganze 2300 Prohibitionsagenten, weniger als heute die Zahl der bundesdeutschen Lebensmittelkontrolleure, waren auf verlorenem Posten. Als Straftat wurde nur der Verkauf von Alkohol gewertet, nicht der bloße Konsum. Die illegale Produktion und der Handel mit Alkohol breiteten sich rasch aus, der Staat hatte weder Mittel noch Willen, jede Grenze, jeden See und Fluss oder jede „Flüsterkneipe“ zu überwachen. Allein in New York stieg die Anzahl dieser „speakeasies“ von 1922 bis 1927 von rund 5.000 auf über 30.000.
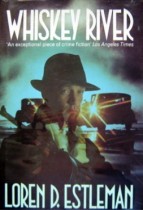 Jeder Schluck, der während der Prohibitionszeit halb legal, illegal, scheißegal in durstige Kehlen rann, beförderte vor allem eins: die Kriminalität, besonders die organisierte. Das noble Experiment entpuppte sich als gigantisches Beschäftigungsprogramm für Gauner aller Kaliber. Allein von 1920 bis 1921 stieg die Kriminalität um 24 Prozent an. Mobster wie Johanny Torrio und Al Capone in Chicago errichteten geradezu Imperien. Loren D. Estleman beschreibt das exemplarisch in seinem Kriminalroman „Whisky River“ (1990).
Jeder Schluck, der während der Prohibitionszeit halb legal, illegal, scheißegal in durstige Kehlen rann, beförderte vor allem eins: die Kriminalität, besonders die organisierte. Das noble Experiment entpuppte sich als gigantisches Beschäftigungsprogramm für Gauner aller Kaliber. Allein von 1920 bis 1921 stieg die Kriminalität um 24 Prozent an. Mobster wie Johanny Torrio und Al Capone in Chicago errichteten geradezu Imperien. Loren D. Estleman beschreibt das exemplarisch in seinem Kriminalroman „Whisky River“ (1990).
Auch bei Mario Puzos „Paten“ (1969) gibt es fünf geniale Seiten, in denen Vito Corleone zum skrupellosen Herrscher eine Mafiafamilie aufsteigt. Alleine in Chicago wurden über 1000 Tote in den „bootleg wars“ gezählt. Als Präsident Franklin D. Roosevelt am 23. März 1933 mit der Unterzeichnung des „Cullen-Harrison Acts“ den „Volstead Act“ von 1919 aufhob und den Verkauf bestimmter alkoholischer Getränke wieder erlaubte, war das Ende der Prohibition gekommen. Am 5. Dezember 1933 hob die Unterzeichnung des „21 Verfassungszusatzes“ den 18.Zusatzartikel wieder auf.
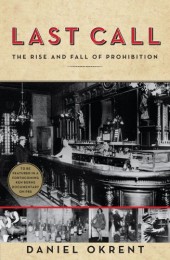 Die schmutzige Seite des schnellen Dollars
Die schmutzige Seite des schnellen Dollars
Zwar war damit das Kerngeschäft Alkohol dem organisierten Verbrechen genommen, die geschaffenen Strukturen aber warteten nur auf neue Geschäftsfelder –auf illegale Betäubungsmittel und Drogen wie Opium etwa, woraus sich der organsierte Drogenhandel entwickelte, mit allen Folgen bis heute. Und noch ein Unkraut wuchs in diesem Klima: die Korruption. Chandler lässt Marlowe in „The Long Good-Bye“ sinnieren:
„We don’t have mobs and crime syndicats and goon squads because we have crooked politicians and their stooges in the City Hall and the legislature. Crime isn’t a disease, it’s a symptom… We’re a big rough, rich, wild people and crime is the price we pay for it, and organized crime is the prize we pay for organization. We’ll have it with us a long time. Organized crime is just the dirty side of the sharp dollar.“
Aus New York gibt es die Anekdote, dass Captain Daniel Chapin all seine Polizisten antreten ließ und ankündigte: „Now everyone of you son of bitches with a diamond ring is fired.“ Es war die halbe Truppe. Literarisch wurde all das zum Nährboden für fiktionale – also in der Wirklichkeit allzu oft vermisste –Gestalten: für den „unabhängigen“ Einzelgänger und Ermittler, den Privatdetektiv, den unbestechlichen Polizisten, sie alle vom Kollektivbewusstsein herbeigesehnte Garanten von Gerechtigkeit.
Der große amerikanische Satiriker Richard Condon beschrieb den durch die Prohibition eingeleiteten gesellschaftlich-kulturellen Wandel in seinem Roman „ Mile High “ von 1969 so:
„It began there – the watershed of modern American crime – and it resolved moral factors for every American born thereafter, instituting approaches to social, governmental, financial and international problems that were henceforth to be based upon an entire people’s contempt for law and authority …
Prohibition fused the amateurism and catch-as-catch-can national tendencies of the early days of the republic with a more modern, highly organized lust for violence and the quick buck. It fused the need to massacre twelve hundred thousand American Indians an ten millions American buffalo, the lynching bees, the draft riots, bread riots, gold riots and gold riots, the constant wars, the largest rats in the biggest slums, boxing and football, the loudest music, the most exploitative press with the entire wonderful promise of tomorrow and tomorrow, always dragging the great nation downward into greater violence and more and more unnecessary death, into newer and more positive celebrations of nonlife, all so that the savage, simple-minded people might be educated into greater frenzies of understanding that power and money are the only desirable objectives for this life.“ (S. 156)
Über die Prohibition gibt es ausreichend Sekundärliteratur, etwa John J. Rumbargers „ Profits, Power, and Prohibition: Alcohol Reform and the Industrializing of America, 1800–1930“, New York 1989; oder Daniel Okrents „Last Call: The Rise and Fall of Prohibition“, New York 2010. Überaus anschaulich auch die dreiteilige TV-Doku „Prohibition“ von Ken Burns aus dem Jahr 2011. Die Episodentitel sprechen Bände: „A Nation of Drunkards“ (Eine Nation von Säufern), „A Nation of Scofflaws“ (Eine Nation von Gewohnheitsverbrechern) und „A Nation of Hypocrites“ (Eine Nation von Heuchlern).
https://www.youtube.com/watch?v=FP9vo2ebupg
Viele große Vermögen wurden während der Prohibitions gemacht, auch das der Kennedys, woraus Richard Condon in dem anti-ödipalen „Winter Kills“ seinen Honig zog (1974, wurde abgemildert auch verfilmt). Nach der Ermordung eines US-Präsidenten werden hier alle nur möglichen Hypothesen bemüht, ehe sich zeigt, dass es der Vater war, der das Attentat in Auftrag gab, weil Söhnchen zu sehr auf den Tugendpfad strebte. (Mehr dazu hier.)
Die Kennedys: Ein Vermögen aus trüben Quellen
Tatsächlich ist durch zahlreiche Quellen dokumentiert, dass Joseph Kennedy gleich zu Beginn der Prohibition in den Alkoholschmuggel einstieg. Die kanadische „Royal Commission on Customs and Excise“ stellte fest, dass sich Kennedy mit seiner Firma namens Silk Hat Cocktail Co. in Vancouver (B.C.) in der Homer Street 1206 mit der ebenfalls dort registrierten Produktionsfirma für Alkohol von Henry Reifel die Büroräume teilte. Einziger Geschäftszweck dieser Firma: die Herstellung alkoholischer Getränke und deren Export in die USA.
In einem 1928 erstellten Bericht dokumentierte die Royal Commission umfangreiche und dauerhafte Unregelmäßigkeiten dieser Firmen. So nutzte Kennedy für den Import von 200.000 Kisten kanadischen Whiskeys und Gins Erlaubnispapiere, die ihm den Import von medizinischem Alkohol gestatteten. Kennedy brannte aber auch illegal Spirituosen, den dafür notwendigen Zucker bezog er von Diamond Joe Esposito, Chef des „Chicago Outfits“, dem damals wohl mächtigsten Gangsterboss der Vereinigten Staaten. Esposito kontrollierte die Distribution des aus Kuba importierten Zuckers im Nordosten der USA.
Der Alkoholschmuggel der Mafia war präsidial abgesichert: Nachdem Präsident Warren G. Harding (1921‒1923), selbst ein Alkoholiker, aufgrund seiner unzähligen außerehelichen Affären untragbar wurde, sicherte sein Nachfolger Calvin Coolidge (1923‒1929) Esposito und allen von ihm mit Zucker belieferten Abnehmern ‒ darunter Joe Kennedy ‒ Protektion zu, als Gegenleistung für politische Unterstützung. Espositos Zuckerlieferungen an Kennedy liefen meist über einen gewissen Sam Giancana, der für Esposito als Fahrer und Enforcer arbeitete und später das Haupt der Chicagoer Mafia werden sollte.
Zum Verkauf seiner Spirituosen brauchte Kennedy die Mafia, die so gut wie alle Speakeasies kontrollierte, deshalb gründete er Allianzen mit Gangstern aus Boston, Chicago, New Orleans und vor allem mit Frank Costello in New York, der dann im Jahr 1973 seine Kooperation mit Kennedy bestätigte und immer behauptete: „Ich half Joe Kennedy, reich zu werden.“ Die Gewinne aus dem Alkoholschmuggel investierte Kennedy an der Börse, wo er erfolgreich spekulierte und investierte, zum Beispiel in Firmen, die in die neu aufkommenden Technologie des Radios involviert waren.
Insiderinformationen waren damals nicht verboten, mit Hilfe willfähriger Journalisten ließen Kurse sich binnen kurzer Zeit in die Höhe schreiben. So gelang es Kennedy und seinen Kumpanen im März 1928, den Kurs der Aktie von RCA innerhalb von nur drei Wochen von 95 auf 160 Dollar zu treiben. Die nächsten Millionen machte Kennedy dann im Filmgeschäft. Aber das ist eine andere Geschichte. Kennedy besaß auch eine Lizenz zum Import von medizinischem Alkohol, als die Prohibition 1933 ganz aufgehoben war, verdiente entsprechend riesige Summen mit dem Verkauf von Alkohol-Lagerbeständen. Den Alkoholhandel gab er erst 1946 auf, um das Image seiner Söhne nicht zu gefährden.
 „Mother of God, is this the end of Rico?“
„Mother of God, is this the end of Rico?“
Mittlerweile wurde der Gangster auch medial gesellschaftsfähig. William Riley Burnett war es, der 1929 mit seinem bald verfilmten Roman „Little Caesar“ den Gangster in den Zeiten von Börsencrash, Großer Depression und Prohibition als kulturelle Ikone etablierte. Edward G. Robinson. Paul Muni und George Raft wurden zu Leinwandrepräsentanten des Gangstertums. Interessant, dass das zeitgleich mit dem Aufkommen der „Talkies“ geschah, solche Figuren also wahrhaft sprechende Abgesandte des Zeitgeistes waren und – wie in den O-Ton-Romanen Hammetts – die Gangstersprache einen neuen Stil befeuerte.
„Mother of God, is this the end of Rico?“, stöhnt der angeschossene Little Caesar. Berittene Polizei musste 1930 in New York den Ansturm auf den Film in Schranken halten, ästhetisch war er der „Reservoir Dog“ seiner Tage, Regisseur Mervin LeRoy war 28, die Produzenten Hall Wallis und Darryl Zanuck 31 und 37, Autor W.R. Burnett 28 und Hauptdarsteller Edward G. Robinson 30 – allesamt fröhliche Zecher.
Burnett hatte auch eine Autorenzeile im Abspann des einflussreichsten Gangsterfilms der Dekade, in Howard Hawks „Scarface“ von 1932. Zwölf Autoren hatten vor Burnett schon daran gearbeitet, er erhielt 2.000 Dollar die Woche, damals eine Heidensumme; Hawks, immer noch nicht zufrieden, heuerte dann auch noch Ben Hecht an. Weil es in „Scarface“ 43 Morde gab, verlangte die Zensur (der Motion Picture Production Code) den Untertitel „The Shame of the Nation“. Der Film war bereits 1930 fertiggestellt, aber die Zensurbehörden gaben ihn wegen der gewalttätigen Szenen und der Glorifizierung des Gangstertums nicht frei.
Produzent Howard Hughes ließ nachdrehen (Regie Richard Rosson), es gab eine neue Einführung und ein neues Ende. 1932 kam der Film schließlich in dieser entschärften Version in die Kinos.Regisseur Hawks war mit der Softversion unzufrieden und brachte den Film in einigen Bundesstaaten, in denen die Zensur weniger strikt gehandhabt wurde, auf eigenes Risiko in seiner Director’s-Cut-Fassung heraus.
Ganz am Kino vorbei lief in Deutschland die Verfilmung eines interessanten neueren Romans: Matt Bondurants „The Wettest County in the World“ (2008). Die ziemlich gewalthaltige, an viele tatsächliche Ereignisse angelehnte und in Teilen autobiografische Geschichte einer Alkoholschmugglerfamilie – es war der Großvater des Autors – wurde von Nick Cave als Drehbuch adaptiert und von seinem Kumpel John Hillcoat als „Lawless“ verfilmt. Der recht kompromisslose Australier Hillcoat war nicht nur Regisseur der großartigen „Proposition“, sondern 1988 Regisseur des atembeklemmenden Gefängnisfilms „Willkommen in der Hölle“ (Ghosts … of the Civil Dead), das aber nebenbei. Unbedingt erwähnt werden muss aber hier die HBO-Serie „Boardwalk Empire“, die alle hier erwähnten Zusammenhänge auf das visuell Profundeste transportiert.
 Sie wussten, wovon sie schrieben
Sie wussten, wovon sie schrieben
Eine vom Alkohol also geradezu besessene Nation, das waren die USA in den 1920ern. Und natürlich fand das alles Eingang in die Literatur, so holzhaltig das Papier auch sein mochte, auf dem man sie druckte. Ein wichtiger Förderer solcher Geschichten: Captain Joseph T. Shaw, von 1926 bis 1936 Herausgeber des Magazins „Black Mask“, das der Journalist H. L. Mencken and Theaterkritiker G.J. Nathan 1920 gegründet hatten, um damit ihr anspruchsvolleres Magazin „The Smart Set“ zu finanzieren. (Ein Modell, das Victor Gollancz in England übernahm, wo er mit Kriminalromanen und Thrillern von Chandler bis Amber sein sozialistisch angehauchtes Programm subventionierte, was wiederum hierzulande der Krähen-Bücherverleger Karl Anders dann auch versuchte, leider erfolglos, weil die angloamerikanisch orientierten Krähenbücher in der Adenauerzeit am Publikumsgeschmack vorbei gingen, da waren von Agatha Christie und Edgar Wallace angesagt, nicht Schnapsdrosseln wie Chandler und Hammett.)
Für Shaw schrieben Autoren wie Paul Cain, Frederick Nebel, Raoul F. Whitfield, Dashiell Hammett, Raymond Chandler und Erle Stanley Garder. Dessen Geschichte „Just a Suspicion“ (Februar 1929) erzählt von einem Gangster der zwei Sachen verkauft: Alkohol und Schutz. Die Erlebnisse von Hammetts Continental Op erschienen als „Black Mask“-Geschichten, ebenso wie von November 1927 bis Februar 1928 die Episoden „The Cleansing of Poisonville“, „Crime Wanted – Male or Female“, „Dynamite“ und „The 19th Murder“, bei Alfred A. Knopf 1929 dann als „Red Harvest“ (Blutige Ernte) – eines der 100 wichtigsten Bücher des letzten Jahrhunderts.
Alkohol ist selbstverständlich im Korruptionsnest Personville. Der trinkfeste Continental Op setzt den Fusel gerne ein, um anderen die Zunge zu lockern. Etwa bei einer der interessantesten Frauenfiguren Hammetts, bei der jungen Halbweltsdame Dinah Brand (unnachahmlich im Original: „a soiled dove … a deluxe hustler, a big-league gold-digger“).
„Dinah“, stellte der Schwindsüchtige mich vor, „der Herr kommt aus San Francisco von der Continental Detectice Agency…“ Die junge Frau stand auf, sie war ein paar Zentimeter größer als ich … ihr Gesicht, das eines Mädchens von fünfundzwanzig, das schon ein bißchen ramponiert wirkte … Das also war Dinah Brand, die allem Vernehmen nach so unter Pissvilles Männern wütete …“
Der OP und sie bechern eine ganze Flasche Gin , als sie mit ihrem Glas den Tisch verfehlt, legt er nach mit seinen Fragen, provoziert sie – und erhält ein paar wichtige Antworten. Öfter noch kommt er zu ihr zurück, einmal „mixt sie gerade Gin, Wermut und Orange Bitter in einem Liter-Shaker, in dem nicht viel Spielraum zum Schütteln war“. Noch als er nach einem Überfall aufwacht und sie ermordet neben sich findet, er das Tatwerkzeug in der Hand; braucht er etwas hinter die Binde: „Ich ging in die Küche, fand ein Flasche Gin, kippte sie mir gegen den Mund und hielt sie so, bis ich Atem holen mußte.“
Hammett wusste, wovon er schrieb. Er war ein schwerer Trinker, ebenso wie Raymond Chandler und wie andere. „Die chemische Analyse der sogenannten dichterischen Inspiration ergibt neunundneunzig Prozent Whisky und einem Prozent Schweiß“, ist von William Faulkner überliefert, der unter anderem das Drehbuch für Chandlers „Tote schlafen fest“ (The Big Sleep) verfasste. Dessen Hauptdarsteller Humphrey Bogart fand:
„Man muss dem Leben immer um mindestens einen Whisky voraus sein.“
Seine angeblich letzten Worte am 14. Januar 1957:
„Ich hätte nie von Scotch auf Martini umsteigen sollen.“
Die Hays-Kommission ‒ eine Art „freiwillige“ Selbstkontrolle der Filmwirtschaft, mit der staatliche Zensur abgewendet werden sollte – versuchte, die positive Darstellung von Alkohol im Film zu verhindern, das wurde auch bis auf Ausnahmen wie der Hammett-Verfilmung „Der Dünne Mann“ (1934) oder „Verdammt in alle Ewigkeit“ (1953) durchgezogen, auch im Film Noir. Paul Fussell beschreibt in „Wartime: Understanding and Behaviour in the Second World War“ (New York, 1989), welch wichtige Rolle Alkohol zwischen 1920 und 1950 in den Vereinigten Staaten einnahm.
Als Trinkverhalten blieben Cocktails, meist aus starken Spirituosen und nichtalkoholischen Getränken gemischt, auch nach der Prohibition in den USA noch lange beliebter als Wein und Bier. „Zur Zeit des Zweiten Weltkrieges hatte es sich eingebürgert, dass jeder sozusagen ein verfassungsmäßiges Recht auf ein Saufgelage habe“. Völlig selbstverständlich geht es bei Hammett und Chandler ans Picheln. Mit die ersten Worte von General Sternwood in „Der große Schlaf“: „Brandy, Norris.“ Und an seinen Gast Marlowe gewandt: „Wie trinken Sie Ihren Brandy, Sir?“ Der Mann, den der Privatdetektiv suchen soll ist ein „bootlegger“, ein Alkoholschmuggler, der General hat einen Narren an ihm gefressen, kann ihn sich als Schwiegersohn gut vorstellen.
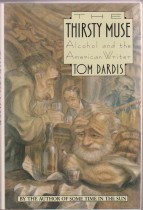 Die durstige Muse: das Beispiel Raymond Chandler
Die durstige Muse: das Beispiel Raymond Chandler
Upton Sinclair focht als „trockener Moralist“ noch 1931 in seinem Roman „Alkohol“ für die Prohibition In seinem „The Cup of Fury“ (Becher des Zorns) beklagte er sich 1954:
„Es war mein Schicksal, unter trinkenden Menschen zu leben, unter Romanautoren, Dichtern, Dramatikern und Stars von Bühne und Film. Ich habe mehr als vierzig von ihnen gekannt, die untergingen, elf von ihnen endeten durch Selbstmord. Es ist furchtbar, wie viel Talent und Genie durch Alkohol zugrunde gerichtet wird.“
Nehmen wir den Öl-Geschäftsmann Raymond Chandler. Tom Dardis schreibt in „The Thirsty Muse: Alcohol and the American Writer“:
„Drunkenness, however, became Chandler’s personal nemesis. „At the annual oil and gas banquets of 1,000 rollicking oil men at the Biltmore,“ said one Dabney executive, „Chandler was a shadowy figure, stinko drunk and hovering in the wings with a bevy of showgirls, a nuisance.“
He began to disappear from work, took up with a secretary and eventually threatened suicide. In 1932, the cellar of the Depression, Chandler was fired. He was forty-four, with a sixty-two-year-old wife and a drinking problem. Fleeing to Seattle, he lived with army buddies, and then „wandering up and down the Pacific Coast, I began to read pulp magazines,“ he wrote:
„This was in the great days of Black Mask and it struck me that some of the writing was pretty forceful and honest, even though it had its crude aspect. I decided that this might be a good way to try to learn to write fiction and get paid a small amount of money at the same time.“
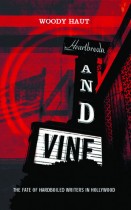 Chandlers allgemein als Loblied des Todes angesehene Stelle in „Der große Schlaf“ („Where did it matter when you were dead … You just slept the big sleep, not caring about the nastiness of how you died or where you fell“) kann auch auf den großen Filmriss gemünzt sein, den erlösenden Vollrausch. „Look for good shooters“, hatte Fritz Lang Billy Wilder geraten, als der Autoren suchte und so an Chandler geriet, der ab 1943 im Sold von Paramount stand und nun helfen sollte, aus James M. Cains „Double Indemnity“ ein knapp an der Zensur vorbeischrammendes Drehbuch zu schmieden. (Die Zusammenarbeit mit Wilder wäre eine eigene Betrachtung wert, da kamen zwei Kreative zusammen, die sich fetzten, der eine sah „A lot of Hitler in Chandler“, der andere sein „Leben verkürzt“, beide hatten sie Riesenrespekt voreinander.)
Chandlers allgemein als Loblied des Todes angesehene Stelle in „Der große Schlaf“ („Where did it matter when you were dead … You just slept the big sleep, not caring about the nastiness of how you died or where you fell“) kann auch auf den großen Filmriss gemünzt sein, den erlösenden Vollrausch. „Look for good shooters“, hatte Fritz Lang Billy Wilder geraten, als der Autoren suchte und so an Chandler geriet, der ab 1943 im Sold von Paramount stand und nun helfen sollte, aus James M. Cains „Double Indemnity“ ein knapp an der Zensur vorbeischrammendes Drehbuch zu schmieden. (Die Zusammenarbeit mit Wilder wäre eine eigene Betrachtung wert, da kamen zwei Kreative zusammen, die sich fetzten, der eine sah „A lot of Hitler in Chandler“, der andere sein „Leben verkürzt“, beide hatten sie Riesenrespekt voreinander.)
Chandler wurde für kurze Zeit einer der bestbezahlten Hollywoodautoren, erhielt 25.000 Dollar für das halbfertige Skript von „Blue Dahlia“. Um es fertig zu schreiben – und dafür nüchtern bleiben zu können ‒ handelte er bis dahin unerhörte Bedingungen aus: die Erlaubnis, zu Hause zu arbeiten, eine offene Telefonverbindung ins Studio, sechs Sekretärinnen, zwei Cadillacs mit Chauffeur zu seiner Verfügung, um etwa einen Arzt zu holen oder die Haushälterin auf den Markt zu kutschieren. 42 Tage später gab ein betrunkener Chandler das fertige Drehbuch ab. (Beschrieben in Woody Haut: Heartbreak and Vine. The Fate of Hardboiled Writers in Hollywood; Serpent’s Tail, London 2002)
Chandler war ein alkoholisches Wrack, als sein Agent ihm nach dem Kassenerfolg der „Blauen Dahlie“ einen Wochenkontrakt von 4.000 Dollar sicherte. Filme waren das lukrativste Unterhaltungsgeschäft der Welt geworden. Chandler zog 200 Meilen südlich nach La Jolla, sein Verhalten wurde immer erratischer, er überwarf sich mit Hitchcock bei Patricia Highsmiths „Strangers on a Train“, unternahm 1954 nach dem Tod seiner Frau Cissy in betrunkenem Zustand einen Selbstmordversuch, schrieb in einem Brief an einen englischen Leser über seinen Protagonisten Marlowe:
„Drinks anything so long as it is not sweet.“
Chandlers verächtliche Haltung gegenüber Ärzten resultierte, meint Peter Wolfe in „Something More Than Night“ daher, dass sie seine alkoholkranke Frau nicht retten konnten. Sein Philip Marlowe führt innere Monologe über das Trinken:
„Alcohol is like love. The first kiss is magic, the second is intimate, the third is routine.“
Oder:
„Alcohol is like love. The first kiss is magic, the second is intimate, the third is routine.“
Oder: „It was the same old cocktail party, everybody talking to loud, nobody listening, everybody hangigng on for dear life to a mug of the juices, eyes very bright, cheeks flushe or pale or sweaty according to the amount of alcohol consumed and the capacity of the individual to handle it.“ – (Beides aus „The Long Goodbye“.)
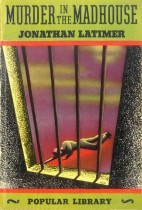 Alles Flüssige, notfalls auch aus der Leichenhalle
Alles Flüssige, notfalls auch aus der Leichenhalle
Jonathan Wyatt Latimer (1906‒1983), einen der Letzten der alten Hardboiled-Schule und ein Kumpel von Hemingway, muss man heutzutage als Vorläufer von Sara Gran ansehen. Sein Privatdetektiv Bill Crane trinkt alles, wirklich alles, in „Headed for a Hearse“ (Wettlauf mit der Zeit) sogar Einbalsamierungsflüssigkeit. In „Solomon’s Vineyard“, einer Hommage an Hammett, bereitet er seine Leser auf den folgenden wilden Ritt so vor: „Listen. This is a wild one. Maybe the wildest yet. It’s got everything but an abortion and a tornado. I ain’t saying it’s true. Neither of us, brother, is asking you to believe it.“
Betrunken wird Crane witzig, hellsichtig und unkonventionell, stolpert über Möbel und Worte ebenso wie über die Lösung eines Falls. In „Murder in the Madhouse“ (Mord bei Vollmond) sieht das dann so aus:
„He felt very pleased he had fooled them into thinking he was drunk … He carried out his role so thoroughly he had to be helped into the phone booth.“
„Headed For a Hearse“ (1935) war eine der ersten hardboiled Screwball comedies (womit wir wieder bei Ross Thomas wären, folgte Hammetts „Dünnen Mann“ knapp auf den Fersen. Auch das New York von 1926, das der stets gut recherchierende und ziemlich elegante Georg Baxt in „The Dorothy Baxter Murder Case“ zeigte, schwimmt förmlich im Alkohol, vor allem für die Reichen und Berühmten, ebenso dann Hollywood in seinem „Talking Pictures Murder Case“. In dunklere Kaschemmen geht es in den Kriminalromanen mit dem Hollywood-Stuntmann und Privatermittler Lucas Hallam in L. J. Washburns „Dead Stick“ (1989) und „Dog Heavies“ (1990).
Als Absacker für heute aber nun Nick Charles aus Hammetts „Dünner Mann“, einer wirklich hochprozentigen Dauer-Hoch-die-Tassen-Kriminalkomödie. Dort findet sich der Satz:
„Ich erhob mich aus dem Bett und trat an die Bar, um ihr einen Drink zu mixen.“
Fortsetzung folgt.
Alf Mayer
Hier mehr zu Alkohol (resp. Drogen) und Kriminalliteratur von Alf Mayer.
Foto Vodka: wikimedia commons, Kamil Porembiński











