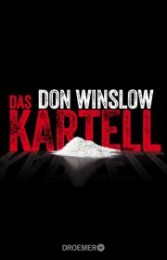 Surfer, bleib bei deinen Wellen
Surfer, bleib bei deinen Wellen
– Warum Don Winslows neuer Roman „Das Kartell“ im Meer der Fakten Schiffbruch erleidet. Eine Besprechung, äh, eine Abrechnung von Alf Mayer.
Dieses Buch macht nicht glücklich. Nicht, weil es jede Menge grausamer Einzelheiten aus dem sogenannten Drogenkrieg ausbreitet, der in Mexiko bislang über 100.000 Menschenleben gekostet hat. Es gibt wunderbare Bücher über schlimmste Themen. Man könnte sagen, je härter das Thema, desto höher der Anspruch an eine gelungene Form. Leider entspricht „Das Kartell“ in der Form dem Inhalt. Macht was her, aber wenn man es liest, geraten der Leim der Klappenbroschur wie auch die Erzählform an ihre Grenzen. Selbst bei pflegsamer Lektüre hinterlässt bereits das erste Lesen dauerhafte Spuren an der Bindung, macht den Buchblock schief und krumm. Die Buchdeckel sind eh nur pro Forma, handelt es sich doch inhaltlich um einen ziemlich geschmacksneutralen, aufgeblähten Guglhupf.
Winslows Hefeteig ist die mexikanische Wirklichkeit, monströs genug, aber er erzählt sie meist nur nach, verdichtet sie nicht zu etwas, das man Literatur nennen könnte. Dies in einer Kraftmaxen-Prosa, die stets tut, als hätte sie alles im Griff. Aber es fehlen Eleganz, Besonderheit, Risiko, Temperament – und am schlimmsten, wirkliche Empathie für all das Leid, auch wenn sie behauptet wird. Winslow will cool sein, das ist sein Hauptaugenmerk. Hier ist das öfter ziemlich obszön. Zunehmend machte die Lektüre mir Mühe, am Ende fragte (und frage) ich mich, wozu?
Nun, ich bin mir wenigstens über die Probleme des Erzählens im Präsens klarer geworden. Die Gegenwartsform. Winslows Masche. Pardon, Stil. Und sein Problem. In „Das Kartell“ ganz besonders.
Sogar Homer soll jetzt überflüssig sein, Tolstoi auch
2005, vor zehn Jahren, war es noch eine achtungsgebietende Tat, den US-amerikanischen Krieg gegen die Drogen in epischer Form in einem Thriller zu behandeln. Das galt auch noch 2010, als Don Winslows „Power of the Dog“ bei Suhrkamp als „Tage der Toten“ (Siehe CM hier) heraus kam. Es folgten „kleinere“ Bücher („Tage des Zorns“ (Siehe CM hier), „Kings of Cool“ (Siehe CM hier)) und Winslow stieg – wie das bei uns Kritikern so ist – schnurstracks in den Genie-Himmel auf (zu einem CM-Interview mit Winslow hier). Dort sitzt er nun, hat mit „Vergeltung“ und „Missing New York“ (siehe CM-Besprechung und TW im Freitag) zwei – freundlich gesagt – misslungene Bücher abgeliefert, die bis heute gar nicht in den USA erschienen sind, wohl auch nie werden, wechselte für ordentlich viel Geld von Suhrkamp, wo noch seine Frühwerke veröffentlicht werden, zu Droemer. Don Winslow ist zu einer Investition geworden, dagegen muss man per se nichts haben. Allerdings gegen allzu viel Hype.
Nun also „Das Kartell“, 832 Seiten dick, als monumentale Klappenbroschur und stolze vier Wochen vor der US-Ausgabe erschienen. Galt es hier, im Stapelkampf der Sommerschwarten mitzuhalten? Ok, dieses Publikum liest eh Ex und Hopp, das kann man nicht weiter versauen. Wem aber daran liegt, Kriminalromane als achtbares Genre zu behaupten, für den ist ein solch ein halbgarer Holzschnittschinken wie „Das Kartell“ es ist – und dann auch noch in derart höchsten Tönen beworben – eher rufschädigend. Winslow strapaziert mit „Kartell“ nicht nur seinen eigenen Kredit als Autor, der laute Auftritt dieses unterklassigen Werkes auf dem Markt ist eine Negativreklame, ein nicht eingelöster Claim, wie sie in der Werbung sagen. Es ist schlicht kontraproduktiv, wenn ein James Ellroy, in den USA im gleichen Verlag daheim wie Winslow, von einem neuen „Krieg und Frieden“ faselt, andere den Vergleich mit Upton Sinclairs „Dschungel“ ziehen oder wenn der „stern“ gar Homers „Ilias“ für obsolet erklärt, weil wir ja nun Winslow haben.
Geht’s noch? Uwe Nettelbeck bespöttelte so etwas vor langer Zeit in der „Filmkritik“ als „Wer schreibt den schönsten Supersuperlativ?“. Gut, dass er das jetzt nicht erleben muss. Mainz, wie es singt und lacht. Ellroy, alaaf. Du teilst dir den schwachsinnigsten Supersuperlativ mit dem Blatt aus Hamburg.
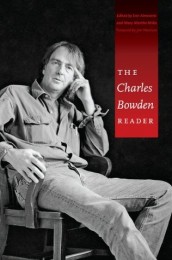 Der Drogenkrieg als Aktenzeichen XY
Der Drogenkrieg als Aktenzeichen XY
Natürlich höre ich jetzt wohlgesinnte Freunde murmeln, aber musst du denn? Und: Er hat aber doch auch … Ja, hat er. Die immense Arbeit, die im „Kartell“ steckt, das Recherchevolumen, die Organisation von so viel Material, das ist eine gewaltige Leistung. So, wie auch Geschäftsberichte beeindruckend, aber nicht unbedingt lesbar sind. Winslow, dazu komme ich weiter unten, scheitert an seiner eigen Form. Er hat sich überhoben. „Das Kartell“ ist kein neuer Höhepunkt der Kriminalliteratur, es ist eine Niederlage. Sie wird noch schlimmer, wenn man sich mit dem Thema ein wenig auskennt, nicht bei Winslow das Erstsemester Drogenkrieg belegt. Jede beliebige Seite bei dem in Deutschland nicht übersetzten Charles Bowden (siehe CM hier und hier) oder die zwei Kapitel über Mexico in „Chasing the Scream“, dem Ausnahmebuch von Johann Hari (siehe CM hier), bieten mehr an Anschauung und literarischer Qualität. (Siehe dazu die Literaturhinweise unten).
In seinen Interviews zu „The Cartel“ betont Winslow immer wieder, dass er ja eigentlich Historiker sei, sich gar von den Azteken her der mexikanischen Gegenwart angenähert habe, aha, zum anderen hebt er ab auf die Unwissenheit des amerikanischen Publikums, wahlweise der weltweiten Leserschaft, in Sachen „War on Drugs“, geriert sich als Aufklärer. Wohl deshalb tauchen gewisse didaktische Einheiten gleich mehrfach auf, dies immer in „USA-Today“- oder „Welt kompakt“-Qualität. Einfache Botschaften für einfache Gemüter. Eine für die Genese des Drogenkrieges konstituierende Figur wie Harry Anslinger, der bei Johann Hari einen großen Auftritt hat und kürzlich von unserm Thailand-Korrespondenten Christopher G. M vorgestellt wurde, hat bei Winslow keinen Platz, so tief wird da nicht geschürft.
Don Winslows Erzählperspektive ist buchstäblich kurzsichtiger. Seit längerer Zeit schon hat er sich auf das Präsens als Erzählzeit versteift. Ich nenne es den Aktenzeichen-XY-Stil: „Herr Soundso ist am Soundsovielten gerade am Zeitungslesen, als die Tür aufgeht. Er blickt auf und sieht …“ Nicht allzu viel, immer nur den Blickwinkel seiner Gegenwart und eben nur soweit sein Auge reicht. Erzählerisch ist das eine Einengung, zusätzlich problematisch durch die Notwendigkeit, Zeitgeschichte zu erzählen. (Dazu weiter unten mehr.)
In einem Interview mit dem Magazin „Esquire“ benannte Winslow den Unterschied zwischen den beiden großen Drogenromanen „Power of the Dog“ (Tage der Toten) und „The Cartel“ und seinen anderen Büchern so:
„Mit „Zeit des Zorns“ („Savages“) war es mehr wie der Schwung, den du hast, wenn du eine Welle erwischst und sie reitest. Ein Wort gibt da das andere. „Dog“ und „Cartel“ waren wie ein Marathonlauf, ein Fuß vor den anderen, ein Fuß vor den anderen, immer wieder, und irgendwann lässt der Schmerz nach und du erreichst, was du für die Ziellinie hältst. Nachdem ich mit „Dog“ fertig war, hatte ich nie vor, „Cartel“ zu schreiben. Aber ich musste, und stieg wieder ein, kickend und schreiend, weil „Dog“ mich so fertig gemacht hatte. Aber es war ja alles noch schlimmer geworden in Mexiko… Du schaust auf diese Überschriften, und du fragst dich, warum das alles geschieht. Du versuchst, einen Sinn herauszulesen. Hineinzulegen. Und der einzige Weg, das zu tun, geht mit Chronologie. B ergibt sich aus A, und so weiter. Eine der ersten Sachen, die ich beim Schreiben von „Cartel“ machte, war es, eine Zeitlinie anzulegen, durch mein Recherchematerial zu gehen und jeden Tag aufzuschreiben, an dem etwas geschah… Am 13. Juli 2001 geschah dies, an diesem Datum entkam dieser Kerl aus dem Gefängnis … So machst du einfach weiter und dann schaust du nach größeren Ereignissen, die Wahlen in Mexiko zum Beispiel. So kannst du das Mega und Mikro von allem zusammenziehen, kannst verstehen, was ein scheinbar sinnloser Mord gewesen war.
Meine anderen Romane gingen mehr von ein paar Tönen aus – oder sagen wir, der Surfwelle –, und dann kamst du in Stimmung, hast eine Stimme gefunden und alles schnurrte beinahe wie von selbst ab, du warst fröhlich unterwegs. „Dog“ und „Cartel“ waren da ganz anders. Da ging es nicht darum, dass ich eine gute Zeit hatte. Da ging es um diese Leute in dieser Zeit. Ich hoffe, es hat immer noch Musik, weil mir das wichtig ist, aber das Schreiben war sehr, sehr anders. Es ging weit mehr darum, unter all den Fakten die Geschichte zu finden. Es war weit mehr, oh Gott, eine Sache der Recherche.“
Der „Herr der Grenze“ hat keine Stimme
In einem Meer von Fakten, in einer der schwierigsten Gemengelagen der aktuellen Weltgeschichte, erfindet der Surfer Don Winslow sich also einige Personen, mit denen er die gewaltigen Wellen reiten will. Das Problem ist, er lässt ihnen kaum eine Gelegenheit für eine Seele. (Manchmal dachte ich, auch Winslow hat keine, er ist ein Erzähl-Android, spult halt etwas ab.) Am meisten trifft das seine Hauptfigur – seinen so langjährigen, alten Freund, wie er sagt, mit dem er mehr als ein Dutzend Jahre verbracht hat – Art Keller, DEA-Agent. So wenig wir aus den Tiefen seiner Seele etwas erfahren außer Pauschalsätzen wie „Satan kann dich nur zu dem verführen, was du schon hast“, so wenig Näheres erfahren wir von der Drug Enforcement Administration (DEA), der dem US-Justizministerium unterstellten Strafverfolgungsbehörde, deren Aufgabe es ist, die illegale Herstellung von Drogen und den Drogenhandel in den USA zu unterbinden. Außer den Frontschwein & Etappenhengst-Plattitüden ist vom Wirken dieser Behörde wenig die Rede, sie dient nur als Vehikel, dass da einer ihrer angeblich erfahrensten Ermittler, einst „Herr der Grenze“ genannt, bis zum Ende einen über viele Leichen gehenden privaten Rachefeld durchzieht. Aber obwohl Keller der Haupterzähler ist, hat er keine sonderlich eigene Stimme. Keine von Winslows Figuren hat eine. Das macht sie alle flach. Macht ihre Tragödien zu Behauptungen auf Papier.
 In ihren Armen, das Kind war tot …
In ihren Armen, das Kind war tot …
Wie „Power of the Dog“ beginnt auch „The Cartel“ mit einem Baby. Damals lag es tot in einer Mutter Arm – hat man da nicht gleich das Bild einer Pieta vor Augen? –, hier schreit es noch, aber der Erzähler befindet sich in einem Kampfhubschrauber über ihm. (Wie kann er es im Hubschrauber eigentlich hören?, egal.) Er ist mit einem „Tötungskommando auf ausländischem Territorium im Anflug, „… es wird Tote geben, so viel ist sicher. Heute ist der Tag der Toten.“ Es ist Art Keller, dem Winslow bereits in „Tage der Toten“ bis ins Jahr 2004 folgte. Jetzt ist es laut Prologdatum der 1. November 2012, 800 Seiten wird es brauchen, bis die Handlung wieder bei dem Blackhawk-Angriff auf das Dschungeldorf in Guatemala angekommen ist, wo Keller seinen Feind Barrera endlich erledigen will. Geile Tarantino-Szenen erwarten die Leser, die durchgehalten haben. Die „panteras“, die weibliche, sexy Killertruppe der Zetas, ist dort unten auf die Männer von Barrera angesetzt, sie machen sie beim Versöhnungsfest trunken und töten sie dann beim Ficken. Da ragen dann sogar die Granatsplitter obszön in die Höhe in all dem Gemetzel. Auch die „pantera“-Anführerin La Comandante Bonbon geht nach einem Blowjob drauf. Der Name ist nicht mal erfunden, die Zetas hatten und haben tatsächlich einige weibliche Killertrupps, Maria del Pilar Narro Lopez alias „La Comandante Bombon“ aber sitzt meines Wissens in einem mexikanischen Gefängnis. Gönnen wir Winslow diesen Spaß.
Der Ton für „Das Kartell“ freilich wird im Prolog gesetzt. Baby, Zivilisten, ein Tötungskommando aus der Luft, „erfahrene Söldner, früher Seals, Green Berets oder bei der Delta Force, mit Kampferfahrungen in Irak, Afghanistan, Pakistan, Somalia, heute technisch Privatsöldner bei irgendeiner Sicherheitsfirma in Virginia“. Sie werden auf die Krieger der Narcos treffen, ebenfalls Elitesöldner, ausgebildet in den USA, vielleicht von denen, die da in zwei Blackhawks unterwegs sind, um sie zu töten. Dann gibt es Beschuss, Qualm und Rauch. Vorhang. Ende des Prologs.
Winslow inszeniert sich im Entree als Actionautor, Kaltblütigkeit gegenüber Toten inklusive. Das ist der Zivilisationsstand 2012. Poesie adieu, Leichen pflastern unsern Weg. „Das Kartell“ ist auch eine Reise in die Verrohung. Winslow gelingt es nicht, darin ist er Tarantino ebenbürtig, sonderliche Mitgefühle für Opfer zu wecken. Wie Tarantino verlegt er sich lieber auf die Sadistenseite, auf die Täter, sucht die vordergründigen Schockmomente. Sein problematischer Präsens-Stil läuft zu großer Form auf, wenn er etwa (von Seite 209 bis 214) ausführlich eine Folter namens „Carne asada“ beschreibt, bei dem auf lebender Haut „Schmorbraten gemacht wird“. Oder wenn – dies gleich zwei Mal, mit wechselndem Personal – eine gefangen genommene Frau anbietet, alles, „wirklich alles zu machen“. Winslow erzählt dann auch noch, was das ist. Nicht weil ich prüde bin, aber in diesem Moment verrät er seine Figur für nichts weiter als eine kurze Grenzüberschreitung, einen billigen Effekt.
Das Bleigewicht der kurzen Sätze
„The Power of the Dog“ hatte, datiert auf 1975 und die Provinz Sinaloa, evokativer angefangen:
„Der Mohn brennt.
Rote Blüten, rote Flammen.
Nur in der Hölle, denkt Keller, gibt es flammende Blüten.
Er blickt in das brennende Tal wie in eine dampfende Suppenschüssel – was sich dort zwischen den Rauchschleiern abspielt, ist eine Höllenszene.
Hieronymus Bosch malt den Drogenkrieg.“
Das machte Eindruck. Auch wenn, nachträglich betrachtet und das Buch wieder gelesen, die Special Effects doch ein wenig dünne waren. Fünf magere Zeilen also, und wir sind bei einem Maler, wie es ihn seitdem nicht mehr gab. Wie es auch Winslow nicht ist. Aber immerhin, da war noch etwas Poesie bei ihm, 2005, als „Power of the Dog“ erschien.
Sie ist verdampft.
„Das Kartell“ wartet nicht annähernd mit solch einer Evokation auf.
Ich blättere in Büchern anderer Autoren, nachdem ich „Das Kartell“ ganz gelesen habe – und hungrig geblieben bin. Auf 22 Seiten schreibt Johann Hari in „Chasing the Scream“ über Mexiko, hauptsächlich Ciudad Juarez, wo er – anders als Winslow – auch tatsächlich war. Auf diesen 22 Seiten drängt sich mehr an zu Erkenntnis und Poesie verdichtete Wirklichkeit als Winslow das auf mehr als 800 gelingt. Haris Erzählung von den Straßenjungen, die sich in überdimensionierten Engelskostümen wie himmlische Wächter über die Leichen von Ermordeten stellen, schneidet sich ins Gedächtnis. Oder jener Kinderkiller, dessen tätowierter Körper von einer Topografie des Terrors erzählt. Alleine solch ein Satz, eigentlich doch ein Winslow-Satz – „The Cartels prefer kids… they don’t understand death“ – fehlt Winslow ganz. Weil er keinen Sinn für Metaphysik hat. Wie soll man da Mittelamerika verstehen?
Winslows kurze Sätze erweisen sich im „Kartell“ als Bleigewicht. Man stelle sich vor, die „Buddenbrooks“ oder „Krieg und Frieden“ oder „Der große Gatsby“ wären weitgehend in Hauptsätzen und mit Einzeilern erzählt. Zunehmend ertappte ich mich beim Lesen, wie ich mich Fantasien hingab, nun spaßeshalber die Winslow-Versionen großer Romane zu schreiben. Alles auf Steichholzlänge zu stutzen und damit dennoch die hohen Töne zu pfeifen versuchen. „Hundert Tage Einsamkeit in hundert Sätzen“, „Moby Dick für Dummies“, „Karl Marx für Anfänger“. Mit Pathos auf Pulp-Niveau. Kitsch und Klischees freigebig aus dem großen Streuer.
Hieronymus Bosch malt den Drogenkrieg.
Fünf Worte, und du hast ein Bild.
Bei dem Kritikern die Spucke wegbleibt.
Klar?
Dieser Krieg ist ein Karussell
Seltsam deplatziert wirkte auf mich bereits die Widmung im „Kartell“, eine eineinhalbseitige Auflistung von über hundert Namen, tote oder „verschwundene“ mexikanische Journalisten. Eine Geste, ja, aber liest jemand all diese Namen in solch einer Präsentation? Wie lange bleibt das präsent, wenn auf der gegenüberliegenden Seite schon das Baby schreit, die Kampfhubschrauber schwirren, massenhaft Tote angekündigt werden?
Unerwartet kontemplativ dann der Anfang des erstes Kapitels, eine Rückblende auf 2004, ein Schweigekloster in New Mexiko, ein Mönch, recht neu dabei und sich den Bienen widmend. Aber schon bricht die Wirklichkeit ein. Zwei FBI-Agenten suchen ihn auf, die Vergangenheit holt den Klostergänger ein. Es ist Art Keller, in „The Power of the Dog“ hatte er 30 Jahre Krieg gegen den Drogenboss Adán Barrera geführt und ihn hinter Gitter gebracht, jetzt hat der zwei Millionen Dollar Kopfgeld auf ihn ausgesetzt, ist auf dem Weg nach Mexiko.
Der Krieg geht weiter.
Die Erzählweise von Winslow auch.
Kurze Sätze.
Gefühle kann man sich selbst in die Sprechblasen malen.
Das funktioniert sogar.
Eine Weile.
Denn wir mögen es cool.
Und es liest sich so easy.
Auch harte Wahrheiten.
Oder kompliziertes Zeug.
Auch das kriegen wir klein.
Kleine Kostprobe?
„Was man an den Amerikaner bewundern muss, ist ihre Beständigkeit.
Sie machen unter Garantie das Falsche.“
Und man weiß natürlich auch schon auf Seite 33, was da Sache ist.
„Der sogenannte Krieg gegen die Drogen ist ein Karussell.
Fliegt einer raus, steigt sofort der Nächste ein. Und solange die Gier nach Drogen unersättlich ist, bleibt das so. Der gierige Moloch aber lauert auf dieser Seite der Grenze.
Was die Politiker nie verstehen oder auch nur zur Kenntnis nehmen: Das sogenannte mexikanische Drogenproblem ist nicht das mexikanische Drogenproblem, es ist das amerikanische Drogenproblem.
Ohne Käufer kein Geschäft.
Die Lösung liegt nicht in Mexiko.
Fängt man einen Boss wie Barrera, wird er durch einen neuen ersetzt. Fängt man den auch, kommt wieder ein anderer. Und so weiter.
Keller kümmert es nicht mehr“, behauptet Winslow auf Seite 33.
Es ist ja auch schon alles gesagt.
Wie soll man da bloß auf einen dicken Roman kommen?
Ganz einfach.
Wozu hat man denn die Figuren aus dem letzten Buch?
Man schickt sie wieder auf das Karussell.
Fliegt einer raus, steigt sofort der Nächste ein.
Egal, wie gestreckt die Geschichte dadurch wird.
Machen die mit den Drogen ja auch.
Wir müssen da durch.
Es gibt eine Marktlücke.
Der große Roman über den Drogenkrieg.
Teil Eins gibt es schon, jetzt noch einen drauf.
Das wird der Hammer.
Gut, dass die Filmrechte von Teil Eins nie verkauft wurden.
War auch nicht die richtige Zeit.
Steven Soderbergh mit seinem Film „Traffic“ von 2000 hat das Thema lange blockiert.
Außerdem hatten Fernsehen und Film vor zehn Jahren an so dicken Büchern gar kein Interesse.
Jetzt sind die neuen Programme und Nutzungen da.
Jetzt gibt es Hunger nach gefüllter Sendezeit.
Nach Miniserien.
Mit Schock & Tease.
Jetzt schlagen wir zu.
Wir haben ihn, den Hammer.
Den obergeilen Drogenstoff.
Da ist alles dabei.
Sex, Gewalt, Liebe.
Der ganze Scheiß.
Wie im alten Rom.
Was man an einem Autor bewundern muss, ist seine Beständigkeit.
Ich sag‘s doch.
(Tatsächlich ist Winslow dabei, zusammen mit Shane Salerno, der bereits das Drehbuch zu „Savages“ schrieb, einen zweiteiligen Film auf Vorlage von „Dog“ und „Cartel“ zu schreiben.)
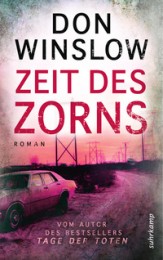 Ein komischer Heiliger, wahlweise ein Cowboy
Ein komischer Heiliger, wahlweise ein Cowboy
Hüpfen wir wieder ins Buch.
Keller ist aus dem Kloster verschwunden und untergetaucht.
„Er steht in seinem Motelzimmer und wartet.
Neben der Tür, an die Wand gepresst.
Er hört die Schritte auf der Treppe zum Obergeschoss und weiß jetzt, dass sie zu zweit kommen.“
Zeit genug für allerlei Betrachtungen, das Leben auf der Flucht und in Motelzimmern. Und dann der Satz:
„Er ist sein eigener Blues-Song geworden, ein Loser à la Tom Waits, ein komischer Heiliger à la Kerouac, ein Held des amerikanischen Highway à la Springsteen. Ein heimatloser, der von der Hand in den Mund lebt, ein Cowboy, dem die Prärie abhandengekommen ist und der trotzdem weiterreitet, weil er nichts anders kann als reiten …“ (Seite 81)
Ganz schöne Überdosis. Prognose: Literarisch underfucked und überklischiert. Aber es kommt noch besser. 300 Seiten weiter ist Keller:
„Don Quichote im Kampf gegen Windmühlenflügel. Ahab auf der Jagd nach dem weißen Wal. Allein mit meiner Besessenheit, wie ein Junkie, der an der Nadel hängt.
Mein privater Drogenkrieg, meine persönliche Sucht.“
Unbedingt neue Zeile, vor „Mein privater Drogenkrieg“, sonst fällt dieses kraftmeierische Soufflé zu schnell zusammen. So geht das dauernd, 830 Seiten lang. Niemand macht so viele Zeilenanfänge wie Don Winslow. Hier strickt einer mit ganz, ganz großen Maschen.
Das hat in einigen seiner Bücher, genau genommen eigentlich nur in „Savages“ („Zeit des Zorns“), ganz gut funktioniert. „Fickt euch“, lautete dementsprechend der Anfang. Fickt euch, das waren die einzigen beiden Worte auf der ersten Textseite. Es ging um zwei mittelkleine amerikanische Drogendealer, ihre vom Drogenkartell entführte Freundin, einen bösen Killer und eine attraktive Kartell-Chefin. Oliver Stone machte daraus einen ziemlich unterhaltsamen Film. (siehe CM hier)
Der Folgeroman, ein Prequel, begann mit „Leck mich am Arsch“, war 2012 bei Suhrkamp optisch aufgemotzt und hieß auch in der Übersetzung „Kings of Cool“. Geiler Titel, 305 „Kapitel“ auf 349 Seiten, manche nur drei Zeilen lang, schon etwas schwächere Geschichte, eben weil der so gern in der Gegenwart schreibende Winslow bei einem epischeren Ansatz wie es der Rückblick auf die kalifornische Drogenkultur der Hippiezeit erforderte, seine erzählerischen Atemprobleme bekommt. Dauernd Stoßatmung, dauernd Kraftmeierei, das sind viele Liegestütze auf der Erzählmatte. Aber Landschaft, Epos, Tiefe, Figuren, die einem nahe kommen und bei einem bleiben, gar auf längere Zeit oder immer, werden nicht unbedingt daraus.
Was soll man, ein winziges Beispiel, aus „Kings of Cool“ vom Anfang des Kapitels 140 halten:
„Ben geht zu Fuß nach Hause.
Wo Dennis Cain auf ihn wartet.“
Es folgt ein kleines Eifersuchtsdrama.
Erzählt per Salami-Feinschnitt.
Scheibchenweise.
Der Chef eines Tötungsprogramms
Jetzt mal Hardcore:
Die Welt wird immer grausamer.
Dauernd legt der Drogenkrieg einen Zacken zu.
Familien werden ermordet.
Alle Schranken fallen.
Auf allen Seiten.
Admiral Roberto Orduna, der „Kommandeur der FES, einer neuen Sondereinheit der mexikanischen Kriegsmarine, etwa zu vergleichen mit unseren Seals“, trägt eine neue Strategie vor, die angeblich beim Kampf gegen den Terror erfolgreich ist. Nämlich die Offensive, das Ausschalten der Anführer. Gezielte Tötungen seien das, wirft Keller ein. Ordunas Einheit sei unbestechlich. Gutes Salär. Und sie dürfen plündern. Anderthalb Jahre in einem Geheimcamp ausgebildet, dann in einem kolumbianischen Geheimcamp, wer das übersteht, kommt nach Arizona zum Lehrgang Terrorismusbekämpfung, inklusive die Anwendung „weicher“ und „harter“ Verhörtechniken. Eine schmutzige Truppe hat Orduna da geschaffen, denkt Keller, die einen schmutzigen Krieg führen soll, eine eigene Version der Zetas. Keine Budgetgrenzen, kein Kontrollgremium, kein Innen- und Justizministerium, „nur das Weiße Haus, das aber zu diesen Dingen nicht Stellung nehmen wird“. Es gibt eine Liste von 37 „Kernzielen“, Barrera ist die Nummer zwei. Keller wird der US-Verbindungsmann. Zitat:
„Was für ein Irrsinn, denkt Keller. Ich soll den Chef eines Tötungsprogramms spielen.
Wie Operation Phönix, damals in Vietnam.
Nur dass ich diesmal der Macher bin.“
„Ich kann mit dir machen, was ich will“
60 Seiten weiter und nach der Ermordung einer Polizistenfamilie durch die Zetas, macht Keller 300 kleine „Vampirzähne“ für eine „harte“ Verhörtechnik bereit, kleine Kokainspritzen. Keller ist jetzt „bei einer neuen Sondereinsatztruppe innerhalb der FES, von der selbst die mexikanische Kriegsmarine nichts weiß, zusammengesetzt aus den Besten der Besten. Sie nennen sich Matazetas und erhalten schwarze Kampfanzüge.
Ihr einziger Auftrag geht aus dem Namen hervor.
Matazetas – Zeta-Killer.
Keller ist von Anfang an dabei.
Operation eins: Aufspüren der Zetas, die an den Córdova-Morden beteiligt waren.“
Keller schnappt sich einen amerikanischen Dealer, fährt ihn nach Juarez, um ihm dort zu eröffnen, dass er keinerlei Rechte mehr hätte. „Wir sind hier in Mexiko und ich kann mit dir machen, was ich will, du Blödmann“, brüllt Keller ihn an. Seine FES-Kollegen, wenn er sie auf ihn loslässt, „häuten die bei lebendigem Leibe, und das meine ich nicht metaphorisch. Also nochmal zum Mitschreiben: Sie werden dich häuten.“
Dann haut ihm Keller die Vampirzähne rein, macht ihn high, bis er lallt und redet. Lässt ihn frei. Mit seinen Informationen schnappen die Matazetas einen Mexikaner, „nichts kann sie davon abhalten, zu machen, was sie wollen… Sie werden alles aus ihm herausholen, was er weiß, ihm dann, wenn er Glück hat, eine Kugel in den Kopf schießen und seine Leiche in der Wüste entsorgen.“
Wozu Literatur?
Danach fährt Keller zur der Frau, die er liebt, zu der Ärztin Marisol, um mit ihr Silvester zu feiern. Zwei Seiten weiter redet Keller mit Mexikanern über mexikanische Kultur und es kommt zu dieser Szene:
„Wir sprachen gerade über die traurigen Zustände in diesem Land“, sagt Herrera. „Aber was mich betrifft. Ich freue mich, unterbrochen zu werden. Sie sind Amerikaner, Señor Keller?“
„Ja. Aber nennen Sie mich Art.“
„Sie sprechen so gut Spanisch“, sagt Herrera. „Lesen Sie auch Spanisch?“
„Ja.“
„Wen lesen Sie?“
Keller zählt auf. Roberto Bolaño, Luis Urrea, Élmer Mendoza …
„Doktor Cisnernos!“, ruft Herrera. „Sie haben es geschafft. Sie haben einen zivilisierten Amerikaner gefunden. Setzen Sie sich, Arturo! Setzen Sie sich zu mir!“
Keller quetscht sich neben ihn. Sie reden über Die wilden Detektive, Kolibris Tochter und den Kriminalroman Silber, bis Herrera sich verabschiedet, um die Nacht der Jugend zu überlassen, wie er sagt.
Was da geredet wird, erfahren wir nicht. Es geht ja um Literatur, wir aber sind hier in der Actionhölle. Schon am Neujahrsnachmittag fährt Keller nach Nuevo Laredo, wo einer der Killer geortet wurde, lockt ihn in einen Hinterhalt und „verpasst ihm zwei Schüsse in die Brust“, stellt sich dann über ihn „und schießt ihm in den Hinterkopf, dann nimmt er einen Pikbuben aus der Tasche – die Visitenkarte der Matazetas – und legt ihn auf den Toten“.
Winslow schreibt einen Rache-Thriller. Sein Held ist ein Killer. Na prima.
Wozu also Rekurs auf irgendwelche mexikanische Literatur? Der 1949 geborene Élmer Mendoza zum Beispiel, der da an Silvester kurz gestreift wird und zu dem Winslow nichts einfällt, ist einer der Hauptfiguren der „narcoliteratura“, zwischen 1978 und 1995 veröffentlichte er fünf Bände mit Erzählungen, 1999 seinen ersten Roman, „Un asesino solitario“. Die mexikanische Kritik feierte ihn als den ersten Autor, „der den Einfluss der Drogenkultur wahrheitsgemäß widergibt“, das galt auch für die Bände Cada respiro que tomas“ (1992) und „Buenos muchachos“ (1995). Welchen Mendoza-Roman Keller da im April 2005 unter dem Arm trägt, lässt Winslow offen. Falls es „Efecto tequila“ von 2004 war, hätte es sich um einen Finalisten beim Premio Dashiell Hammett gehandelt. „Das pazifische Kartell“ (La prueba de ácido) von 2010, respektive Suhrkamp 2012, kann es nicht gewesen sein, auch nicht „Silber“. Aber egal.
Und dann kam das Spiegelei
…Vermutlich ist es doch einfacher, bei Munitionskalibern und Waffenbezeichnungen in Details zu gehen, anstatt aufs literarische Glatteis. Das gilt bei Winslow für literarische Formen an sich. Sein „Kartell“ ist auch deswegen ein ziemlich ernüchternder Plattfuß, weil der Roman nicht einmal im Ansatz Anschluss an die erzählerischen Niveaus findet, die in den mittel- und südamerikanischen Literaturen längst Standard sind. „Das Kartell“ ist sprachlich und erzählerisch plump und simpel. Eindimensional. Der immer gleiche Eintopf. Handlung im Präsens wechselt und verschränkt sich mit Faktenhuberei, mit nachgereichten Hintergrundinfos, ein wenig politischen Betrachtungen und Versuchen der Analyse von Zuständen und Entwicklungen. Ich blieb da lange gutwillig. Aber dann kam das Spiegelei.
La Tuna, Sinaloa, Februar 2010. Der Drogenboss Adán Barrera steht „in der Küche und bereitet sein Frühstück. Das gehört zu seinen kleinen Freuden – er liebt die morgendliche Stille und die einfachen Verrichtungen des Tischdeckens und Kaffeekochens.
Genügend Zeit zum Nachdenken, bevor ihn der Alltag mit seinen unablässigen Forderungen überfällt.
Er erhitzt etwas Rapsöl in der Pfanne und schlägt ein Ei hinein. Da er ein paar Pfunde zugelegt hat und sein letzter Labortest überhöhte Cholesterinwerte anzeigte, hat er seine morgendliche Ration von zwei Eiern auf eins reduziert. Während das Ei in der Pfanne brutzelt, denkt er über Gordo Contreras nach, den sogenannten Kopf des Golfkartells.“
Dann denkt er und denkt. Und denkt weiter. Und weiter. Nach vier Seiten geht er in den Garten und denkt weiter. Moment, das Ei? Beim ersten Lesen hatte ich tatsächlich übersehen, dass er das Ei nach einer halben Seite Nachdenken auf einen Teller gelegt, es vermutlich dann nebenbei gegessen hat. Rapsöl und all so Details unwichtig geworden, nur ein Vorwand, um Betrachtungen über mögliche Allianzen und Gegner und den Krieg der Kartelle anzustellen.
So ein Drogenboss hat es nicht leicht.
„Er geht zurück zum Haus.
Betrachtet seine junge Frau im Schlaf.
Seine frühere Geliebte Magda hat Recht.
Sie ist noch ein Kind.“
Harter Schnitt, Winslow schlägt wieder zu.
Mit einer Leerzeile.
Dann geht es weiter.
Und zwar so:
„Der Krieg zwischen dem Goldkartell und den Zetas ist extrem grausam – wie jeder Bürgerkrieg.
Und man kann dieses Gemetzel nur Krieg nennen.
Wo die Sicarios früher heimlich operierten, fahren jetzt offene Trucks mit Hunderten Bewaffneten durch den Norden der Golfprovinz Tamaulipas. In Nuevo Laredo, Reynoasa und Matamoros sprechen die Maschinengewehre und Granatwerfer, auch in den kleinen Städten entlang der Grenze zwischen Matamoros und Laredo.“
Darauf muss man erst mal kommen, auf solch eine Formulierung.
In Nuevo Laredo, Reynoasa und Matamoros sprechen die Maschinengewehre und Granatwerfer.
Wow.
So etwas stand bisher nur in Landser-Romanen.
Oder bei Tom Clancy, wenn er einen schlechten Tag hatte.
Geiler Shit, oder?
Fickt euch.
Sorry, das ist der Anfang aus dem anderen Winslow-Roman.
Gibt ja noch andere kurze Sätze.
Hier sprechen nicht nur Maschinengewehre und Granatwerfer.
Sondern der ganze Weißraum.
Andere brauchen da Seiten um Seiten.
Mit Worten.
I Paint it White.
 Verweis auf eine Abwesenheit
Verweis auf eine Abwesenheit
Etwas ausführlicher sind jene Roman-Teile, in denen Winslow einer Art zweitem Erzähler Platz gibt. Es ist der Journalist Pablo Mora aus Ciudad Juarez. Winslow – der nach eigenem Eingeständnis für die Recherchen NICHT in Mexiko war, was man bei seinen flachen Beschreibungen von Mexiko City auch spüren kann – versucht hier erkennbar, näher an eine Wirklichkeit zu kommen. Diese Passagen sind jedenfalls mehr „Roman“ als die Pulp-Actionwelt von Art Keller, im Vergleich aber etwa zu Charles Bowdens großem Buch über Ciudad Juarez, „Murder City“ (CM-Besprechung hier) bleiben sie Surrogat. Bowden hatte, als das große Töten in der damals tödlichsten Stadt der Welt begann, sieben Monate dort gelebt und sich bis an die Grenzen der eigenen geistigen Gesundheit ein eigens Bild dieser unfassbaren Realität zu machen versucht. Winslow kann ihm nicht ansatzweise das Wasser reichen, von mexikanischen Autoren ganz zu schweigen. (Siehe die Literaturhinweise zum Drogenkrieg in dieser CM-Ausgabe.)
Das Schlimmste aber, ich habe im „Kartell“ beinahe nichts geglaubt, dies, obwohl unbestreitbar die grimmigste Realität verhandelt wird. Das, obwohl Winslow Ereignisse schildert und uns nahe bringen will, die wir aus der Zeitungslektüre, aus dem Fernsehen, von Youtube und aus dem Internet kennen. Es gibt einen Entwurf für das amerikanische Cover von „The Cartel“, der eine Collage von Zeitungsartikeln zeigt. Das wäre gar nicht falsch gewesen. Die leere Schutzweste auf dem US-Cover zeigt aber auch etwas an – sie verweist auf die Abwesenheit von Menschen.
Die Sache mit dem Präsens
„Das Kartell“ hat ein ziemliches Formproblem. Das andauernde Präsens – andere Autoren wissen, warum sie es meiden – überschreibt fortwährend den Raum, eine Handlung überlagert die nächste, löscht sie aus, lässt keine Zeit zu Reflektion, Verdichtung, Schockmoment. Es gibt kein: „Soll ich – nein, ich kann nicht – aber warum? Nein! Das darf doch nicht sein!“
Das Erzählen im Präsens ist literaturgeschichtlich etwas relativ Neues, ein wenig mehr als 100 Jahre alt, findet sich zum Beispiel bei Arthur Schnitzler, war eine Form des nouveau roman, gab es auch bei Peter Weiss, Samuel Beckett, Robert Walser, Wolfgang Hildesheimer, Claude Simon oder Thomas Pynchon. Solche Präsensromane wählen meist die Ich-Form. Die dritte Person – in der auch Winslow schreibt – war lange eigentlich nur der Fabel vorbehalten. Aus gutem Grund. Denn das Präsens behauptet den Ausdruck von allgemein Gültigem. Es gibt und gilt nur das Hier und Jetzt. Das Präsens nimmt den Leser eng an die Hand, es wird oft zum Ausdruck von allgemein gültigen Sachverhalten gebraucht, es ist quasi eine Kommandoform, die dem Leser etwas vermitteln, etwas lehren sollen. Sie ist auch die Form von Parabeln und oft auch Anekdoten, verkündet im sogenannten Epimythion einer Fabel „die Moral von der Geschichte“ oder bildet Sätze, die der Leser unbedingt mitnehmen soll.
Der Mohn brennt.
Rote Blüten, rote Flammen.
Hieronymus Bosch malt den Drogenkrieg.“
Kapiert?
Luther und die Fabel
Dieses „Merke!“ freilich will dosiert sein. Winslow begibt sich dieses Effekts durch Overkill. Sein Merkheft-Stil nimmt einen wesentlichen Reiz des Lesens, nämlich den der eigenen Überlegung und Erschließung des Gehalts und der Intention. Die eigene gedankliche Arbeit, die Suche nach dem individuellen Wirklichkeitsbezug, wird vorweggenommen. Der Leser wird entmündigt. Man kann da nur folgen oder die Zehennägel krümmen. Schon Luther wusste in Bezug auf die Fabel:
„Alle Welt hasset die Wahrheit, wenn sie einen trifft. Darum haben weise hohe Leute die Fabeln erdichtet und lassen ein Tier mit dem anderen reden, als wollten sie sagen: Wohlan, es will niemand die Wahrheit hören noch leiden, und man kann doch der Wahrheit nicht entbehren, so wollen wir sie schmücken und unter einer lustigen Lügenfarbe und lieblichen Fabeln kleiden; und weil man sie nicht will hören aus Menschenmund, dass man sie doch höre aus Tier- und Bestienmund.“
Anstatt, dass Winslow auch nur in einer einzigen Zeile sich als Autor in die Schusslinie des mexikanischen Wahnsinns stellt, wie etwa Bowden das bis zum eingestandenen Verstummen in „Murder City“ tat, lässt er erfundene Figuren in einem Scherenschnitt-Theater auftreten, eifert einer Chronistenaufgabe nach, die er fast mechanisch erfüllt.
Vermutlich, weil er nichts davon kennt – oder eben weil der Präsensroman so etwas unmöglich macht –, lässt er dabei die spezifisch in Lateinamerika entwickelte literarische Form der „Crónicas“ völlig außeracht. Auch der von ihm läppisch als Name zitierte Roberto Bolaño sowie viele andere Schriftsteller südlich der US-amerikanischen Grenze haben es vorgemacht, wie man Geschichte erzählt. Wer Francesco Goldman und seine grandiose Chronik „The Interior Circuit: A Mexico City Chronicle“ liest, wird merken, wie wenig Ahnung Winslow von der Hauptstadt Mexikos hat.
Die Vergangenheit lässt sich erzählen …
Doch zurück zum Präsens. Sprache besitzt ein Tempussystem, sie stellt damit eine Chronologie her, eine erzählende Retrospektion und Vergegenwärtigung von Vergangenem, ohne die wir uns das Erzählen eigentlich nicht so richtig vorstellen können. Unseren Mustern von „Fiktion“ liegt ein Erzählen im Präteritum zugrunde. Walter Benjamin: „So kann ich davon träumen, wie ich einmal das Gehen lernte. Doch das hilft mir nichts. Nun kann ich gehen; gehen lernen nicht mehr.“
In einer Gegenwart, in der sowohl das Erleben wie sein Erzählen Raum haben sollen, bereitet die Integration der narrativen Ebenen gehörige Schwierigkeiten. Weil nicht gleichzeitig erlebt und erzählt werden kann, führt das zu Reibungen zwischen den fiktiven und faktischen Schichten des Erzählens. Erleben und Erzählen werden einander in paradoxer Weise gleichzeitig. Schlagen sich tot.
Die These des klassischen Romans lautet: „Die Vergangenheit lässt sich erzählen.“
Bis heute gibt es keine umfassende Theorie über den Zusammenhang von Fiktion, Narration und Tempus. „Das Kartell“ wäre für Literaturwissenschaftler eine Fundgrube von Problemen.
Das Präsens vereinfacht nicht nur den Gebrauch der Zeitformen, sondern das Erzählen an sich. Das reduziert auch die Komplexität des Erzählten.
Das Präsens macht es schwieriger, komplexe Charaktere zu entwickeln. Der Verzicht auf die Manipulation von Anordnung und Dauer durch „real time“ erschwert psychologische Tiefe und Realismus, verringert die Reibung mit anderen, insgesamt mit der Welt. Man denke an Jack Bauer. Ohne die Möglichkeit inhaltlicher Rückblenden tendieren Charaktere dazu, relativ simpel zu werden, ja sogar beliebig.
Das Präsens verringert den Suspense. Was wir mit ihm an Unmittelbarem gewinnen, verlieren wir an Spannung, sagt Ursula K. LeGuinn.
Alf Mayer
PS. Einmal, auf zwei Seiten, gibt es die von mir vermisste Poesie in „Das Kartell“. Es ist ein der Wirklichkeit entnommener Blogartikel, in der ein mutiger Blogger, der die Zustände in Ciudad Juarez schonungslos benannte das letzte Mal die Stimme erhebt und sich dann aufgibt, indem er am Ende seinen wahren Namen nennt. (Man könnte hier nochmal eine Betrachtung anstellen, wie seelenlos Winslow mit so etwas umgeht – und das war eine ihm wichtige Figur.) In dem Text „An alle ohne Stimme“ heißt es:
„Ich spreche für alle, die nicht sprechen können, für alle Sprachlosen. Ich erhebe die Stimme und winke mit den Armen und rufe alle, die ihr nicht seht, vielleicht nicht sehen könnt, die Unsichtbaren. Die Armen, die Ohnmächtigen, die Enteigneten; die Opfer des sogenannten Kriegs gegen die Drogen, die sechzigtausend, die von den Narcos ermordet wurden, von der Polizei, von der Armee, von der Regierung, von den Drogenkäufern und Waffenhändlern, von den Investoren, die ihr „neues Geld“ in Glitzertürme, Hotels, Wellness-Paradiese, Shopping-Malls und Wohnanlagen stecken.
Ich spreche für alle, die von den Narcos gefoltert, verbrannt, gehäutet wurden, von den Soldaten geprügelt und vergewaltigt, von der Polizei mit Elektroschocks und Waterboarding misshandelt.
Ich spreche für die zwanzigtausend Waisenkinder, für die Kinder, die Angehörige oder beide Eltern verloren haben, die fürs Leben gezeichnet sind.“
PPS. Übrigens sind die beiden äußerst informativen Drogenpolizisten-Romane von Charles Bowden in der dritten Person Präsens geschrieben. Don Winslow könnte ja dort schauen, wie das geht, mit dem Erzählen und Fakten auftischen und der Gegenwart: Down by the River (2002) und A Shadow in the City: Confessions of an Undercover Drug Warrior (2005).
PPPS. Hier einige Lesehinweise auf Literatur zum Thema. Allem voran als dringliche Empfehlung: Johann Hari: Chasing the Scream. The First And Last Days Of The War on Drugs. London/New Dehli/New York/Sydney: Bloomsbury Circus 2015. Mehr hier.
Ein Bibelzitat in Sachen Mexiko, und gar kein schlechtes, stellte Charles Bowden schon 1989 seiner Red Line voran, wo er auf der Suche nach den Hintergründen eines Mordes die Verflechtungen von amerikanisch-mexikanischen Drogeninteressen auffächerte. Das Zitat (Jesaja 1:7) lautete:
„Euer Land ist wüst, eure Städte sind mit Feuer verbrannt; Fremde verzehren eure Äcker vor euren Augen, und es verheert durch Fremde.“
Auch Don Winslow steigt mit einem Bibelzitate ein in Tage der Toten und Das Kartell.
Bowden beschäftigte sich jahrzehntelang mit der Grenze. Eines der wichtigsten Bücher über den Drogenkrieg ist: Charles Bowden: Murder City: Ciudad Juárez and the Global Economy’s New Killing Ground (2010). (Mehr bei CM hier). Weitere Bücher von ihm zum Thema:
Juárez: The Laboratory of our Future (1998, Vorwort Noam Chomsky)
Down by the River: Drugs, Money, Murder, and Family (2002, Recherche über einen Tod im Drogenmilieu)
A Shadow in the City: Confessions of an Undercover Drug Warrior (2005, das Scheitern des Kriegs gegen die Drogen)
Dreamland: The Way Out of Juarez (2010, mit Illustrationen von A.L. Briggs)
El Sicario. The Autobiography of a Mexican Assassin (2011, mit Molly Molloy)
dazu: El Sicario, Room 164 (Dokumentarfilm, Italien 2010, 80 min., Regie: Gianfranco Rosi)
Kent Harrington, dessen Mutter aus Guatemala stammt, hatte bereits 1997 einen DEA-Agenten, der in Dia de los Muertos auf eigene Rechnung im Grenzland, auch im moralischen, unterwegs war. James Crumley meinte über diesen Roman, dass nicht viele amerikanische Autoren es wagen, so tief in die Jahrmarktsspiegel der Grenzstädte zu schauen, in denen sich Gier, Böses, Tod und Politik reflektieren. Zu schade, dass Sam Peckinpah das nicht mehr verfilmen könne, meinte Michael Connelly. Harrington schreibe, als säße ihm der Geist von Jim Thompson auf der Schulter.
James Carlos Blake hat mit The House of Wolfe (2013) und The Rules of Wolfe (2015) zwei heutige „Border Noirs“ vorgelegt, in der eine große mexikanisch-amerikanische Familie in den die Gegenwart überschattenden Drogenkrieg gezogen wird, spezifisch die jüngere Generation. Blake, ein Literat der Grenze, der Prohibitions- wie vor allem der Gewaltgeschichte der USA, etwa in seinem fulminanten Roman Das Böse im Blut, beschäftigt sich schon lange mit Amexiko. Sein Epos Country of the Bad Wolfes geht dafür an das Ende des 19. und den Beginn des 20. Jahrhunderts. Die beiden leichtgewichtigeren, gleichwohl rabenschwarzen „Border Noirs“ handeln unter den Nachfahren der großen Familie Wolfe. Gewiss haben wir in Sachen Mexiko von Blake noch Großes zu erwarten. Er bleibt interessant. (Siehe CM hier).
Élmer Mendoza wird weiter oben im Text erwähnt.
Ausdrücklich hingewiesen sei auf das im Oktober 2015 bei Kunstmann erscheinende ¡Es reicht! Der Fall Mexiko: Warum wir eine neue globale Drogenpolitik brauchen, von Carmen Boullosa und Mike Wallace.
Carmen Boullosa ist einer bedeutendsten Schriftstellerinnen Mexikos, einiges von ihr ist übersetzt: Sie sind Kühe, wir sind Schweine; Der fremde Tod; Verfolgt; Die Wundertäterin.
Den Pulitzer-Preis gab es 2005 für The Devil’s Highway von Luis Albert Urrea, der in Tijuna geboren wurde, wie viele Mexikaner, die kritisch über ihre Heimat schreiben, mittlerweile in den Staaten lebt. Das einzige ins Deutsche übersetzte Buch ist Kolibris Tochter. 2010 gewann er einen Edgar in der Kategorie Beste Kurzgeschichte für seine Story Amapol.
Empfehlenswert sind diese Sachbücher:
Joan Grillo, El Narco;
George W. Grayson und Samuel Logan, The Executioner’s Men (das beste Buch über die frausamen Zetas)
George W. Grayson, Mexico: Narco Violence and a failed State?;
Anabel Hernandez, Narcoland: The Mexican Drug Lords and Their Godfathers;
Howard Campell, Drug War Zone;
Ed Vulliamy Amexica, War along the Borderline;
Malcolm Beith, The Last Narco;
Jerry Langton, Gangland: The Rise of the Mexican Drug Cartels;
Robert Andrew Powell, This Love Is Not For Cowards;
Ricardo C. Ainslie: The Fight To Save Juarez: Life In The Heart Of Mexico’s Drug War;
John Gibler, To Die In Mexico: Dispatches From Inside The Drug War;
Shaylih Muehlmann, When I Wear My Alligator Boots. Narco-Culture in the U.S. Mexico Borderlands;
Ryan Rashotte, Narco Cinema: Sex, Drugs and Banda Music in Mexico’s B-Filmography;
Elijah Wald, Narcocorrido: A Journey into the Music of Drugs, Guns, and Guerillas;
Gabriela Polit Duenas, Narrating Narcos: Culiacan and Medellin;
Hermann Herlinghaus, Narcoepics: A Global Aestehtics of Sobriety;
Alfredo Corchado, Midnight in Mexico: A Reporter’s Journey Through a Country’s Descent inti Darkness;
Paul Rexon Kan, Cartels at War;
Richard Grant, Bandit Roads: Into the Lawless Heart of Mexico.
Unbedingt auch: Blog Del Narco, Dying For The Truth. Mehr bei Youtube.
Und dann gibt es da noch den absolut sehenswerten Dokumentarfilm „Drogen: Amerikas längster Krieg“ von Eugen Jarecki (USA 2012), im Juni 2015 auf arte ausgestrahlt. Der Originaltitel trifft es besser: „The House I Live In.“ Der weiße Ostküsten-Filmemacher aus gutem Hause verfolgt das Schicksal der Familie seiner schwarzen Nanny, er beginnt mit der simplen Frage nach einem einzigen Schicksal – und fächert dann das ganze (von Winslow nicht ansatzweise behandelte) inner-US-amerikanische Drama des „War on Drugs“ auf. David Simon, der Schöpfer von „The Wire“ ist in diesem Film in großer Form. „Der Drogenkrieg ist ein Holocaust in Zeitlupe, ein Klassenkrieg“, sagt er unmissverständlich.
(Wiederholung auf arte am Dienstag, 02.07., um 20:15 Uhr, und am Dienstag, 09.07. um 2:15 Uhr.)
Don Winslow: Das Kartell (The Cartel) Roman. Dt. Von Chris Hirte. München: Droemer 2015. 832 Seiten. 16,99 Euro.
Alf Mayer











