Neuerscheinungen März 2015 (1)
 Buchcover der Milchwuchtordnung von Titus Meyer
Buchcover der Milchwuchtordnung von Titus Meyer
Pünktlich zur Messezeit sprudelt es:
Bei Reinecke & Voß drei Titel zur Lyrik wie folgt:
Bertram Reinecke [Hg.] "Mara Genschel Material", ein Band mit Außeinandersetzungen mit dem Werk der Dichterin von Luise Boege, Ann Cotten, Michael Gratz, Martrin Schüttler und Meinolf Reul.
Dazu enthält der Band einen Dokumentationsteil mit teilweise unveröffentlichten Arbeitsproben von Mara Genschel . Anvisierter Erscheinungstermin : 18. März.
Verlagstext: „Dieses Buch gibt einen Einblick in das Gattunsgrenzen hinterfragende Werk Mara Genschels. Zwar kennt und nutzt sie Verfahren der bildenden Kunst und der zeitgenössischen Musik. Dennoch wird dabei der Kernbereich der Literatur nicht verlassen. Ihr Werk kann darüber hinaus als ein Modellfall betrachtet werden, wie von Lesern mit ästhetischen Herausforderungen umgegangen wird. Verständnishürden, so erweist sich hier, müssen nicht unbedingt in der Struktur eines Artefaktes liegen. Hürden können auch durch die hergebrachten Gepflogenheiten unseres öffentlichen Umgangs damit erst erzeugt werden.“
Titus Meyer: "Meiner Buchstabeneuter Milchwuchtordnung". Anvisierter Erscheinungstermin : 18. März.
Verlagstext: „Titus Meyer hat sich in jahrelanger Übung eine Fertigkeit im Umgang mit Formen wie Palindrom, Anagramm und Homografie erarbeitet, die kaum einer, der solche rigiden Muster selbst erprobte, für möglich hält. Der Verfasser des längsten Palindroms, das in deutscher Sprache bekannt ist, wechselt mühelos Töne und Stillagen. Das hebt seine Arbeiten über das rein Spielerische hinaus. Ein absoluter Agnostizismus erweist sich dabei immer wieder als die Kehrseite strengster Buchstabengläubigkeit.“
Miron Białoszewski "Vom Eischlupf". Sechs Texte in synoptischen Nachdichtungen. Mit einem unveröffentlichten Brief des Dichters. Herausgegeben von Dagmara Kraus. Mit Nachdichtungen von Konstantin Ames, Kenah Cusanit, Peter Dietze, Christian Filips, Dirk Uwe Hansen, Angelika Janz, Jerzy Kaczmarek, Norbert Lange, Kerstin Preiwuß, Sophie Reyer, Tobias Roth, Monika Rinck, Bertram Reinecke, Schuldt, Ulf Stolterfoht und Przemek Zybowski.
„Ein großer Dichter des 20. Jahrhunderts, eine Entdeckung für das deutschsprachige Publikum.“ urteilt Anja Utler.
Der Band „Vom Eischlupf“ ist Teil eines größeren Projekts, das Dagmara Kraus als Übersetzerin und Herausgeberin im Jahre 2012 in Verlag Reinecke & Voß mit dem Band „Wir Seesterne“, der leider vergriffen ist, begann. Die Pflege des Dichters Miron Białoszewski wird demnächst mit einem Nachfolgeband zu diesem Buch fortgesetzt, der die hochgelobten Übersetzungen seiner Lyrik von Dagmara Kraus wieder zugänglich macht.
*
Brueterich Press nennt sich der neue Verlag von Ulf Solterfoht, in dem nun gleich fünf hochklassige Bücher zum Einstieg erscheinen sollen/erschienen sind:
BP 001: Hans Thill - Ratgeber für Zeugleute. Gedichte
BP 002: Franz Josef Czernin - Beginnt ein Staubkorn sich zu drehn. Ornamente, Metamorphosen und andere Versuche
BP 003: Cyrus Console - Brief Under Water. Gedichte
BP 004: Monika Rinck - KRITIK DER MOTORKRAFT. Etwa 60 Seiten über Automatik, Stillstand, Schaltung und Bewegung. Inklusive 12 Federzeichnungen der Autorin. Metempsychose Jaguar.
BP 005: Oswald Egger - Gnomen & Amben
Meinolf Reul hatte den Verlag bereits im Sommer 2014 auf dem hotlistblog vergestellt und dort gibt es u.a. Hinweise zu Brief Under Water von Cyrus Console. In der lyrikzeitung finden wir aktuell Leseproben, wobei Michael Gratz den Titel von Franz Josef Czernin verschluckt – der wohl nicht rechtzeitig zur Messe fertig geworden sein wird (sondern erst im April erscheint).
*
Neues auch bei kookbooks:
Monika Rinck: Risiko und Idiotie. Streitschriften.
Textauszug: „Fühlt sich die verständliche Sprache eigentlich herausgefordert, da es die poetische Sprache gibt? So wie sich die poetische Sprache herausgefordert sieht, von der Tristesse der Verwaltungssprache und dem Einerlei der Mediensprache und dieser Misere etwas entgegensetzen will. Etwas, das nicht mehr aufgeht in Information und nur unter Verlust von Schönheitssinn und Schuppenmosaik referierbar ist. Zeig Du den Vogelfuß der Versammlung von Knöchelchen und ich werde im Plenum dessen Vorzüge ansprechen. Ja, sicher, das ist das Mindeste, was ich tun kann, nach allem was geschehen ist. Man muss sagen, dass die Vorherrschaft der Information (vor allen anderen Qualitäten der Sprache) etwas auslöscht – und zwar die Möglichkeit des Nicht- oder Missverstehens oder Doch-Verstehens im Verlauf einer gegebenen Zeit, die dazugehört und in alle Stadien der Eigenheit und der Idiotie zu durchlaufen sind.“
Sonja vom Brocke: Venice singt. Gedichte
Flammarions Greyout
Stirn aushebeln, Gaumen quer, Brille putzen, und los
Die Reflexion etwa auf das Sprachmaterial von der poetischen Bewegung zu lösen, sie ins Verhältnis zu setzen, bedeutet, einen Teil ihrer Dynamik anzuwenden: Gehen und Bein, Hirn, Biegung zum Gehen, Bein, Bein. Der Text ist, vernommen, auf sich selbst zurückgespannt, im guten Fall reizbar, nicht domestiziert; was nicht heißen kann, dass er sich durchschaut ... und Imagination bleibt ebenso präsent wie meine empfindliche Achsel, doch ohne ein Genre auszustaffieren: Jeder Ansatz ist im Voraus überformt ... so verfährt man, wie die Klarheit es verlangt, rückt vor, spielend und materiell; steuert in Relationen, die Luzides generieren, Debris. Wie die Pfeile ins Öde gehen, triftig oder sediert. Die Nerven! Und der Schreck vor der Erstreckung bei gleichzeitiger Beschränktheit jetzt.
Sonja vom Brocke, geboren 1980 in Hagen, studierte Philosophie, Germanistik und Anglistik in Köln, Hamburg und Paris. Ihre Texte wurden in Zeitschriften und Anthologien veröffentlicht, unter anderem in Edit, STILL, Lichtungen, Meise, »Westfalen, sonst nichts?« und karawa.net, 2010 erschien »Ohne Tiere« (Verlag Heckler und Koch), 2011 »thoughts fall / ins Fell« (mit Christina Kramer). Sie war an Ausstellungen im In- und Ausland beteiligt. Sonja vom Brocke lebt in Berlin. »Venice singt« ist ihr erster Einzelband.
Dagmara Kraus: das vogelmot schlich mit geknickter schnute. Gedichte und Collagen.
"Fatrastische Fantasien" nennt Dagmara Kraus ihre neuen Texte, in Anlehnung an die "Unsinnspoesie", die sich im 13. Jahrhundert in Frankreich entwickelte. Ausgehend von der Lautschrift eines alten Französisch-Lehrbuchs, entstanden "falschösische" Collagen und in mehreren Trans-kriptionsschritten Umschriften in fatrastisches Deutsch. Dieser Band erscheint als bibliophiler Handdruck, gestaltet von Andreas Töpfer, in limitierter Auflage.
Daniel Falb. CEK. Gedichte
„Wenn Dichtung kein Spezialdiskurs ist, sondern der Ort der Rücknahme aller Ausdifferenzierung in der Sprache, und wenn aber die Sphäre der Ausdifferenzierung unweigerlich die ganze Erde in der Geschichte ihrer Sprachen ist, dann ist der Ort die Positionalität der Dichtung genau das Stehen vor dem Ganzen der Erde. CEK entfaltet eine Terrapoetik, die das Parlament im Herzen der Dinge, des Erdsystems, der großen biogeochemischen Zyklen und der ineinander geschachtelten Ökosysteme aufsucht. CEK lokalisiert seine politische L art pour l art, sein exzessives Ordnen und unablässiges ökologisches Abzählen unmittelbar in den hyperperformativen Sprachen und Erdcodes nach dem Ende der Umwelt.“ Daniel Falb
*
Neuerscheinungen auch bei luxbooks:
Kenneth Koch: Frischluft. Ausgewählte Gedichte. Übersetzt von Tom Schulz, Marcus Roloff und Christian Lux.
Kenneth Koch galt als charismatischer Clown der New York School, jener Gruppe von Dichtern, die sich Anfang der 50er Jahre in New York um John Ashbery und Frank O'Hara zusammenfanden und enge Kontakte mit den Malern der pulsierenden New Yorker Kunstszene pflegten. Kochs Gedichte sind voll sprühendem Witz, teilweise verschroben lüstern, bisweilen surrealistisch verspielt, mit einem Wort: diese Gedichte haben Wucht. Koch, Ashbery und O'Hara waren angetreten, die erstarrte und akademisierte Lyrik der Jahrhundertmitte aufzuwirbeln und Frischluft durch die verstaubten Zeilen ihrer Zeitgenossen zu pusten. Anders als die Beat-Dichter war die New York School jedoch nie esoterisch, nie offen politisch, nie simpel anarchisch. Ihr Einfluss auf die heutige amerikanische Dichtung ist weitaus größer als die anderer Richtungen der Jahrhundertmitte. Ende der 70er Jahre erschien in Deutschland eine Auswahl aus dem Werk Kenneth Kochs von Nicolas Born im Rowohlt Verlag. Jetzt haben Marcus Roloff, Tom Schulz und Christian Lux eine umfangreiche Auswahl aus dem Gesamtwerk Kochs erstellt und neu übersetzt.
Volker Sielaff: Glossar des Prinzen. Gedichte.
Der Bogen ist weit gespannt: eine große formale und thematische Vielfalt trägt die Gedichte des neuen Bandes von Volker Sielaff. Landschaften und Orte, philosophische Zahlengedichte, Liebesgedichte und surrealistische Imaginationen - ein großer Raum poetischer Möglichkeiten wird hier durchschritten. Phantasiefiguren und Realien treffen im »Glossar des Prinzen« aufeinander. Sielaff versichert sich zwar der Tradition, geht jedoch auch eigensinnig ins Offene, stets der eigenen Tonspur folgend. Seine Leser werden den Sielaff-Ton durchhören und viel Neues entdecken. 100% verwunschen und 100% genau sind diese Gedichte, und auch das Alltägliche kann bei diesem Dichter surreal sein.
*
Neues in der edition azur:
Klaus Johannes Thies: Unsichtbare Übungen. 123 Phantasien
Tag für Tag. Jahr für Jahr. Seit Mitte der 1980er schreibt Klaus Johannes Thies an der perfekten Geschichte. Eine Seite, mehr nicht. Eine Seite voller Sätze, die sich so selbstverständlich zu einem Ganzen fügen wie die Bilder eines surrealen Traums. Eine
Seite, die mehr Überraschungen enthält als die meisten 600-Seiten-Romane. Von Robert Walser führt ein schmaler Pfad zu Werder Bremen und von dort zu Frau Erdmann in ihren ultramarinblauen Pumps. Weil es genau so sein muss. Leichtfüßig und elegant kommen diese Phantasien daher. Und da sie sich an einer unstillbaren Sehnsucht entzünden, sind sie natürlich zutiefst melancholisch.
»Unsichtbare Übungen« bietet die Gelegenheit, einen Autor (neu) zu entdecken, dessen Kürzestprosa zum Besten gehört, was in diesem Genre geschrieben wurde. Wer im Regal noch Platz neben Daniil Charms, Peter Altenberg, István Örkény oder Helmut Heißenbüttel hat, sollte ihn jetzt angemessen füllen: mit den Phantasien von Klaus Johannes Thies.
Ulrich Koch: Ich im Bus im Bauch des Wals. Gedichte
Stoßseufzer in Zweckbauten. Kniefälle vor nichts. Selbstgespräche mit der Welt. Welche Form Ulrich Kochs Gedichte auch annehmen – immer sind sie auf verstörende Weise schön. Und auf die schönste denkbare Weise verstörend: »Jeden Morgen wäscht sie ihre Haare, / als ertränke sie eine Katze « heißt es dann, oder » Auf den Handrücken pulsen / die über Putz verlegten / blauen Adern«.
Unter dem leeren Himmel der Lüneburger Heide schreibt dieser » freundliche Misanthrop« (Martin Brinkmann) an seiner Poetik der alltäglichen Ungeheuerlichkeiten. An Gedichten, die ahnen lassen, warum uns eine flüchtige Erinnerung oder ein vor Jahren bedenkenlos hingeworfener Satz für immer verändern kann.
Katja Thomas: Gehen mit Lou. Ein Journal
Das Meer ist nicht hier. Und doch erhebt sich die Alb wie eine Welle im Gegenlicht. Das Ich in Katja Thomas’ »Gehen mit Lou« versetzt die Landschaften, die es durchquert, in einen flirrenden Zustand. Manchmal gibt es ein Wir: eine kleine Gruppe von Menschen, die Gemeinsamkeit mit einem Tier. Eine Ankunft. Dann lösen sich die Formationen wieder, Grenzen verschieben sich. Das Ich bleibt zurück und in ihm, ein Raum im Raum, allenfalls noch der Wille zur Weltanverwandlung. Doch auch ihn muss das Ich sich erst zurückerobern, vielleicht wie ein Radar, der nach langem Defekt wieder beginnt, die Umgebung abzutasten.
»Die offene Stelle der Wohnung, der schmale, gelb gekachelte Streifen an meinem Augenrand, erinnert mich an das Ungeheuerliche: dass ich niemals je Schutz erlangen kann.« Es sind feine, kaum sichtbare Risse, denen Katja Thomas nachspürt, und aus denen jenes Licht und jene Leichtigkeit hervorleuchtet, die nur die literarische Wahrnehmung zu erschaffen vermag.
*
Neuerscheinungen der edition korrespondenzen:
Martin Kubaczek: Nebeneffekte. Gedichte
Erst ist es nur ein winziger schwarzer Punkt unter dem Schulterblatt, ein Muttermal, das entfernt wird. Dann kommt der Schock, die Diagnose: Krebs. Von einem Tag auf den anderen stülpt sich das Leben um, wird der Erkrankte Teil der Spitalswelt, versteht erst nicht, wie ihm geschieht und was es heißt, an Leib und Leben bedroht zu sein. In der ungewöhnlichen Form einer Abfolge konziser Bilder erzählt Martin Kubaczek von den Tiefen und Höhen während seiner Krebserkrankung. Er lässt uns teilhaben an den Nöten und Glücksmomenten des Patienten, an seiner Suche nach einem möglichen »Ja im Nein«. Dabei wird auch das Komische und Absurde im Umgang mit der ernsten Situation offengelegt, etwa wenn Freunde aus Hilflosigkeit einen Katalog gut gemeinter Ratschläge vorbringen oder Patienten sich streiten, wer denn nun von ihnen am schlimmsten erkrankt sei.
Knapp und einfühlsam, nie aber sentimental führt Nebeneffekte durch die verschiedenen Gefühlslagen einer akuten Lebensgefährdung. Die Gedichte zeigen, was Angst auslöst, wie schnell Mitleid oder Distanziertheit an die Stelle des Sich-Einlassens tritt und wie schwierig es ist, der Krankheit als existenzieller Krise zu begegnen.
Marko Pogačar: Schwarzes Land. Aus dem Kroatischen von Alida Bremer
»Marko Pogačar ist ein Wunder. Es ist nicht völlig klar, wer er ist, wer ihn ersonnen hat und warum, es ist nur offensichtlich, dass er da ist, unabkömmlich«, schreibt Tomaž Šalamun über den jungen Dichterkollegen, der vielen als »Rimbaud der kroatischen Poesie« gilt. Mit bisher vier veröffentlichten Gedichtbänden wurde Pogačar binnen kürzester Zeit zur Schlüsselfigur der neuen Lyrikszene Südosteuropas.
Sein jüngster Band Schwarzes Land ist eine sinnliche und zugleich geistreiche Auseinandersetzung mit den Bedingungen, unter denen der Mensch Freiheit gewinnt. Geschichte, so zeigt Pogačar, ist die Aufgabe jedes Einzelnen, eine intime Sache, um die man kämpfen muss – sie ist der »Raum unter den Fingernägeln«. Aus Motiven der Nacht, des Feuers, des Windes, des Rauchs, des Teers flicht Marko Pogačar ein düster funkelndes Labyrinth der Gegenwart.
»Expeditionen in ein absolutes und radikales Neuland der Metaphern. Eine glühend-obsessive Neuvermessung aller Welt-, Kultur- und Alltagsdinge reißt uns mit: Pathos und Groteske, strömende Kontingenz, schwarze Sirenentöne. So in der Art, denke ich mir, war der Modernitätsschock, der von Hölderlin ausging, von Novalis oder Kleist.« (Andreas Nentwich, Börsenblatt des Deutschen Buchhandels)
E.A. Richter: Der zarte Leib. Gedichte.
Ein Triptychon über die vielfältigen Verflechtungen von Körper und Zeit legt E. A. Richter mit seinem neuen Band Der zarte Leib vor. Von der unmittelbaren Wirksamkeit der Zeit, die Pulsschlag um Pulsschlag am Leib arbeitet, sprechen die Gedichte der beiden rahmenden Teile. Auch umspielen sie in Erinnerungen die Kindheitsmöglichkeiten des Leibes, dann wieder folgen sie der Sehnsucht nach dem anderen Leib, nach Frauen, wie sie aus Kunstwerken nahezukommen scheinen und sich zugleich entziehen.
Der mittlere Teil steht im Zeichen des Streits. Die Krise eines Ehepaars und Konflikte aus aller Welt überkreuzen sich. In der individuellen Tragödie, in der Kampfzone zwischen Schlafzimmer und Küche, finden die politischen Konflikte ihre Entsprechung. Die Kriegssprache aus den Nachrichten schwappt in die privaten Verhältnisse über und radikalisiert die Situation.
Fundwörter wie »Astmasse« oder »Touristenschutzzäune«, aber auch Zitate aus Zeitungen und Briefen durchziehen den ganzen Gedichtband. Sie schreiben sich ein wie die abnehmende Zeit in die Geschmeidigkeit, Verletzlichkeit und Hinfälligkeit des Leibes.
Ein Gedichtband voller Wucht und Zärtlichkeit.
*
Ebenfalls ein Schwung Neuheiten im Verlagshaus J. Frank:
Swantje Lichtenstein: Kommentararten. Gedichte.
Kommentar heißt das, was ins Gedächtnis gerufen wird. Über die Jahrhunderte haben sich die Kommentarbücher sämtliche Freiheiten von Referenz- und Bedeutungsebenen erlaubt. Swantje Lichtenstein bietet einen Kommentar vor dem Text an, einen Kommentartext nach den Texten, einen Kommentar als post-elektrische Poesie, der wiederum andere Texte sich einverleibt, sich rückversichert, vorausschaut.
In ihrem neuen Band versammelt Swantje Lichtenstein in einem dichtem und heiterem Sprachfluss Möglichkeiten und Begriffe, um sich der Sprache zu versichern – jener Grundlage, auf die wir unsere Existenz bauen: Lichtenstein bietet immer wieder neue Kommentararten an, bis sich eine neue Bedeutung der Sprach einstellt. Ihre Aufmerksamkeit gilt den Lücken in und zwischen den Wiederholungen. So erscheint am Ende der Lektüre nicht nur ihre, sondern auch die Sprache der Lesenden klarer und weniger selbstverständlich.
Jan Kuhlbrodt: Kaiseralbum. Gedichte.
In Jan Kuhlbrodts »Kaiseralbum« scheint alles gesagt: durch Tiere. Denn es sind Tiere, die den Text füllen. Mit einem Augenzwinkern macht Kuhlbrodt sich auf die Suche nach dem Paradies auf Erden, nach dem Ursprung – auch die Arche kommt vor. Und doch ist das Album anarchisch: Es folgt den Reisen Friedrichs II., des mittelalterlichen Kaisers, der keine Burg besaß und stattdessen mit einem Hofstaat an Tieren durch die Lande zog.
Kuhlbrodt begleitet diesen Monarchen, der bewiesen hat, dass das Leben unter Tieren nicht durch den Verlust von Komplexität erkauft wird, sondern einen Gewinn an Hinwendung bedeutet – wenn man ihrer Bewegung nur folgt. Und die ist mal melancholisch, mal leicht, immer angetrieben von etwas, das in der Freude und im Durcheinander der Tiere zu liegen scheint. Und das sich schließlich von einer Reise mit Tieren zur Rückkehr des politischen Liedes wandelt: Geist und Witz sind sich nie in besserer Gesellschaft begegnet.
Udo Grashoff: Schiefe Menhire. Gedichte.
Die Menhire am Ostrand des Harzes stehen im Acker, die Bauern pflügen um sie herum. Sie sind zu schwer, um für immer zu verschwinden. Die Menhire stehen mitten in den Familien, oder was davon übrig ist. Sei es das Erschrecken über den schönen Tod eines Fuchses oder die Unmöglichkeit, Nähe herzustellen gerade dort, wo man sie am meisten vermisst – Symbolisches und Konkretes, Traum und Biographie, Geschichte und Erinnerung sind so eng verzahnt, dass man die Abgründe nur in den Ritzen erkennt – dafür reichen sie um so tiefer.
Die Menhire stehen schief, die Motten im Licht bei Nacht sind eine Dusche, im Standby blinkt etwas und – im Osten geht die Sonne auf. Udo Grashoffs Gedichte lassen einen rastlos darüber wandern und am Ende des Bandes ist man lange nicht am Ende angekommen, nur auf der letzten Seite.
Max Czollek: Jubeljahre. Gedichte.
Max Czollek versammelt in »Jubeljahre« Gedichte, die sich einen Weg durch die Doppelbödigkeit der deutschen Sprache bahnen. Das Ohr am Waldboden der Worte, lauscht Czollek Störgeräuschen – dem Sinuston der Geschichte, der unser Sprechen konstant und dennoch unbemerkt begleitet. Czollek stellt seine Sprache unter Verdacht: Ist 19:45 bloß eine Uhrzeit? Sind Parkbänke für jeden gleichermaßen besetzt? Sind die GASAG-Platten auf dem Bürgersteig eigentlich Stolpersteine?
Gerade weil er sich jener Verschränkung von Sprechabsicht und sedimentierter Gewalt nicht verweigert, erreicht Czollek eine ganz eigene Freiheit im Schreiben, die letztlich von möglichen Auswegen handelt. Czollek findet sie in verschütteten Traditionen, in der Aneignung religiöser Mythen, in der Unterwanderung der Leser_innenschaft. Es ist ein Aufbruch, der hier gelingt: Die Möglichkeit des Sprechens.
*
Neues im poetenladen:
Thilo Krause: Um die Dinge ganz zu lassen. Gedichte
In der Auseinandersetzung mit dem eigenen Woher und Wohin schafft Thilo Krause in seinem zweiten Gedichtband ein Album von Personen, Orten und Zeiten über Ländergrenzen hinweg. Scheinbar nebensächliche Alltagsbeobachtungen öffnen poetische Räume philosophischer Dimension, wobei die Mannigfaltigkeit der Bezüge von Bashō über Wallace Stevens bis Seamus Heaney selbstverständlich mitschwingt.
»Es sind Schlaglichter mit Tiefenperspektive, aber ohne Tremolo. Schlicht gesagt: Krauses Gedichte sind umwerfend schön und bestechend klug. Sie erzählen von den grossen Fragen, während sie aufs Kleine schauen«, so die Literaturkommission Zürich, die den Autor für das Manuskript mit einem Werkjahr auszeichnete.
Marie T. Martin: Woher nehmen Sie die Frechheit, meine Handtasche zu öffnen? Kleine Prosa
Welch spannende Vielfalt die kleine Prosa bietet, zeigt dieses Buch von Marie T. Martin. In phantastischen Momentaufnahmen und pointierten Geschichten en miniature geht sie den alltäglichen Schrecken und Wundern des Lebens nach. Es gibt poetische, groteske, verblüffende und vor allem fantasiereiche Texte und Zyklen, zu denen Ulrike Steinke Illustrationen beigesteuert hat.
Wir begegnen einer Frau, die im Schrank wohnt, erleben eine Familiengeschichte anhand von Kleidungsstücken und einen Mann, der sich in einen Fisch verwandelt. Ein Kind, dessen Haut sich bei Strafen dunkel verfärbt, schwimmende Restaurants und ein Mädchen, das sich auflöst, wenn man genau hinsieht.


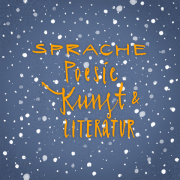
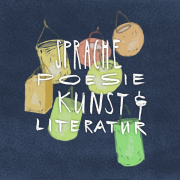
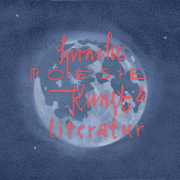
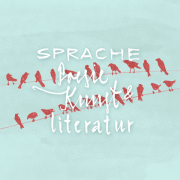
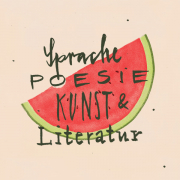
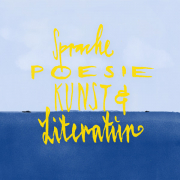
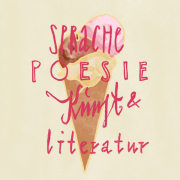

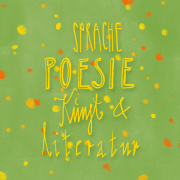
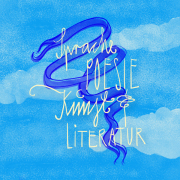
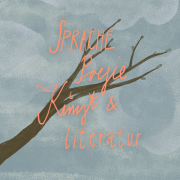
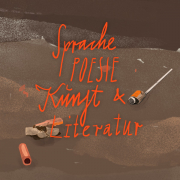
Neuen Kommentar schreiben