175mal Lyrikkritik plus Anmerkungen
 Lyrik ins Rollen bringen? Collage: Frank Milautzcki (2008)
Lyrik ins Rollen bringen? Collage: Frank Milautzcki (2008)
Zum Jahresende etwas Statistik:
Über 500 Rezensionen sind im Jahr 2018 bei fixpoetry erschienen, davon ca. die Hälfte zu Büchern aus unabhängigen Verlagen stammend.
In Sachen Lyrikkritik gestaltet sich das Resumée folgendermaßen: Stand heute (26.12.) sind es 175 Rezensionen und die Zahl bewegt sich damit etwas über dem langjährigen durchschnittlichen Mittel von 165 Rezensionen p.a. – ermittelt aus folgenden Werten:
2013: 130
2014: 160
2015: 170
2016: 150
2017: 200
2018 : 175
Dies als Marginalie zu einem Diskurs, den dereinst Tristan Marquardt mit beispielsweise folgender Behauptung losgetreten hat: „Während in den Feuilletons in der Regel fehlender Sachverstand und/oder fehlendes Interesse vorherrschen, leidet die Lyrikkritik im Internet auf der einen Seite unter mangelnder journalistischer Kompetenz und auf der anderen unter einer zu großen Nähe von Kritiker*innen und Kritisierten.“ Es gibt nach seiner Meinung nicht nur zu wenig Lyrikkritik, sondern auch keine ebenbürtige.
Christian Metz hat hier durch seine literaturwissenschaftlichen Arbeiten (u.a. hier und hier) der letzten Zeit für einigermaßen klarere Einordnungen solcher Thesen gesorgt: „Dabei führt Marquardt bemerkenswerte Maßstäbe für die Lyrikkritik ein. Gemessen wird sie nämlich nicht an ihren Funktionen gegenüber ihren Lesern, sondern an ihrem Gegenstand. Zwar sei die Zahl der Rezensionen zuletzt gestiegen, so heißt es direkt im Anschluss, aber für die Lyrikkritik gelte: „Aktuell kann sie weder quantitativ noch qualitativ mit der Lyrikproduktion mithalten.“ Die Lyrikkritik hinkt der Lyrik hinterher.“
Beachtliche Marquardtsche Kernaussage nebenher: die Lyrikkritik habe nicht dem lesenden Publikum anzudienen, sondern dem Autor und seinem Text (sofern „die Lyrik“ ein Produkt aus beidem darstellt).
Meine These ist eine etwas andere: die Lyrikkritik kann, wenn überhaupt, immer nur ein Reisebericht sein, der über eine Wegstrecke Auskunft gibt, auf der sich der Rezensierende einem Text ausliefert (oder auch nicht). Die literaturwissenschaftliche Einordnung eines Buches, einer Lyrik, einer Poetologie leistet nicht der Rezensent, sondern – der Name sagt‘s - die Literaturwissenschaft. Teile davon können bereits in einer Rezension auftauchen, aber es ist nicht ihr Ziel einen Gedichtband literaturwissenschaftlich einzuordnen, um ihn dann „mit oder ohne Prädikat“ an den Leser weiterzureichen, sondern die Begegnung Rezensent / Buch ist immer einzigartig und soll im besten Fall ein Kunstwerk eigenen Rechts hervorbringen.
Also von wegen LeserIn, von wegen AutorIn – der /die Rezensierende ist die Hauptperson in dieser Begegnung – und wäre es anders, wäre ein Buch dafür geschrieben, dazu ausgerechnet, daß die Rezensierenden oder das Publikum auf eine irgendwie verpflichtende Art und Weise auf es zu reagieren haben – dann wäre das Buch falsch geschrieben. Das rezensierende Personal hat das Recht auf eine komplett eigene Herangehensweise und eine komplett eigene Meinung – aber die Verpflichtung genau das transparent darzustellen. Schon aus dieser Konstellation ergibt sich ein weiterer dann gültiger Satz: Keinesfalls gibt es einen „Urteilsspruch und damit zu den Akten“.
Frank Milautzcki, 26.12.2018

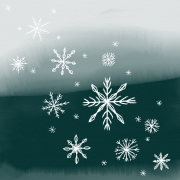


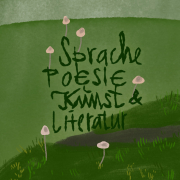
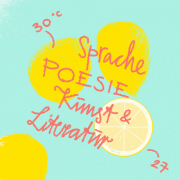
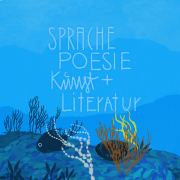
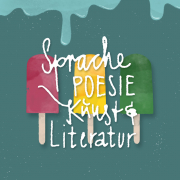
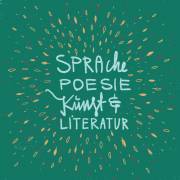
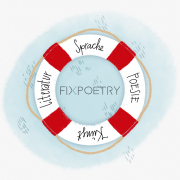
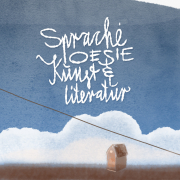
Neuen Kommentar schreiben