Austrian Beat

Austrian Beat - Hrsg. Elias Schneitter & Helmuth Schönauer in der edition baes.
In dieser Anthologie sind Beiträge von 27 österreichischen Autorinnen und Autoren vereint, die alle mit dem "Beat" in Verbindung stehen: Joe Berger, Wolfgang Bauer, ruth weiss, Günther Eichberger, Judit Pouget, Tom Antonic, Dieter Sperl, Thomas Frechberger, Wolfgang A. Eigensinn, Waltraud Haas, Thomas Northoff, Winfried Gindl, Helmuth Schönauer, Richard Wall, Stephan Eibel, Heinz D. Heisl, Robert Prosser, Bernhard Widder, Christian Loidl, Peter Prieler, Stefan Schmitzer, Martin Kolozs, Günther Geiger, Stephan Alfare, Isabella Breier, Rudolf Lasselsberger, Rudolf Krieger.
Helmuth Schönauer schreibt:
Rom, Blicke
Ein Leben lang tragen wir Beatniks die Sterbeformel von Rolf Dieter Brinkmann durch den Rest unseres Lebens: Er betrat die Straße, aber kam nie drüben an!
Dieser Tage ist die hoffentlich bald weltberühmte Anthologie Austrian Beat erschienen, worin 27 österreichische Autorinnen und Autoren versammelt sind, die mit dem Beat zu tun haben. In den Textbeiträgen schlägt auch immer wieder die Beschwörungsformel durch: Warum ich Beatnik geworden und geblieben bin!
Ein Schlüssel-Buch für diese Auseinandersetzung ist beim einen oder anderen dieses gigantische Rom, Blicke aus dem Jahr 1979 geworden, worin Brinkmanns Aufzeichnungen und Arbeiten während des Stipendiums an der Villa Massimo in Rom verarbeitet sind.
Das Buch hat vielen von uns das Konzept des Scheißfadens vermittelt. Dabei schreibt der Dichter lebenslänglich, wie andere lebenslänglich verdauen. Das Schreiben ist eine Art Verdauungsvorgang, und das Wort Stoffwechsel kommt in der Materialiensammlung mehrfach vor.
Die Reaktionen auf diese Vorgangsweise sind verschieden, norbert c. kaser etwa hat diese &-Zeichen von Brinkmann übernommen. Alle, die mit der Peripherie zu tun haben, sind früher oder später durch Brinkmann ermuntert worden, aus dem offiziösen Literaturbetrieb auszusteigen und den eigenen Scheißfaden zu entwickeln.
Mit der Zeit ist dieses Buch die Ur-Bibel der Austro-Beatniks geworden, mein Exemplar ist wegen des schlechten Leims und des glatten Papiers für die Fotos schon ziemlich aus dem Leim und aus dem Foto gegangen. Nur weil ich Bibliothekar bin und mit Inkunabeln, Vignetten und dergleichen umgehen kann, darf ich mir zwischen durch einen Blick in Rom, Blicke leisten, bei jedem anderen würde das Buch schon zu Staub zerfallen.
Tatsächlich sind die meisten Beatnik jetzt in einem Alter, wo ihnen die Bücher aus der Jugend noch zu Lebzeiten zerfallen. Als idealer Jahrgang gilt für einen Beatnik das Stalin-Jahr 1953, weil sich in diesem Jahr wie beim Abgang eines Gottes jeder als göttlicher Nachfolger von etwas Verschwundenem identifizieren kann.
Und wenn man die von Stalin verfolgte Literatur etwa Andrej Platonows liest, merkt man den Beat pur: Kaputte Natur, Dampf, Schweiß, Scheiße, Peripherie, on the Rail.
Rom, Blicke ist als Verdauungs-Collage aufgebaut, der Villa-Massimo-Stipendiat frisst oben permanent den Schreib-Alltag hinein, und unten kommt die Literatur heraus. Die muss nur noch abgepackt und portioniert werden.
Was das Lesen so wild und sperrig macht, ist dieses geklebte und gepresste Layout, das an einen Verdauungsvorgang erinnert, der noch nicht fertig ist. Das Fehlen von Handy, Selfie, Blog und Tweed lässt den Text stählern und fest erscheinen, während er in Wirklichkeit damals als Blog, Tweed oder Mail entwickelt worden ist. Das Leseauge lässt sich nicht zurückdrehen, wir denken die inzwischen entstandenen Medien mit und begreifen dadurch, wie viel in diesem Materialien-Band an Sozialmedia schon vorweggenommen ist.
Je nach hormoneller Verfassung liest man aus dem Konvolut diverse Scheißfäden heraus. Einmal geht es um die Fernbeziehung einer Liebe, die umständlich mit Zugfahrten, Zwischenurlauben und Stehtelefonaten aufrecht erhalten werden muss.
Dann geht es um den Literaturbetrieb, der sich im Herum-Schaseln in der Literaturvilla zeigt und als provinzieller Antipoden in Graz, das damals zur Hauptstadt der Provinzdichtung aufgerückt ist.
Ein wesentliches Element ist das On the Road by Train, das durchaus in eine Interrail-Literatur führt. Die Städte werden nicht von vorne mit der Ansichtskarte in der Hand betreten sondern von hinten mit dem Zugticket, das eine Anreise durch Müll, Hinterhöfe und Vollscheiße ermöglicht.
Schließlich dient der Materialien-Band dem Autor als Vorstufe für eine Literatur, die er vielleicht in nächster Zeit bewerkstelligen muss. Allmählich setzt sich aber die Erkenntnis durch, dass Literatur genau dieser Scheißfaden ist, der nicht mehr in Gedichte, Hörspiele oder Lesungsauftritte verpackt werden muss.
Diese Elemente leiten Autorinnen und Autoren, die in Österreich eine Beatnik-Literatur etablieren. Dabei ist das Wort Beatnik eine keusche Würdigung an den Sputnik, der von den Sowjets ins All geschossen wird wie ein Dichter oder später bei Bowie der gute Major Tom.
Von der Wiener Gruppe haben wir alle gelernt, dass eine Diskussion über disparate und klandestine Literatur nur funktioniert, wenn man einen Kunstbegriff installiert. So sind ja die Einzelgänger der Wiener Gruppe erst durch die Diskussion als Wiener Gruppe miteinander bekannt gemacht worden.
Etwas ähnliches könnte beim Austrian Beat funktionieren. Germanistisch abgeschirmt durch Rolf Dieter Brinkmann kommen die Geschlagenen, Verhöhnten, Verfolgten und Ausgestoßenen des Literaturbetriebs in jenen Zustand des Selbstbewusstseins von dem es pathetisch ernüchternd heißt: Die Rente des Beatniks ist der Tod!

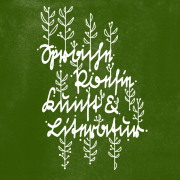


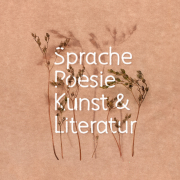

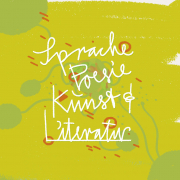
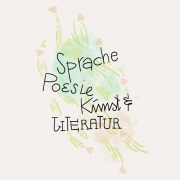
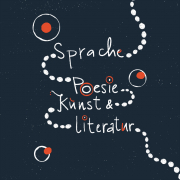

Neuen Kommentar schreiben