Desenga giert!
 Mit Beginn der 1950er Jahre traten die konkrete und visuelle Poesie sowie die Lautdichtung und das experimentelle Hörspiel vor allem in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich in Erscheinung. Bis heute werden diese literarischen Formen meist als bloße Sprachspielerei betrachtet, die den Autoren eine politische Stellungnahme zur Realität ersparten. Schon in den 1960er Jahren galten experimentelle Schreibweisen im Zuge einer einseitigen Rezeption des Sartre’schen Begriffs der „littérature engagée“ als „desengagiert“. Dennoch beriefen sich damals Autoren wie Eugen Gomringer, Helmut Heißenbüttel, Franz Mon, Max Bense, Reinhard Döhl oder Ernst Jandl auf die politische Tragweite ihrer Dekonstruktion traditioneller poetischer Schreibweisen, linguistischer Normen und der abendländischen logozentrischen Denkweise. Könnten experimentelle Schreibweisen demzufolge nicht auch politische Intentionen zum Ausdruck bringen, da sie unsere Denkweisen und Weltbilder grundsätzlich in Frage stellen? Die politische Funktion der Kunst bestünde dann im ästhetischen Effekt und in der durch sie erzeugten Distanz zur gesellschaftlichen Realität. Jacques Rancière bezeichnete dies als „politische Subjektivierung“, nämlich die Emanzipation des Einzelnen oder einer Gruppe von zugewiesenen, durch Sprach- und Denkweisen verfestigten Identitäten und Rollenverteilungen. Diese Studie untersucht das Engagement der Literatur aus einer poetologischen Perspektive, indem sie sich mit der immanent politischen Intention befasst, die sich in bestimmten experimentellen poetischen Schreibweisen manifestiert.
Mit Beginn der 1950er Jahre traten die konkrete und visuelle Poesie sowie die Lautdichtung und das experimentelle Hörspiel vor allem in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich in Erscheinung. Bis heute werden diese literarischen Formen meist als bloße Sprachspielerei betrachtet, die den Autoren eine politische Stellungnahme zur Realität ersparten. Schon in den 1960er Jahren galten experimentelle Schreibweisen im Zuge einer einseitigen Rezeption des Sartre’schen Begriffs der „littérature engagée“ als „desengagiert“. Dennoch beriefen sich damals Autoren wie Eugen Gomringer, Helmut Heißenbüttel, Franz Mon, Max Bense, Reinhard Döhl oder Ernst Jandl auf die politische Tragweite ihrer Dekonstruktion traditioneller poetischer Schreibweisen, linguistischer Normen und der abendländischen logozentrischen Denkweise. Könnten experimentelle Schreibweisen demzufolge nicht auch politische Intentionen zum Ausdruck bringen, da sie unsere Denkweisen und Weltbilder grundsätzlich in Frage stellen? Die politische Funktion der Kunst bestünde dann im ästhetischen Effekt und in der durch sie erzeugten Distanz zur gesellschaftlichen Realität. Jacques Rancière bezeichnete dies als „politische Subjektivierung“, nämlich die Emanzipation des Einzelnen oder einer Gruppe von zugewiesenen, durch Sprach- und Denkweisen verfestigten Identitäten und Rollenverteilungen. Diese Studie untersucht das Engagement der Literatur aus einer poetologischen Perspektive, indem sie sich mit der immanent politischen Intention befasst, die sich in bestimmten experimentellen poetischen Schreibweisen manifestiert.
Bettina Thiers : Experimentelle Poetik als Engagement. Konkrete Poesie, visuelle Poesie, Lautdichtung und experimentelles Hörspiel im deutschsprachigen Raum von 1945 bis 1970. Verlag Olms

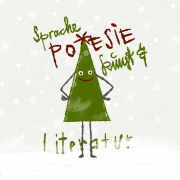
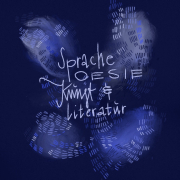
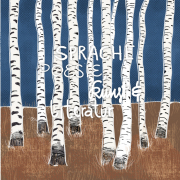
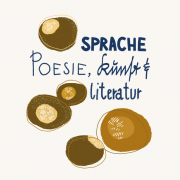



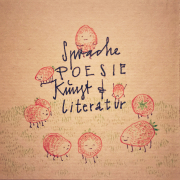
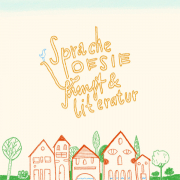
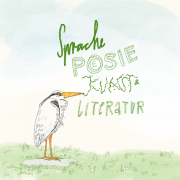
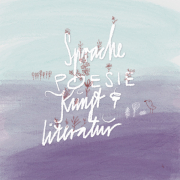
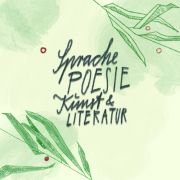
Neuen Kommentar schreiben