Benachteiligungsverdacht
 Alte lithographierte Einkleber fürs Poesiealbum
Alte lithographierte Einkleber fürs Poesiealbum
Interessante Gedanken steuert alex h (wer immer das ist) der Debatte (in der Lyrikzeitung) um Bertram Reineckes Essay „Die Mitte und kein Ende“ (in den Signaturen) bei:
„man könnte immer sagen oder behaupten, ein gedicht sei wesensfremd, es stehe nur für sich. man kann diese behauptung dergestalt hinlegen, daß jeder, der diese idee, es ist ja eine, wie ein konzept behandeln will, aufsucht. diese gedichte wollen gesucht werden. sie sind mitte, denn sie kommen von einer. da wird an der sprache gearbeitet, um eine idee zu verwirklichen. da wird die sprache benutzt, verwendet. sie erhält ihren zweck. und so sehr es auch diesem zweck eignet, sich als zweck, das ist wieder idee-ll, zu verwischen, es wird ja doch gespürt. mitte hat macht. wer sich mit ihr einläßt, der hofft auch auf eine polizei, die ihn beschützt. ihn und seine idee, die dann sein beruf ist. ein gedicht, was gesucht werden will, wird auch nicht übrig bleiben.“
Ganz verstehe ich die Ausführlichkeit dieser Debatte nicht:
Die Jury, die Jan Wagners Regentonnenvariationen aus einer shortlist als das preiswürdigste der versammelten Bücher herausdestillierte, stand nicht vor der Frage den Bestand der heute möglichen Lyrik abzugleichen und daraus Gedichte und AutorInnen herauszufiltern, die neue Zugänge legen, sondern man hatte sich zu entscheiden zwischen einer Handvoll Büchern, wobei nur eines davon das Genre Lyrik nutzte.
Die ganze Diskussion losgetreten hat Luise Checchin in der taz mit der Frage:
„Wenn ein Vertreter eines Genres, für das sich ansonsten nur eine Spezialöffentlichkeit interessiert, auf einmal ins Rampenlicht gerät, was hat das zu bedeuten? Für das Genre und für die Lyriker, die weiterhin im Schatten stehen?“
In der taz finden sich dann Antworten wie:
„Wenn man sagt, man will eine Signalwirkung für das, was Lyrik heutzutage macht, dann hätte man jemand ganz anderen nominieren müssen“, meint Sabine Scho. Will sagen: eine Entscheidung innerhalb des Genres wäre sicher anders ausgefallen.
Björn Kuhligk: „Die Lyrikszene ist klein und da gibt es mitunter ein Verhalten, das an Kaninchenzüchtervereine erinnert. Wenn das eine Kaninchen den Preis gewonnen hat, dann beschweren sich alle anderen.“ Langt Kuhligk mit seiner flapsigen Expertise in die Wunde des Benachteiligungsverdachts und bringt damit eine mögliche Neiddebatte erst ins Kalkül?
Ich denke, schon die taz befeuert in ihrer Berichterstattung ein Mißverständnis, das sich dann fortpflanzt. Nach dem Motto: wir fragen mal die Genreleute, was sie von dem Preis für den Genre-Kollegen halten, ob er ihrer Meinung nach die richtige Wahl sei, wenn man denn das Genre selbst im Blick gehabt hätte. Daß es auf so eine Frage andere Antworten gibt, die man dann leicht zu Leid am Neid verdrehen kann, liegt in der Fragestellung.
Ich glaube, daß jeder der Beteiligten ehrlich und nachvollziehbar stimmig geantwortet hat, ohne Jan Wagner etwas zu mißgönnen, daß aber das entstandene diffuse Licht genutzt wurde, um Karten zu verteilen, die aus einem andren Spiel stammen. Denn das, was Kuhligk bei den Kaninchenzüchtern ausmacht, den Benachteiligungsverdacht, gibt es tatsächlich und kann getriggert werden: das Gefühl einem falschen Vergleich ausgesetzt gewesen zu sein, mit einer Beurteilung, die nicht von ausreichend fachkundigem Personal getroffen wurde, falsch aus dem Vergleich weggekommen zu sein. Dieses Gefühl begegnet jedem Autor, bereits wenn er Texte zu einer Zeitschrift einsendet oder zu einem Wettbewerb, und sein Material wird nicht genommen. Es stammt aus dem Wettbewerb und Wachsen am Vergleich. Der Autor hat womöglich sehr viel umfassender, sensibler, weitreichender verglichen, als der Beurteiler – er ist der eigentliche Fachmann, der sich aus dem Vergleich heraus mühsam entwickelt hat, und dann steht da „ein Laie“ und bügelt seins ab.
Das ist sehr oft die Realität.
Frank Milautzcki, 12.07.2015

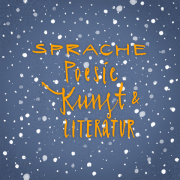
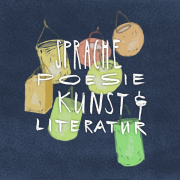
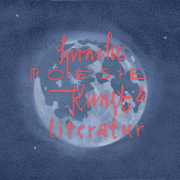
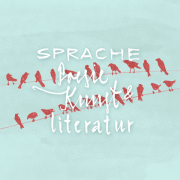
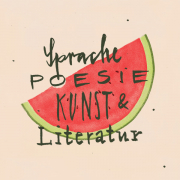
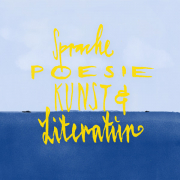
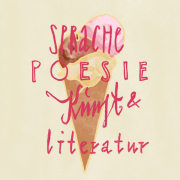

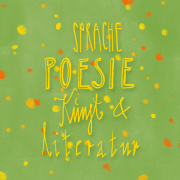
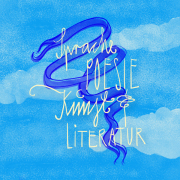
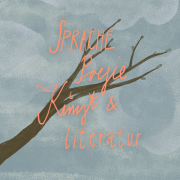
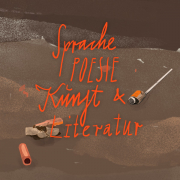
Kommentare
Benachteiligungsverdacht
Lieber Frank,
Ich finde Dein Bild von Karten, denen andere neue Karten hinzulegen möchten sehr hilfreich. In der Taz buttert bereits Max Czolek eine Karte hinein, weil er hofft, dieser Stich würde auf seine Seite fallen. Dass Nora Bossong diesen Stich dann öffentlich zieht, ist ärgerlich. Sie kann sich darauf verlassen, dass Kuligk vorher in der Taz allen Mitspielern, die Lyriker sind, die Farbe „Kompetenz“ blank gespielt hat.
In der Tat: Schon die Taz befeuert ein Missverständnis, das sich dann fortgeschleppt hat. Dieser Artikel ist aber tastendender ausgefranster als spätere. (Man will sich dann nicht beklagen, wenn er in Tageszeitungseile verluscht aber dennoch versucht, eine Breite einzufangen, ist ja heute leider keine Selbstverständlichkeit.) Wie wenig gehört dazu, ihn dann zu Vereinseitigen in Richtung eines ohnehin virulenten Missverständnissses, wie der Zeitartikel es getan hat!
Es gibt natürlich viele andere Karten im Spiel und es wäre interessant, wo welche Karte noch hinzu gelegt wurde …
Für mich irritierend, wie dennoch das Bedürfnis über Jan Wagners Lyrik zu reden, aber ganz dominant bleibt, obwohl Kuligks problematischer Stich und Bossongs Artikel es sehr erschwert haben, gerade jetzt darüber zu reden. Danke auch für die Klarstellung: Wer aus der ShortlistLyrik auswählen wollte, konnte nur Wagner wählen, egal wie sehr sein Herz gerade an Wagner oder vor allem an der Lyrik hängt. In Deiner Deutlichkeit ist das eine erfrischend wahre Feststellung. Sie hat mich zum Nachdenken angeregt: Warum haben dies Argument nicht diejenigen im Munde geführt, die gegen eine Wagnerdebatte zum jetzigen Zeitpunkt sind? Es hätte doch etwas schlagendes gehabt. Ich sehe, dass Ihnen da mehr als ich bisher vermutete tatsächlich um Wagner ging, dessen öffentliches Lob sie von ganzem Herzen billigen und kein My davon abgezogen wissen wollen. Hatte ich noch nicht dran gedacht ... Man müsste schon das scharf kritsiche Urteil eines Alex H. haben, welches sichtlich so fundamental ist, dass es ihn von dem Verdacht freispricht, er meine ausschließlich und ausgerechnet Wagner will man z.B. die Jury treffen. Er hat aoffenbar von Anfang an eine grundsätzliche andere Meinung dazu, was Lyrik heute sein sollte und Wagner gehört gar nicht dazu? Soweit habe ich ihn verstanden. Aber ich verstehe ihn erfahrungsgemäß nicht sonderlich gut. (Ich meine jedenfalls einer Stimme mit ähnlichem Gestus öfters auf Lyrikzeitung begegnet zu sein und identifiziere ihn mit einem Autor aus Schreibheft Nr.79.)
Zurück zu Deinem Beitrag: Ja, ich kenne das Gefühl auch, was da getriggert werden kann. Und manchmal bricht es sich vielleicht auch Bahn. Es sind ja seltsame Situationen, denen man als Lyriker begegnet. Ich habe auch Lesungsansetzungen unter dem Label „Lyrik“ schon als großes Missverständnis erlebt: Das hier ist doch gar nicht in irgendeinem relevanten Sinne „etwas von demselben“. Der teils vielleicht manchmal berechtigte Schmerz bei Auswahlprozessen nicht adäquat wahrgenommen zu werden, stumpft doch aber die Leidenschaften auch sehr schnell ab. Sei es, dass er sonst zur Gewohnheit weren müsste, was niemand ertrüge und man sich abwendet, sei es, dass es immer wieder oder auch hier und da dann doch auch schöne Gelegenheiten für die eigenen Texte gibt. So habe ich das Gefühl, dass sich Leute in diesem Segment des Betriebes unabhängig davon, ob sie vergleichbare Sachen machen, auch oft durch eine gewisse Selbstdistanz menschlich auszeichnen. Naturgemäß muss ich mich hier ausnehmen :-)
Benachteiligungsverdacht
lieber bertram,
mir geht es mit dem text von alex h ähnlich. er scheint mir sehr fundamental und dabei bringt er begriffe auf, die mir im zusammenhang mit lyrik noch nicht eingefallen sind, was ich aber als schöne überraschung empfinde. wahrscheinlich lese ich im moment nur sachen hinein und habe keine ahnung was er wirklich sagen will, aber allein das hineinlesen empfinde ich als spannend. es kann auch sein, daß die denke dahinter absolut krumm ist. keine ahnung.
"diese gedichte wollen gesucht werden. sie sind mitte, denn sie kommen von einer. da wird an der sprache gearbeitet, um eine idee zu verwirklichen. da wird die sprache benutzt, verwendet." - würde ich jetzt so lesen, daß sich alle anstrengungen, die man unternimmt, um zum gedicht zu kommen, an einem ort treffen, der dann als gedicht geschieht. die wirkliche mitte ist das gedicht, die sprache das konstruktionsmittel (die mitte des konstruierens). liest sich hübsch konzentriert. das gedicht ist das ereignis.
und dann ist es nochmal ereignis, wenn es gelesen wird. und immer wieder ein ereignis bei jedem anderen lesen.
was ich interessant finde, ist auch die rede vom zweck. den hinweis gab es kürzlich schonmal.
jedenfalls könntest du recht haben mit deiner schreibheft 79 vermutung.
ansonsten komme ich jetzt nicht mehr viel weiter. ich bin leer für heute.
noch eins vielleicht: schön find ich auch dein wort selbstdistanz - ich glaube herta müller hat in ihrer nobelpreisrede davon gesprochen, daß sie mal wieder neben sich stehe. und gerade diese selbstdistanz, hat oft zur folge, daß manche schreibende klüger vergleichen als urteilende.
Lyriker in Germany
goethespatzen und eichendorfschnecken
unter den augen die sonne
das fingerbrot
die kurzen landschaften
kreide unter der zunge
bisweilen händchen haltend
was ab haben wollen vom großen fest
der geschäftige neid
die angst nicht mal mehr zu kurz zu kommen
arm in arm
die nacht
enttäuschte bindfäden und viele durstige stellen
Benachteiligungsverdacht
Lieber Frank, Alex wird ja nun klarer in seinen Äußerungen. Man versteht es besser. Ob Jan Kuhlbrodt es schon gelesen hat? Der beklagt sich an anderer Stelle, dass das Gespräch hier wieder in die alte politische Neiddebatte zurückfällt.
Ich staune: Jan wünscht sich eine Debatte um (Wagner)gedichte, und hat sie nicht. Ich versuche an eine Debatte über die Poetologie von Lyrikberichterstattung und andauernd schieben sich poetologische Ausführungen zu Wagner dazwischen. (Nun z.B. von Alex.)
Ich finde Jan hat aber nicht recht, wenn er sagt, die Debatte falle zurück, wenn wir hier das Thema Neid nochmal vorsichtiger aufnehmen. Denn Du hast dieses Thema vor kurzem ja schon mal rustikaler gehandhabt und mühst Dich hier um eine differenzierende Klarstellung.
Es hat mich zunächst etwas verletzt, dass Jan Kuhlbrodt seinen Unmut über das Rücksinken ins Politische beklagt. Ich habe zunächst gedacht: Wozu der ganze Zauber, damit er und wir endlich über Poetik reden können, ohne so sehr missverstanden zu werden. Warum klagt er? Nun ist mir aber klar: auch ich bin dünnhäutig geworden. Es ist ganz legitim und ich finde, dass man über Poetik reden können muss, wann man will. Man sollte sogar den Begriff „Neobiedermeier“ der missverständlich ist, gebrauchen dürfen dabei, ohne sogleich in eine Schublade verwiesen zu werden. Wenn ich anfinge, ihm vorzuwerfen, dass die politische Vorfelddebatte erstmal zu führen sei und man später dann vielleicht über Wagner reden könne, mache ich ja ihm zum Vorwurf, was schlechter Zustand des öffentlichen Gespräch ist. Diesen Vorgang hatte ich ja selbst an Delabar und anderen kritisiert. So haben jene verblassten Parteikader damals auch immer argumentiert: Das Utopische wird später sein und die realexistierenden Bedingungen des Sozialismus erlaubten uns in der heutigen leider noch nicht … und die Lage war nie danach und die Öffentlichkeit meist trist. Nein, eine Jan Wagner Debatte kann man anzetteln, wann immer einem danach ist und man muss sie auch nicht in einem so nüchternen, manchmal spröden Vokabular führen, wie ich dies tun würde …
Aber nochmal zurück zum Neid. Du betreibst eine sensible Psychologie des Neides, gewiss, aber merkwürdig daran ist doch, dass sich dieses öffentliche Psychologisieren nur einige gefallen lassen müssen. Welche Eitelkeiten mögen Nora Bossong oder Walter Delabar bewegen? Irgendwie sieht man hier viel schneller ein, wie schnell die Grenze zur Geschmacklosigkeit überschritten ist.
Du teilst ja Jan Kuhlbrodts Utopismus (“ist es zu früh und die äpfel noch nicht reif, doch der hunger groß/ bruder nimm den stecken, schlag sie für uns los.”), wenn Du über Neid reden möchtest, ohne als Partei missverstanden zu werden. Dann müsste man psychologisch in verschiedene Richtungen schauen. Denn das Schöne an Deinem Beitrag ist ja, dass er den Neid im Zusammenhang mit Wettbewerb stellt. Es müsste ihn also nicht nur bei irgend welchen zu kurz Gekommenen geben sondern überall. Im Wettbewerb stehen ja noch stärker diejenigen, die erfolgreich genug waren, ihre Existenz darauf zu gründen, für die ein Preis nicht bloß ein Luxus on top wäre.
Aber das wäre dann mehr Deine Debatte. Das Einzige, was mir dazu einfiele ist, dass bestimmte Lyriker erstaunlich undifferenziert mit Kritik umgehen, sich überall von Neidern umstellt sehen und für mich sind diese Neider unsichtbar, weil ich mich mit deren poetologischen Gegenentwürfen beschäftigt habe. Für manche Preisträger muss Lebenszeit unter Lyrikern grauenhaft sein, dass man sie am Besten mit Gesprächen über Fußball überbrückt.
lieber bertram,
lieber bertram,
es wird heute sehr spät oder erst morgen, bis ich dir ausführlicher antworten kann.
vielleicht nur so viel, daß poetologie vielleicht auch ein vergleichsresultat ist, zumindest in teilen,
gewachsen mit der eigenen schreibe, oder den möglichkeiten zu schreiben, die man entwickelt.
Man erreicht also Gelände, das man schildert - und es ist meines Erachtens vollkommen legitim dieses gelände zu beschreiben oder Blicke vom Standort als Perspektive zu schildern (z.B. als "Neobiedermeier"), wenn man dabei im hinterkopf hat, daß es eine mögliche perspektive von einem möglichen standort ist. Ich habe früher meine perspektive immer für originell gehalten (und für unbeliebt, weil sie vom arbeiter herkommt), davon bin ich gottseidank weg und kann jetzt viel mehr blickwinkel aufsuchen. ich habe gelernt z.B. ames gedichte zu lieben, hätte ich früher nie gedacht und muß es hier mal öffentlich bekennen. je mehr blickwinkel und perspektiven man zuläßt umso umfangreicher wird der blick. also muß es erlaubt sein gelände zu betreten, das vielleicht sogar vermint ist - und sei es um zu finden, daß die minen noch immer scharf sind und hochgehn. idealerweise sollte erkundung kenntnis bringen und nicht vorurteil.
aber das ist jetzt nur so hingeschrieben, weil es mir einfiel im zusammenhang mit der unmöglichkeit über neid zu reden. neid ist so ein vermintes gebiet. dabei ist der benachteiligungsverdacht absolut natürlich, weil es hier um vergleich geht mit anschließender unverstandener honorierung (und hat mit dem was man gemeinhin als "neid" markiert nicht viel zu tun: wenn ich zwei pullis nebeneinander halte und die raffinesse des einen, des eigenen wird gar nicht erkannt, weil er vielleicht für ein anderes wohlfühlen gestrickt ist, für eine andere gesellschaft, dann neide ich dem anderen, dem erwählten, nicht seinen altstrickmusterpulli, sondern ich zweifle an der kompetenz zur einschätzung, wertschätzung, schatzbetrachtung. Ich sehe deutlich einen Kompetenzzweifel und nicht "Neid" in der Debattenmotivation der Wortmelder. Eine Wahrnehmungskritik - hey - habt ihr euch das alles wirklich genau angekockt? Warum kommt ihr zu einem bestimmten Urteil - wollt ihr euch nicht auch mal in den Kulissen umschauen .... etc. etc. Neid ist das nicht, sondern Einwinken in anderes Gelände.
Benachteiligungsverdacht
Lieber Frank, bevor ich auf Deine letzte Nachricht eingehe, muss ich noch einmal ganz zurück. Wenn Kuligk unmittelbar in einem der ersten Artikel sich zur Ähnlichkeit von Lyrikern und Kaninchenzüchtern äußert, kann er noch gar nicht wissen, wie die Welt sein wird und interpretiert sie probeweise nach seinem Allgemeinplatz, der eben ein Vor- Urteil ist.
Wenn Nora Bossong in der Rückwendung zum gleichen Ergebnis kommt, dann hat ihr Urteil den Anspruch, Welt zu beschreiben. Folglich braucht es Belege. Sie findet genau zwei, und eine weitere
Wortmeldung holt sie sich eigens ab. (Dass die dann gar nicht das sagt, wofür es stehen soll, ist eine andere Frage.) Wie viele Lyriker vom Bekanntheitsgrad mindestens eines Breyger wird es geben? Ich denke, es könnten einige Hundert sein. (Und hat es nicht auch erfreute Äußerungen zu Wagner gegeben?) Die Wahrheit ist also: Es gab kaum kritische Stimmen zu Wagner. (Das Schweigen kann verschiedene Gründe haben.) Viel weniger allzumal z.B., als zu den Debatten in Darmstadt, Du sprichst es an. Mit anderen Worten: Auch wenn Nora Bossong einen Kommentar schreibt, sollte ein Kommentar doch die Wirklichkeit richtig wiedergeben, die er einordnen und werten möchte und nicht die Wirklichkeit ignorieren und eine Unwahrheit nahelegen, nämlich hier, dass es wie typischer Weise sofort Kritik gäbe. Man sieht hier sehr schön, dass der allgemeine Verdacht genutzt wird, um sich die Ohren zuzuhalten bei abweichenden Meinungen . Überhaupt liegt die Prominenz des Neidverdachtes nicht daran, das Lyriker heute besonders neidisch sind, wofür Dein Text Erklärungsansätze bietet, als vielmehr daran, dass es diese Lücke zwischen den in der Lyrikberichterstattung verhandelten Argumenten und einem auf andere Argumente bauenden Kennerdiskurs gibt. Manche halten die Schlechtigkeit des Menschen für eine bessere Erklärung für diese Lücke als den Umstand, dass die Berichterstattung entweder unvollkommen oder mindestens streitbar ist. (Hier sieht man, wie der Kapitalismus einen schlechten Menschen erfordert und zur Not erst diskursiv erzeugt, um glaubwürdig zu sein.)
Ich frage mich, warum sich Leute wie Jan oder ich dafür rechtfertigen müssen, wenn wir die Verletzung der journalistischen Verpflichtung auf Wahrheit missbilligen, und sei diese Verletzung auch nur implizit geschehen. (Jan möchte ja vor allem ein vorher aus schlechten Gründen entwertetes Argument rehabilitieren.) Deswegen verstehe ich die Länge der Debatte ja auch nicht und das Thema Neid jetzt anzusprechen, kommt mir problematisch vor und begünstigt eben bestimmte Positionen.
Wie verheerend die Linie Kuligk Bossong ist: Weil man seine Meinung vorsichtig äußern muss, kann man sie ebensogut auch gar nicht mehr äußern. Wenn man seine Distanz zu Wagner ausdrückt (sei es kritisch oder positiv, aber weniger interessiert) kann einem leicht untergeschoben werden, diese vorsichtig kritische Meinung stehe „eigentlich“ für einen großen Bereich des Ungesagten. Sie würde also auf neuem Boden interpretiert, der verdächtig an den Boden von Diskursen unter Zensur erinnert … Und da lauert dann schon sofort gleich das nächste Missverständnis: Wenn man seine Meinung vorsichtig-reflektiert oder wie immer aber bedacht äußert, dann lässt man sich ja eines Aufdrängen: Dass eine spezielle, differenzierte Meinung zu Wagner erforderlich sei, weil sie Bestimmtes bedeute. Das muss der Fall nicht sein. Was man sicher sagen kann: Wagner wird von Bossong und Kuligk überschätzt. Dazu muss man gar nicht wissen, ob Wagner ein so großer Dichter ist, wie diese nahelegen, es reicht ja einfach laut zu sagen: Nein, es gibt Leute, für die Jan Wagner nicht ein Gegenstand ist, sich selbst zu überdenken oder neu zu positionieren. (Und sei es, weil sie ihn schon immer lesen.) Anderen wiederum mag dies ein höchst willkommener Anlass sein ...
Natürlich weiß ich, dass Du den Anspruch an Dich hast, dass Deine Positionen nicht unvrrückbar ein für alle Mal da sind, sondern auf die Wirklichkeit reagieren.. Mich hat es sehr beeindruckt, wie öffentlich revisionsbereit Du gewesen bist, z.B. auch in Bezug auf Konstantin Ames. Abgesehen von dem Dichter ist mir also vor allem der Umstand wichtig, dass Du weniger apodiktisch geworden bist als früher, ausprobierst usw.
Da kannst Du manchmal vielleicht auch für mich ein Ansporn sein.
Auch wenn ich mit Jan Kuhlbrodt vielleicht eine größere Meinungsschnittmenge habe als mit Dir (Ich weiß es aber letztendlich nicht), bemerke ich oft, dass mich sein Ton, der Behauptungen im Modus von gesicherten Gewissheiten auszuspricht, öfters stört. (Immerhin hindert ihn das nicht daran, irgendwann auch anderer Meinung zu sein.) Wenn man das selber unangenehm erlebt hat, mag die Versuchung groß sein, sich mit den Opfern seiner Attacken zu solidarisieren ... So verstehe ich Deinen Artikel gegen Kuhlbrodt. Denn was die anderen Fragen betrifft, lagen da ja Welten zwischen uns.
Wie Du Deine Position öfters als die eines Arbeiters in Verdacht gezogen siehst, geht es mir so mit meiner als z.B. „akademisch verkopft“. Aber selbst, wenn die Diagnose richtig wäre, dass meine institutionellen Studien mir geholfen haben, gewisse Argumente zu entdecken, dann erwarte ich dennoch, dass man sie ansieht. Sie sind ja damit immer noch richtig oder falsch und außerdem nicht erwartbar. Michael Lenz, Walter Delabar und Malte Fueß etwa, sind sicherlich Akademiker mehr als ich, aber augenscheinlich in vielen Punkten sehr unterschiedlicher Meinung. Auch ist ja im Positiven wie Negativen nie klar, was mit der Apostrophierung „akademisch“ gemeint ist, so kann ja auch die akademische Perspektive von Fall zu Fall die saturiert gesicherte als auch die ökonomsich existentiell Bedrohte sein, ebenso wie soziologisch ( marginalisiert, weil keine „Masse“ dahinter steht.) wie es umgekehrt sein kann, weil der Lyrik lesende Arbeiter ebenfalls einsam ist usw.
Neuen Kommentar schreiben