Zwetajewas Treppengedicht

Interessante Neuausgabe bei Moloko Print: Marina Zwetajewa: Das Treppengedicht - in zwei Versionen aus dem Russischen von Felix Philipp Ingold mit einem Faksimile des Erstdrucks.
Auf der website des Verlags lesen wir einen Auszug aus dem Nachwort von Felix Philipp Ingold:
„Marina Zwetajewa zählt zu den schwierigsten Autoren der europäischen Moderne – schwer fällt allein schon die Lektüre ihrer hochkomplexen dichterischen Werke, noch schwieriger ist deren Verständnis, am schwierigsten wohl die Übertragung der russischen Originaltexte in eine fremde Zielsprache.
Die vorsprachliche Magie der Dinge vergegenwärtigt Marina Zwetajewa an einem Objekt, das (fast schon „naturgemäss“) zur alltäglichen zivilisatorischen Erfahrungswelt gehört – die Treppe, die Haustreppe, das Treppenhaus in unterschiedlichster Ausgestaltung und Funktion. Diesem technischen Gebrauchsobjekt hat sie unter dem schlichten, ganz und gar unpoetischen Titel Die Treppe ein hymnisches Dichtwerk gewidmet, ein ausuferndes, vielstimmig instrumentiertes hermetisches Dinggedicht (alternativ auch als „Treppengedicht“, als „Poem von der Treppe“ betitelt).
Der definitive Text ist 1926 in St-Gilles-sur-Vie (Vendée) entstanden, wo die Autorin – sie lebte seit Ende 1925 im Pariser Exil – den Sommer verbrachte. Die grossangelegte Dichtung war ursprünglich geplant als „Erzählung darüber, wie die schwarze Treppe lebt und arbeitet“. Die Grundidee, die Treppe wie ein Lebewesen, ja als ein solches zu würdigen und zu feiern, blieb in der Folge erhalten – im Poem wird sie in ihrer Materialität, das heisst in ihrer «Leiblichkeit», in ihrer vertikalen Struktur (als Wendeltreppe oder als Treppenhaus mit Knickstellen und Absätzen) vergegenwärtigt, als ein Organismus, der sich aus lauter natürlichen, jedoch künstlich und gewalthaft zugerichteten Gegenständen zusammensetzt.
Die Treppe scheint da und dort auch als verkappte Selbstdarbietung der Autorin, als Metapher für den konvulsivisch gegen Übergriffe sich zur Wehr setzenden weiblichen Körper, vielleicht auch als Dingsymbol für die Dichtung überhaupt zu fungieren. Darüber hinaus wird sie frei assoziiert mit der kapitalistischen Gesellschaftsordnung (Unter-, Mittel-, Oberschicht), mit dem Modell von Himmel und Hölle, mit einer Feuer- oder Jakobsleiter. Dieser ebenso weitreichende wie disparate Assoziationsraum wird im Text durchgehend präsent gehalten, wobei die Perspektive der Imagination und die des sprechenden Subjekts beziehungsweise des „lyrischen Ich“ ständig wechselt.
Die zahlreichen Stimmen, aus der die dichterische Rede sich speist, sind schwerlich auseinanderzuhalten, und die oftmals wechselnde Optik ergibt insgesamt so etwas wie ein Wimmelbild, dem zwar beliebig viele Details zu entnehmen sind, nicht aber ein kohärentes Gesamtbild des Treppenhauses, das sich letztlich wie ein multiperspektivisches kubistisches Kartenhaus ausnimmt …“

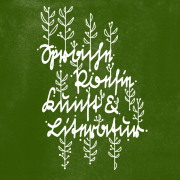


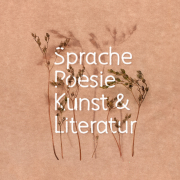

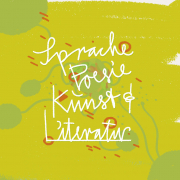
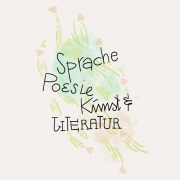
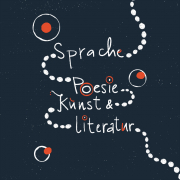

Neuen Kommentar schreiben