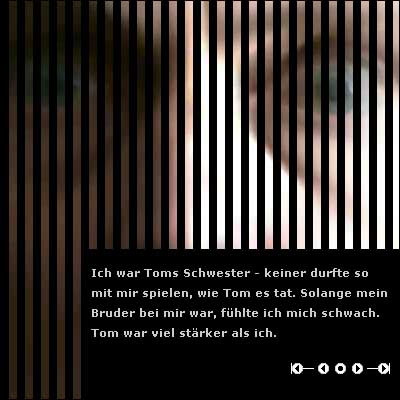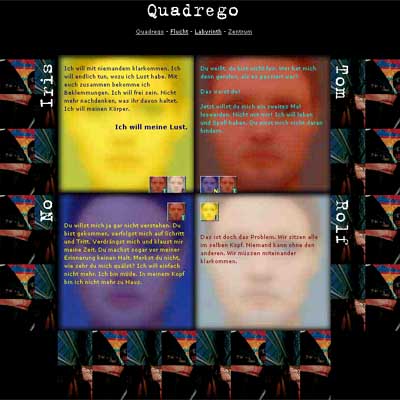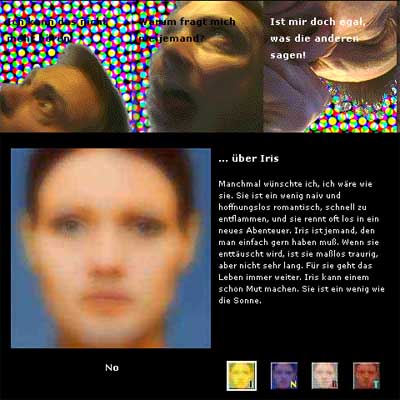|
Was
ist die Spezifik deines Beitrags als ein Beispiel
für digitale Literatur? Wie kamst du auf das
Thema?
Die Grundidee zu
Quadrego ergab sich aus der Lektüre
eines Buches über das Leben am/im Bildschirm
(Sherry Turkle: Life on Screen - Identity in the
Age of the Internet). Turkle beschreibt in ihrem
Buch das Verhalten eines Teilnehmers an einem MUD
(Multi User Dungeon), einem Fantasy Spiel mit
realen Teilnehmern. Dieser Teilnhemer nahm im Laufe
von wenigen Minuten vier verschiedene Rollen ein,
die von anderen Teilnehmern als vier
unterschiedliche Charaktere im Spiel wahrgenommen
wurden. Der Spieler bewältigte den
sprunghaften Rollenwechsel mithilfe einer
Fenstertechnik auf dem Bildschirm. Je nach Fokus
auf eines der Fenster wechselte er die
Rolle.
Quadrego
liegt eine ähnliche Fenstertechnik zugrunde,
die es dem Leser ermöglicht, die einzelnen
Persönlichkeiten zu "verorten". Die
Verknüpfungsstrukturen musste ich nun durch
eine Partitur fassbar machen, um für mich
selbst ein Bild der Dialogstränge zu
erhalten.
Gleichzeitig
recherchierte ich nach Rollenverhalten und
Persönlichkeitsspaltung und stieß auf
Forschungsberichte über MPD
(MultiplePersonality Disorder). Ich war sofort
fasziniert von dieser Form der
Persönlichkeitsvervielfachung. Es war ein
Phänomen, das sich gänzlich von der
Vorstellung des Rollenverhaltens abhob. Aus der
Rolle wurde die hermetisierte
Persönlichkeit.
In der
Einleitung heisst es: "Quadrego ist in
mehreren Formen geschrieben und lässt sich
lesen und erleben." Das Erleben ist ein Mehr
gegenüber dem Lesen eines Textes auf Papier.
So wird der Rezeptionsprozess selbst zum
Träger der Aussage?
Quadrego
vereint mehrere Monolog- und Dialogstränge,
die sich linear durchleben/lesen lassen. Die
Kombinierbarkeit ist ein wesentliches
Gestaltungselement, das dem Leser die Freiheit zur
eigenen Wegfindung durch den Text gibt. Brüche
bei der individuellen Rekombination dürfen
beim Lesen nicht spürbar werden. Divergente
und konvergente Erzählstränge treffen
sich immer wieder in Knotenpunkten, die als solche
aber nicht erkennbar sein dürfen.
Die
Komplexität einer solchen Textkonstruktion
darf an keiner Stelle des Werkes bemerkbar sein.
Wenn erst die Konstruktion begriffen werden muss,
um den Text zu verstehen, wird die Konstruktion zum
Selbstzweck. Wird die Vernetzung durch die
inhaltliche Vorgabe begründet, ist der
interaktive Link die logischen Schlussfolge. Dazu
eignet sich besonders der Dialog: Jemand sagt
etwas, ein anderer antwortet. Schon nehmen zwei
unabhängige Texte inhaltliche und interaktive
Verbindung auf. Dialog ist Interaktion im
ursprünglichen Sinne.
Ich denke, jede
Form der Rezeption eines Textes ist Teil der
Aussage. Lesetexte werden zu unterschiedlichen
Zeitpunkten der Geschichte in neuem Kontext und
Licht gesehen. Wenn ich nun schon Kontexte und
Licht mit in das Werk einbinde, ergeben sich schon
beim mehrfachen Lesen neue Perspektiven. Leser
gehen unterschiedliche Lesewege. Zeitgebundene
Abläufe überlagern den Leseprozess. Diese
Abhängigkeit des Moments und der Entscheidung
ist für mich das Neue, das der literarische
Text in der digitalen Literatur
dazugewinnt.
Quadrego
ist ein komplexes Werk, dessen Details man erst
geduldig entdecken muss: Sei es das Erscheinen
neuer Portraits, wenn man auf der Anfangsseite mit
der Maus über die Portraits der vier Ichs -
Tom, No, Rolf und Iris - fährt, sei es die
allmähliche Entlarvung des Bruders Tom ("Er
war mein Beschützer. Er war so wunderbar") als
Tyrann ("er gab mir Gesetze, die ich einzuhalten
hatte. Seine Strafen waren furchtbar und grausam"),
die zeitgleich zur Text- auch auf der Bildebene
erfolgt, oder sei es die kaum bemerkbare
Veränderung der Augenfarbe von Iris im Dialog
mit Georg. Überall lauern zusätzliche
"Text"ebenen, die für das Verständnis des
Ganzen wichtig sind, und die man
möglicherweise erst beim zweiten oder dritten
Lektüredurchgang entdeckt. Was, wenn der Leser
die Änderung der Augenfarbe nicht bemerkt? Und
was, wenn er sie dann trotzdem nicht
versteht?
Ich kenne den
Effekt, plötzlich neue Aspekte zu entdecken.
Wenn ich einen guten Film das dritte oder vierte
Mal sehe, fallen mir plötzlich Details auf,
die mir beim ersten Sehen völlig entgangen
waren. Es liegt in der Natur der Wahrnehmung, die
leider nur einen Punkt der Aufmerksamkeit hat. Den
Plural von Aufmerksamkeit gibt es nicht.
Unsere Wahrnehmung
entsteht aus dem Zusammenspiel von Bewusstsein und
Unbewusstsein. Beide Worte habe etwas mit Wissen zu
tun. Der größte Teil unseres Wissens
entzieht sich dem direkten d.h. "bewussten"
Zugriff. Trotzdem ist gerade dieser Teil unseres
Wissens und der Wahrnehmung der wichtigste, um ein
künstlerisches Werk zu erfahren.
Ich denke, dass
gerade beim ersten Lesen der Text die vorrangige
Rolle spielt. Die bildnerischen Bestandteile werden
trotzdem wahrgenommen, entziehen sich aber der
direkten Bewusstwerdung. Gerade der Bildanteil
spielt beim emotionalen Erleben der digitalen
Literatur eine besondere Rolle. Farbklänge und
-zusammenhänge werden zunächst rein
gefühlsmäßig erlebt, wie zum
Beispiel die Umgebung des Kerns von
Quadrego: In den langsam wechselnden Bildern
des Randes bilden sich Farbstimmungen und
Bildzusammenhänge. Je nach Lesemoment des
Dialoges, der sich im Zentrum befindet, werden
Leseeindruck und Bildeindruck individuell erlebt.
Es entsteht eine Bild-Text-Synthese, die sich weder
vom Leser noch vom Autor steuern
lässt.
Heisst dies
also, dass die Bilder am Rand auf das Erscheinen
der Texte abgestimmt sind oder vollzieht sich
dieses Synthes steuer- und damit aus der
Perspektive des Autors wohl auch
intentionslos?
Nein, auf
gar keinen Fall ohne Intention! Der Verlust des
Einflusses bedeutet vielmehr, immer auch die
Bild-Text-Beziehung in all ihren möglichen
Kombinationen anzulegen. Ich schaffe mit der
animierten Umgebung eine virtuelle Außenwelt,
die zwangsläufig, weil zeitgebunden, den
Interaktionsvorgang überlagert. Der Einsatz
der Bilder in dieser Form, also nicht an den Text
gebunden, ergibt eine Inhaltsschicht, die fast nur
emotional wirkt. Sie kann nicht gelesen werden, wie
der Text. Da die Aufmerksamkeit auf dem Text liegt,
werden die Bilder vom Betrachter nur unbewußt
wahrgenommen. Sie erzeugen Stimmungen, die auf den
individuellen Zeitpunkt bezogen, an dem ein
Text gelesen wird, einmalig in ihrer Kombination
sind. Die Einzelbilder sind alle aus
Hintergründen von Fotos ausgestanzt worden.
Sie bildeten also schon im Fotokontext einen nicht
bewußt wahrgenommenen Anteil am Bild. Die ins
Quadrat gestellte Komposition nimmt das Motiv des
eigentlichen Quadrego auf. Das Zusammenspiel aus
Bildrahmung und Text ist entscheidend für die
Gesamtwahrnehmung.
So ist es auch mit
Elementen, die innerhalb der Dialogstruktur erst
als Illustration wahrgenommen werden. Der Wechsel
der Augenfarbe von Iris spiegelt das
chameleonartige Wesen der Person wieder, die Georg
gegenübersteht. Die Verwirrung Georgs im
Angesicht widersprüchlicher Gefühle und
geheimnlisvoller Andeutungen spiegelt sich in den
Augen wider, die die Farben der vier
Persönlichkeiten annehmen. Dieser Farbwechsel
ist so abgedämpft gestaltet, dass er nicht
sofort auffällt.
Das Zusammenspiel
der Medien Text und Bild mündet im
intermedialen, individuellen Erleben. Der
Augenblick, in dem ein bestimmter Text mit einem
Bild/Farb-Klang zusammenkommt, ist schwer
wiederholbar, da er von der Geschwindigkeit des
Lesens und der Aktion des Weiterklickens
abhängig ist. Also ist auch das Ergebnis - das
Erlebnis - immer wieder ein anderes. Ein Film
lässt sich beliebig wiederholen und ist im
Zusammenspiel von Bild- und Tonelementen immer
gleich. Der interaktive Text wird aufgrund seines
Zusammenspiels mit zeitgebundenen, bildnerischen
Ereignissen immer wieder neu präsentiert.
Daraus ergeben sich völlig neue
Möglichkeiten für intermediale
Textgestaltungen.
|