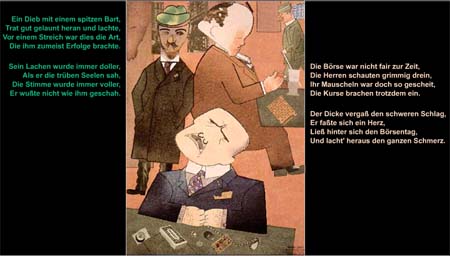|
|
|
Wie
kamst du zum Schreiben digitaler Literatur?
Und wie verhalten sich für dich dabei
dessen verschiedene Sprachen - Wort,
Programmierung, Bild - zueinander?
Die freie
Verbindung der verschiedenen Sprachen
ermöglicht einen sehr spielerischen Umgang mit
dem nun nicht mehr ganz so neuen Medium. Der
Spieltrieb und die Neugier auf die Verbindung der
diversen Ausdrucksformen boten mir einen starken
Antrieb für die ersten unsicheren Versuche im
Bereich der digitalen Literatur. Das technische
Handwerk wurde zudem durch den täglichen
beruflichen Umgang mit dem Computer geschult (auch
wenn ich mich, soweit es die Programmierung
betrifft, schwer überschätzt habe) und so
fiel mir zumindest der Anfang sehr
leicht.
Auschlaggebend
für die Beschäftigung mit der digtalen
Literatur war der ausgeschriebene Wettbewerb. Ein
Wettbewerb bietet ein Forum, liefert Kritik und
setzt ein zeitliches Limit für eine Arbeit.
Dieser Rahmen war sicher nicht nur mir sehr
wichtig.
Als Architekt ist
mir der Umgang mit verschiedensten Ausdrucksformen
wohl geläufig. Wahrscheinlich hat schon
Imoteph seine ersten Pyramidenprojekte in der
Verbindung von Zeichnung, Modell (3D und Echtzeit),
Rhetorik, Kostenmorphing und Verwaltungsprosa
multimedial präsentiert.
Die Verbindung der
verschiedenen Ausdrucksformen nun nicht in einen
Dienst zu stellen, sondern gleichsam mit einem
Eigenleben zu versehen, ist eine spannende
Aufgabe.
|
1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
|
|
Welche
Erfahrungen hast du bei der Produktion digitaler
Literatur gemacht? Wo siehst du die
entscheidenden Herausforderungen? Wo lauern
die Gefahren?
Am Beginn einer
Arbeit steht ein Konzept. Diese
"Absichtserklärung" will nun in der Folge
inhaltlich und handwerklich ausgearbeitet werden.
Da es sich hier um meine erste Arbeit in diesem
Bereich handelt, verstrickte ich mich sehr schnell
in den digitalen Fallen der Programmierung, was
sicher zu Lasten der Literatur geschah. Hier ist
die erste Eigenart der digitalen Literatur
beschrieben. Der Autor muß etwas mehr als nur
eine Schreibmaschine bedienen können, er
muß sich Fähigkeiten aneignen, die sich
sehr von jenen unterscheiden, die er gemeinhin
pflegt und entwickelt. Beim Programmieren wird er
in jedem Computerprogramm einen gnadenlosen Lektor
finden. Wie ein Musiker muß der Autor sein
Instument blind beherrschen, es sei denn er findet
jemanden, der nach seinen Anweisungen spielt. Ich
versuche mich gerade an den ersten Tonleitern. Die
Herausforderung besteht darin, beide Bereiche zu
verbinden.
Die zweite Eigenart
der digitalen Literatur zeigt sich, wenn der Autor
sein Instrument virtuos beherrscht und dann richtig
aufspielen möchte. Hier lauert die Gefahr,
daß eine visuelle Dominante die Arbeit
bestimmt. Diese Problematik führt zu der Frage
nach der Form, nach der Tarierung aller
eingesetzten Mittel, die sich gemeinsam dem Konzept
unterordnen müssen.
|
1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
|
|
Die
Knittelverse konfrontieren einen
zunächst mit George Grosz' Bild
Brillantenschieber im Cafe Kaiserhof, dem
man durch Klicks erst die Geschichten der
abgebildeten Personen in Versform entlocken muss.
Ein recht interessanter Ansatz, der mit dem
versteckten Text im und in diesem Falle unter bzw.
hinter dem Bild spielt. Wie kamst du auf diese
Idee?
Für mich war
die Frage nach den Besonderheiten der digitalen
Literatur wichtig. Ein Unterschied zu anderen
Medien liegt in der Möglichkeit, Varianten
einer Geschichte anzubieten, die vom Betrachter
entdeckt werden müssen. Diese Varianz wollte
ich zu Thema machen. Eine wie auch immer geartete
visuelle Gestaltung musste also zwei Aufgaben
übernehmen: Sie sollte einerseits den vielen
Geschichtchen einen gemeinsamen Rahmen, einen
gemeinsamen Ausgangspunkt bieten und andererseits
als Navigator fungieren. Ein Bild als Ausgangspunkt
einzusetzten lag nahe, eines von Grosz zu
wählen nicht.
Die
Brillantenschieber erwiesen sich jedoch als
dankbares Objekt. Die Art der Darstellung und die
Bildaufteilung unterstützten die
Möglichkeit kleiner Animationen, die
dominanten Köpfe förderten das intuitive
Auffindung der Verlinkung und die im Bild
ungenannte Beziehung der Schieber zueinander
ließen Raum für verschiedene
vorstellbare Geschichten.
Knittelverse
wurden von den akademischern Wächtern der
Poesie lange Zeit als volkstümlich abgelehnt.
Zwar hat Goethe sie dann gewissermaßen
rehabilitiert, aber Wilhelm Buschs Aufgriff der
Knittelverse bestätigte wiederum ihre Eignung
als leichte Kost und zwar schon in Verbindung mit
dem Bild. Worum ging es dir, als du dem Grosz-Bild
Text hinzufügtest?
Die leichte Kost
war mir durchaus recht. Ich bin bald von dem
Variantenreichtum überrollt worden, weshalb
mir auch einige der schlichten Verse nur sehr
holperig gelungen sind. Bei der vollen Ausnutzung
von je fünf aufeinanderfolgenden Versen mit
jeweils 4 Verlinkungen wären insgesamt 1024
Verse nötig gewesen. Ich habe mich redlich
bemüht, diese Zahl durch zeitige Abgänge
der Protagonisten zu vermindern. Wilhelm Busch
hätte mich wahrscheinlich ausgelacht.
Es stimmt aber,
daß diese etwas stoppeligen Verse mit der
karikaturartigen Darstellung von Grosz einhergehen.
Das Schriftbild unterstützt zusätzlich
das Gemenge der leichten Kost. Es ging mir um die
Unterbringung vieler verschiedener Geschichten in
einem übersichtlichen Bild und dem Betrachter
sollte sich diese Arbeit ohne Umwege selbst
erklären. Die einfachen Texte gehören zu
diesem Konzept.
|
1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
|
|
Wie
siehst du die Zukunft der digitalen Literatur und
wie siehst du sie für dich
speziell?
Die digitale
Literatur wird sich etablieren. Die technischen
Möglichkeiten sind vorhanden und der
unbändige Gestaltungswille einer ganzen
Generation, der sich bisher noch vornehmlich in
bunten Webseiten austobt, wird beizeiten neue
Betätigungsfelder suchen.
Die Vermittlung
digitaler Ästhetik im Rahmen des Studiums
findet ja schon statt, denn in vielen Bereichen
gehören die digitalen Medien bereits zum
gängigen Präsentationskanon. Sie sind
zwar selten Teil der Lehre, aber dafür
häufig selbstverständliche Werkzeuge der
Arbeit, mit denen natürlich auch
experimentiert wird.
Ich werde,
zusätzlich durch den Wettbewerb motiviert,
mich an weiteren Projekten versuchen und glaube,
daß es da noch unglaublich viele weiße
Flecken auf der digitalen Landkarte gibt.
|
1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
|
Die
AutorInnen/Beiträge
|
Martin
Auer
|
cN+ Messages from
the Past
|
 go
go
|
|
Nils
Ehlert
|
Jetzt
|
 go
go
|
|
Odile
Endres
|
Gleitzeit {Color:
blue}
|
 go
go
|
|
Wolfgang
Flür
|
Neben
mir
|
 go
go
|
|
Carola
Gueldner
|
Billard in
Amsterdam
|
 go
go
|
|
Dorit
Linke
|
Der
Apfel
|
 go
go
|
|
Stefan
Maskiewicz
|
Quadrego
|
 go
go
|
|
Jochen
Metzger
|
Cocktailstories
|
 go
go
|
|
Heiko
Paulheim
|
Die
Galerie
|
 go
go
|
|
Julius
Raabe
|
Knittelverse
|
 go
go
|
|
Andreas Louis
Seyerlein
|
Die Callas
Box
|
 go
go
|
|
Melanie Schön
|
Chile-Projekt
|
 go
go
|
|
Michael
Kaiser
|
btong
|
 go
go
|
|
Nika Bertram
|
Der Kahuna
Modus
|
 go
go
|
|
Ursula
Menzer
|
ER/SIE
|
 go
go
|
|
Romana
Brunnauer
|
2 Tote
|
 go
go
|
|
|