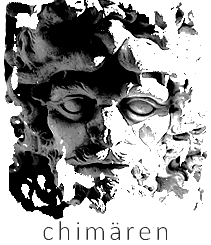Neben meinen phantastisch-surrealen Kurzgeschichten, die sich nicht begrenzen und abgrenzen lassen, arbeite ich seit geraumer Zeit an meiner Sammlung
Chimären, die man der
Flash Fiction oder den
Microrrelatos zuordnen kann. Dennoch gibt es Unterschiede, die oft in der Sprachgestaltung selbst begründet sind. Oft genug versuche ich, die Regelpoetik zugunsten einer
Tiefensprache auszusetzen. Oft genug geht es dabei um Komposition, Rhythmus und Bruch der Konsensrealität. Weil ich beabsichtigte, die Chimären, die im Grunde nicht zu veröffentlichen sind (wie man sehen wird), durch dieses Blog laufen zu lassen, hier einige Überlegungen zur Poetik.
Quantenpoesie
Nichts entsteht im luftleeren Raum. Meine Ästhetik, völlig auf sich bezogen, steht in der Tradition – und all ihren Brüchen – der romantisch-symbolisch-surrealen Schule des Pfades zur linken Hand (Left Hand Path). Es handelt sich um eine Literatur der Wahrnehmung und meint somit Ästhetik in ihrer Reinform. So also ist meine Prosa keine Prosa, sondern Textur, denn nichts anderes sind wir überhaupt imstande wahrzunehmen. Das hört sich zunächst an, als gäbe es, wie die Vertreter des Nouveau Roman behaupteten, nur Oberfläche. Dabei ist allerdings zu beachten, dass es überhaupt
nirgends eine Oberfläche gibt. Das Erscheinende ist interpolierter Bestandteil unseres Wahrnehmungsapparates. Die Textur, die an die Form eines Leistungsdichtespektrums erinnert, wird in der menschlichen Expression meist zu Text oder Musik oder Bild. Ähnlich aber wie ein Atomkern nicht dargestellt werden kann indem man ihn fixiert, kann eine Szene (Sequenz) nicht dargestellt werden, ohne Partei zu ergreifen für das, was sich in Gattungen widerspiegelt. Die Textur ist gattungsfrei – ihr Gegenteil ist „Ablauf“. Und auch die
Quantenpoesie ist gattungsfrei – ihr Gegenteil ist Regelpoetik. Aber hat nicht bereits die „Movens“ – Gruppe auf den „Nur-Text“ hingewiesen? Gewiss. Aber ähnlich wie der Kahlschlag aus Gründen einer Reduktion auf angeblich Wesentliches. Textur jedoch ist das Gegenteil von Reduktion; man könnte sagen, Textur ist alles – und das schließt das Unbekannte mit ein. „Bekannt“ nämlich kann uns nichts sein, was sich nicht in unserem Takte bewegt (in Relation zu absoluter Bewegung). Textur bewegt sich absolut. Unsere Wahrnehmung wäre demnach der Takt, mit dem wir dieser Textur etwas
für den Augenblick entnehmen. Das ist Quantenpoesie.
Wissenschaft und Philosophie; neben der Poesie sind sie die beiden anderen „großen Fiktionen“. Sobald man sich daran gemacht hat, ungelöste Fragen zu beantworten, zerstört man das axiomatische Fundament. Die Quantenpoesie fragt nicht, klärt nicht (außer in ihrer immanenten Rhetorik), weil sie schon allein Seelensprache ist, also die Ursprache, die weder Gattungen noch Konventionen kennt.
Ein Kleid spricht, ein Haus fährt nach Amerika.
Das absolute Buch
Mallarmé, der uns eine völlig neue Dichtung brachte, träumte von einem absoluten Buch, das er nie schrieb. Vielleicht aber war der Charakter des Werkes, zu dem er uns hunderte von Zetteln und Motiven hinterließ, das Scheitern. Einerseits das Scheitern am Schweigen, denn er erzählt uns, wie das Buch beschaffen sein sollte: aus losen Blättern, die bei jeder Lektüre so angeordnet
werden sollten, dass sich immer ein anderer Text ergibt. Er erzählt uns von seinen Zweifeln; Fragmenten. Er hinterlässt uns Satzfetzen – das Buch aber schreibt er nicht. Er kann es nicht, denn er scheiterte nicht nur am Schweigen sondern ebenfalls am Werk, das er mit dem der Alchemisten vergleicht. Dem Dichter kann es immer nur um den Prozess gehen. Das Ergebnis ist völlig belanglos. Genau dieser Prozess aber, der ein Ergebnis außer Acht lässt, schneidet den Poeten von der Welt ab.
Wie sie einst im “Grenier” miteinander diskutierten, meinte Zola zu Mallarmé, dass in seinen Augen ein Dreck und ein Diamant gleichviel wert seien. — “Kann sein”, antwortete Mallarmé, “aber der Diamant ist — seltener.”
Degas ließ es sich nicht nehmen, Mallarmés Poesie zur Zielscheibe verschiedener boshafter Witze zu machen.
So erzählte er zum Beispiel, wie Mallarmé seinen Jüngern einst ein Sonett vorgelesen habe, worauf diese in ihrer Bewunderung das Gehörte in Worte zu fassen versucht und es, jeder auf seine Weise, interpretiert hätten: die einen sahen darin einen Sonnenuntergang, die andern den Triumph der Morgenröte; Mallarmé erklärte ihnen: “Aber ganz und gar nicht … es ist meine Kommode.”
Käte Hamburger hat in ihrer Logik der Dichtung den dankbaren Begriff des
Epischen Präteritum geschaffen, der unter anderem einen Satz wie: Morgen war Weihnachten erklärt.
In der Dichtung ist es freilich notwendig, einer anderen Grammatik zu folgen, weil auch diese bereits in der Fiktionalität existiert. Die Zeiten, die ja nur für unser Verständnis eines Ablaufs erfunden wurden, kaum aber etwas mit der Tropik zu tun haben, müssen sich in jedem Fall der Dichtung unterordnen. Ich benutze dieses
Epische Präteritum kaum, befürworte im Gegenzug die radikale Lösung, alle Tempora der Tropik unterzuordnen, wie sie Harald Weinrich formulierte. Auch in der Prosa, die für mich im günstigsten Fall ein breitgewalztes Gedicht ist. Gedicht und Kurzgeschichte, um mit Poe zu sprechen, sind die eigentlichen Ausleger der Poesie. Die Gemeinsamkeiten sind ja auch unverkennbar. Ziel ist die Stimmung, die Reflexion, die Musikalität.
Der Dichter
Lesen und schreiben sind ein und das gleiche. Das ist keine besonders neue Erkenntnis, fundamental aber wurde sie bei Borges. Jeder Dichter ist inspiriert von seinem eigenen Leben und von den Beobachtungen, die er durch andere Autoren macht. Vornehmlich durch die toten. Denn jeder andere lebende Dichter ist ihm Ärgernis, abgemildert dadurch, dass der Betreffende vielleicht in einer anderen Sprache schreibt. Warum? Weil, wenn der Dichter schreibt,
nur er schreibt. Diese Aussage ist selbstredend völlig vermessen, trifft aber auch auf den Leser zu (und damit ist ganz und gar nicht unser Marktleser gemeint).
Mit wem würden Sie das Buch, das Sie gerade lesen, im selben Augenblick, da Sie es lesen, teilen wollen?, fragte einst eine Journalistin auf einer Lesung.
Einzig mit dem geliebten Menschen, wäre für die Fragende die richtige Antwort gewesen, aber der so Gefragte sagte nichts. Die Journalistin wiederholte ihre Frage, aber der Dichter sagte noch immer nichts, bis er in seine Manteltasche griff, ein Buch von Maurice Blanchot herauszog, und damit begann, die Seiten herauszureißen und sie sich in den Mund zu stopfen.
Ich will nicht, dass Sie das lesen, wenn wir nachher miteinander im Bett liegen, sagte er dann; denn ich liebe Sie ja nicht. Und damit gab er die einzig mögliche Antwort also doch (abgesehen davon, dass er sich eine Ohrfeige einfing und später mit niemandem im Bett lag, das Buch also nicht hätte aufessen müssen).
Wer, wann, was und warum spielen hier keine Rolle, das wäre nur reiner Informationsfluss, folglich: völlig unbedeutend.
Warum ist „mit dem geliebten Menschen“ die richtige Antwort gewesen (wenn auch nicht die einzig mögliche)? Hier geht es nicht um romantische Beseeltheit, das steht fest. Das ganze Prozedere hat egoistische Gründe, denn auch die Liebe ist egoistisch, sie ist außerdem verschwörerisch, unduldsam, herrschsüchtig, sie ist ein Rausch des Exzesses. Und sie beruht auf Projektion. Wie die Literatur. Im besten Fall denkt man das, was man liest. Und man fühlt das, was man liebt. Fühlt man das, was man liest und denkt das, was man liebt, sind die Unterschiede kaum mehr auszumachen. Sie münden vielleicht in der Auseinandersetzung mit dem eigenen Werk, das ist alles.