Weiße Villa in Petzow

Brigitte Reimann war da, Maxie und Fred Wander auch, Reiner Kunze, Günter de Bruyn, Heinz Knobloch, Karl Mickel und viele andere Schriftstellerinnen und Schriftsteller: Der malerisch am Schwielowsee bei Werder gelegene Ort Petzow war begehrter Schreibort und gern erinnertes Refugium. Die weiße Villa mit den drei Pappeln übte eine Faszination auf Schreibende aus. Gleichzeitig Erholung und eine besondere Arbeitsatmosphäre zu finden, das ermöglichte hier von 1955 bis 1990 ein Schriftstellerverband, der sich erst „deutscher“ nannte und seit 1973 „der DDR“. Die erschwinglichen Preise auch für Familienangehörige und eine gastfreundliche Bewirtung waren die äußeren Bedingungen. Eine wachsende Kollegialität und der unzensierte Austausch auch kontroverser Meinungen sorgten für ein seinerzeit nicht selbstverständliches geistiges Fluidum.
Ein kundiger Herausgeberkreis hat aus den in Petzow verfassten oder von Petzow inspirierten Texten eine einzigartige Anthologie zusammengestellt. Namen wie Georg Maurer und Rainer Kirsch, Jens Gerlach, Werner Liersch und Gisela Steineckert, Walter Kaufmann und Matthias Biskupek, Elfriede Brüning und Christa Kozik bürgen für literarisch kostbare Zeugnisse vom Erlebnis ihres Hierseins. Briefe stehen neben Tagebuchauszügen, Gedichte neben kurzen Prosastücken, Beschreibungen des Augenblicks neben nachträglichen Betrachtungen, illustriert von Fotos und Dokumenten wie dem Gästebuch der ersten fünf Jahre des Schriftstellerheims aus dem Besitz von Gerhard Wolf. Dies alles fügt sich zu einem Bild, das die kreative Arbeitskonzentration, fruchtbare Kommunikation und Erholungsmöglichkeit für Generationen von Schriftstellerinnen und Schriftstellern beschreibt. Auf diese Weise steht Petzow als Metapher für die Umstände des Wachsens und Gedeihens von Literatur – einer Literatur, die erinnernswert bleibt, weil sie lebhaft und lebendig auf Zeitumstände reagierte.
Klaus Hammer gibt auf Literaturkritik.de Einblicke in das Buch:
„In die Gedanken eines Schriftsteller-Gastes in Petzow, die diesem so beim Schreiben durch den Kopf gehen, versetzt sich Bernd Rump: „Wir standen also da, nein, davon gibt es wirklich kein Protokoll, obwohl auch einer dabei war, der solche Protokolle schrieb, standen da und redeten über Geist und Macht und darüber, warum das, was wir doch wussten, so einflusslos war, als wären wir überhaupt nicht da“. Es geht um den Dichter Ossip Mandelstam, der ein Gedicht über Stalin verfasste, das ihm 1939 das Leben kostete, es geht um Bulgakows satirischen Roman „Meister und Margarita“, es geht um Stalin selbst, der sich als Traumgast in Petzow einstellt. Hartmut Zenker widmet sein Gedicht „Sommertag in P.“ Volker Braun, Rainer Kirsch hat zwei Petzow-Gedichte verfasst, Adel Karasholi betrachtet Petzow-Fotos und reflektiert über den „Verrat“ an den eigenen Gedichten, denn jede Übersetzung sei „in irgendeiner Weise ein Verrat am Original“. Matthias Biskupek nennt Petzow den „eigentlichen DDR-Literatur-Erinnerungs-Hort“: „Denn viele der am Schwielowsee gefertigten Texte mancher unserer Kollegen mochten das Bestehende immer weniger lobpreisen, da half kein fließendes Wasser, kein stiller See und kein Nachmittagskuchen“. Wiederum berichtet Bernd Schirmer in einer „Erzählung in der Erzählung“ über das Schicksal seiner Erzählung „Der Film“, die er Ende der Siebzigerjahre in Petzow geschrieben und die nie das Licht der Öffentlichkeit erblickt hat.““
Margrid Bircken / Christel Hartinger (Hg.): Petzow – Villa der Worte. Das Schriftstellerheim in Erinnerungen und Gedichten. vbb Verlag für Berlin-Brandenburg, Berlin 2016.

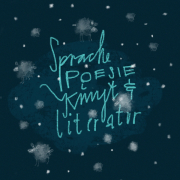

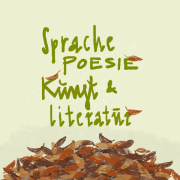
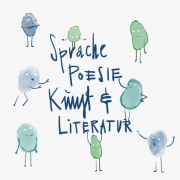
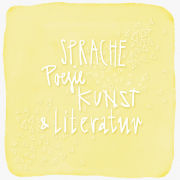
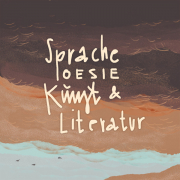
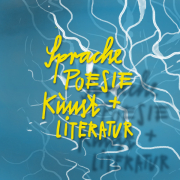
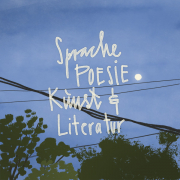
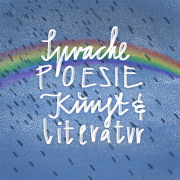
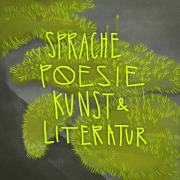
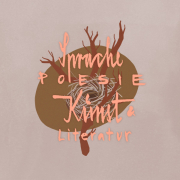
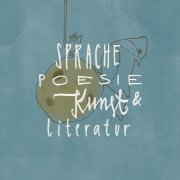
Neuen Kommentar schreiben