Die Preisträger*innen | 16. Feldkircher Lyrikpreis
Die Jury, Thomas Amann, Petra Ganglbauer, Marie-Rose Rodewald-Cerha und Andreas Schumann, hat heute Abend im Theater am Saumarkt in Feldkirch ihre Entscheidung bekannt gegeben.
David Fuchs wird mit dem 16. Feldkircher Lyrikpreis ausgezeichnet.
Der 2. Preis geht an Bastian Schneider, der 3. Preis an Manuela Bibrach.
Wir gratulieren allen Preisträger*innen sehr herzlich!
 Daniel Fuchs © Daniela Fuchs David Fuchs
Daniel Fuchs © Daniela Fuchs David Fuchs
geboren 1981 in Linz, ist Autor und Arzt. Er arbeitet nach dem Studium in Wien als Onkologe und Palliativmediziner wieder in Linz, ist verheiratet und Vater von zwei Kindern.
Er schreibt Prosa und Lyrik, hat die Leondinger Akademie für Literatur absolviert und in der Folge in Zeitschriften und Anthologien veröffentlicht (u.a. Volltext, erostepost, poetin, Die Rampe, & radieschen). 2016 hat er den FM4 Wortlaut gewonnen und 2018 seinen Debütroman „Bevor wir verschwinden“ bei Haymon veröffentlicht. www.davidfuchs.at.
Laudatio von Thomas Amann
Es muss nicht zwangsläufig Ziel eines Autors, einer Autorin sein, eine Sprache für das zu finden, was sich dem Sagbaren entzieht. Es kann aber mit Sicherheit behauptet werden, dass das weite, zuweilen durchaus unabsehbare Feld, das sich zwischen den Grenzmarken „Sprachverlust“ und „Sprachfindung“ erstreckt, den beständigsten und wohl am meisten durchwachsenen Blickfang für das schreibende Auge darstellt. Ein sich stets verschiebender Akkommodationspunkt. Und Landvermessung – eine Angelegenheit mithin der Sprache.
Wenn ein Autor auf einem solchen Areal Fuß gefasst und mit fast schlafwandlerischer Sicherheit im Geflecht der Sprache seine Orte ausfindig gemacht hat, erregt das Aufmerksamkeit.
Ein solcher Autor ist David Fuchs.
David Fuchs hat mit seinem „handbuch der pflanzenkrankheiten“ einen Gedichtzyklus vorgelegt, der Sprachfindung auf überzeugende und höchst eigenständige Weise auf der Spur ist, und das auf einem Boden, der nährstoffarmer vielleicht gar nicht sein könnte. Denn in den Gedichten angedeutet: einschlägiges Interieur und Tätigkeiten, die dem überwiegend medizinisch konnotierten Umfeld entstammen. Und so spricht aus dieser Lyrik auch etwas Kränkliches, Bleiches, trotz der sich (auch unausgesprochen) durch den Zyklus ziehenden – mehr vegetierenden, als wuchernden – Pflanzenwelt, etwas Wurzelloses. An ihren Verankerungen gekappt treiben die Dinge, von denen in den Gedichten die Rede ist (und auch Menschliches gehört zu diesen Dingen), seltsam überbestimmt auf einer wie weiß gewordenen, unheimlich ruhigen, sterilen Oberfläche. Es ist eine überbelichtete Szenerie und (Sprach-)Welt, auf die man allenthalben in diesen Gedichten stößt, eine Grelle, die die Dinge erfasst und sie eigenartig fremd entrückt, abgezogen, abgetrennt von ihren lebendigen Formen erscheinen lässt („finger, därme, brüste, ein / herz“). Die dabei erzielte Sterilität der Sprache (das Grelle) lässt nur umso mehr die Fremdartigkeit des Organischen, oder: Angedeutet-Organischen einzelner Begriffe inmitten dieser ebenen, keimfreien Sprachwelt aufleuchten, bestrahlt sie mit einem Licht, das nicht so sehr dazu bestimmt zu sein scheint, sichtbar zu machen, sondern (ohne jeglichen Voyeurismus) bis auf die Haut zu entblößen, die letzten (oder sind es nicht vielmehr die vorletzten?) Dinge in ihrer Nacktheit aufscheinen zu lassen.
So wirkt alles wie durch eine dünne, zarte, durchsichtige Haut empfunden und in Sprache gefasst. Und jedes einzelne Gedicht selbst scheint von einer Haut überzogen. Von einer Haut allerdings, die nicht Stratum / Ausdruck einer von ihr umhüllten Lebendigkeit oder Üppigkeit ist (das Obst, das hier und da herbeizitiert wird, würde das eigentlich vermuten lassen), sondern vielmehr eine brüchige, durchsichtige Membran bildet, die die geisterhaft letzte Grenze zu einem im Unbestimmten gelassenen Unter-, Hinter- oder Ungrund zu sein scheint. So haben auch die Pfirsiche im Gedicht peach yellow nichts von einer sonst mit ihnen assoziierten Saftigkeit an sich, das Zitroneneis in wassersucht (oedema) ruft keinen Sommer hervor, und im darauf folgenden Gedicht droht bereits der Frost (voraussage der fröste). Selbst die angedeuteten Farben (es sind nicht viele) bedingen keine Pracht oder Fröhlichkeit. Schale, asphodelische Ruhe hat sich breitgemacht.
Von Obst ist in diesen Gedichten also die Rede, von Pflanzen, von Gehölz. Von Tätigkeiten, Materialien, die – es wurde angedeutet – als solche im Umfeld von Krankenanstalten anzutreffende zu erkennen sind. Von Menschen ist die Rede, allerdings wie von geisterhaften Wesen (und selbst die Kinder im Gedicht peach yellow scheinen nur Dämmerwesen zwischen Schlaf und Wachen oder Wachen und Schlaf, ein Geisterzug mit Auftrag – und wer vermag zu sagen, ob der Schlaf nicht eine lange Schlaflosigkeit gewesen ist oder sein wird, und ob der Blick, der aus diesen Gedichten spricht, oder: der sich in diesen Gedichten ausspricht, nicht selbst ein schlafloser Blick ist). Von Krankheiten ist die Rede, vom Tod. Alles so konkret und doch nicht explizit. Alles vor Augen und doch seltsam in die Ferne gerückt.
Das Aneinanderprallen von teilweise simplen, teilweise spröden, zumeist knappen sprachlichen Äußerungen bedingt ein Reibungsfeld, aus dem Funken schlagen, die das Ausgedrückte überschreiten, das Konkrete des Ausgedrückten als Entladung in ein Reich des Zwischen katapultieren.
In diesem Zwischen, hinter all diesen Gedichten spürt man etwas Unsagbares, etwas erschreckend Unpersönliches, Auslöschendes. Und doch schafft es das sprachliche Gefüge der Gedichte, das Schwinden angesichts einer penetranten, gleichmachenden Aufhellung, mithin das Schwinden von Sprache selbst, wenn nicht auf-, so doch überzeugend einzufangen. Nicht nur darum gehen einem die Gedichte aus David Fuchs' „handbuch der pflanzenkrankheiten“ nah und unter die Haut – „bisweilen / bis ins fleisch“.
Ab morgen stellen wir Ihnen die ausgezeichneten Gedichte in unserer Rubrik "Text des Tages" vor. Herzliche Grüße nach Feldkirch. Feiert schön!

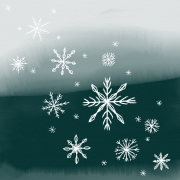


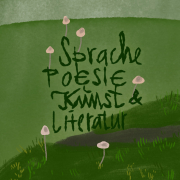
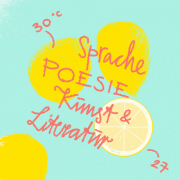
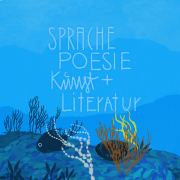
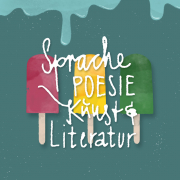
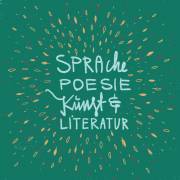
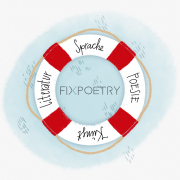
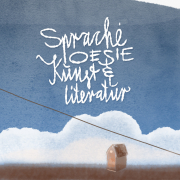
Neuen Kommentar schreiben