 „Nights of poetry and poses“ – Larry Blocks Matthew Scudder (Teil 1)
„Nights of poetry and poses“ – Larry Blocks Matthew Scudder (Teil 1)
Wenn es einen Autor gibt, der im Genre der Alkohol-Detektive den Standard setzt, dann ist das Lawrence „Larry“ Block, der hier zwei Folgen einnehmen wird. Seit mehr als 35 Jahren und in bisher 17 Romanen schickt er seinen Ermittler Matt Scudder nicht nur durch New York, sondern auch durch alle Stadien, Fegefeuer und Höllen der Alkoholsucht.
In diesem Text wird das in vielen Zitaten belegt, außerdem steht eine Begegnung an mit Dave Van Ronk, dessen Leben die Coen-Brüder gerade verfilmt haben. Verkörpert von Liam Neeson wird auch Scudder bald im Kino zu sehen sein, „A Walk Among the Tombstones“ ist abgedreht. Larry Block, Drehbuchautor des verunglückten Wong Kar Wai-Films „My Blueberry Nights“ (2007), sieht das Verhältnis von Film & Buch gelassen: „Meine Bücher finden Sie im Regal, und zwar ganz und unverhunzt.“
Der in Hell’s Kittchen geborene Scudder ist der legitime Erbe von Matt Cordell, er teilt nicht nur den Vornamen mit Ed McBains Gossendetektiv aus den 1950ern (siehe „The Gutter and the Grave“ in Teil IV). Matt Scudder betrat 1976 mit „The Sins of the Fathers“ die Bühne, verfiel von Buch zu Buch, ehe er realisierte, dass er nur überleben würde, wenn er sein Trinken aufgibt. Dass das nicht von heute auf morgen geht, das lernen wir mit Scudder. Immer wieder verlässt Block in seiner Serie die Zeitlinie, kehrt zu bestimmten Stadien zurück, so auch im bisher letzten Scudder-Roman „A Drop oft he Hard Stuff“ von 2011, wo eine buchlange Rückblende in die (internetlose) Zeit von 1975 führt. Für die kontinuierlichen Block-Leser kam es wie ein Schock, wieder in die Frühzeit Scudders versetzt zu werden, als er sich von einem Treffen der Anonymen Alkoholiker (AA) zum nächsten hangelte: „There’s no charge for the seats in an AA room“, sagt er einmal reuevoll in „Drop“, denn: „You pay for them in advance.“
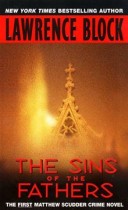 Der ungemein produktive Block schreibt seit etwa 1960, hat neun Edgars, zwölf Shamus Awards, vier Anthonys und etliche andere Preise vorzuweisen, die Anzahl seiner Kriminalromane liegt bei über 60, dazu kommen fünf Bücher übers Schreiben, „Liar’s Bible“ das letzte (2011), „Spider, Spin Me a Web“ (1987) das vorletzte. Block ist kein Freund einer metaphernreichen oder sonderlich poetischen Sprache, aber er ist ein guter Geschichtenerzähler. Er kann auch Pornographie, ältere Titel hat er im Selbstverlag wieder aufgelegt, „Getting Off“ (2012) war das nicht ganz jugendfreie Porträt einer männerverschlingenden Serienmörderin, noch das wunderbare, voluminöse und großartige New-York-Porträt „Small Town“ hat einen Polizeichef mit „kinky tastes“.
Der ungemein produktive Block schreibt seit etwa 1960, hat neun Edgars, zwölf Shamus Awards, vier Anthonys und etliche andere Preise vorzuweisen, die Anzahl seiner Kriminalromane liegt bei über 60, dazu kommen fünf Bücher übers Schreiben, „Liar’s Bible“ das letzte (2011), „Spider, Spin Me a Web“ (1987) das vorletzte. Block ist kein Freund einer metaphernreichen oder sonderlich poetischen Sprache, aber er ist ein guter Geschichtenerzähler. Er kann auch Pornographie, ältere Titel hat er im Selbstverlag wieder aufgelegt, „Getting Off“ (2012) war das nicht ganz jugendfreie Porträt einer männerverschlingenden Serienmörderin, noch das wunderbare, voluminöse und großartige New-York-Porträt „Small Town“ hat einen Polizeichef mit „kinky tastes“.
Blocks erste erfolgreiche Bücher waren seine Evan-Tanner-Romane, sie firmierten als „international intrigue novels with crime/comic overtones featuring a half-crazed Korean War vet who doesn’t sleep because of a shrapnel wound in his brain“ (zum Thema Kriegsveteranen siehe auch Teil III und Teil IV). Außerdem gibt es Romane mit Paul Kavanagh, gibt es den Auftragskiller Keller und, eher leichtfüßig, die Abenteuer des philosophierenden Einbrechers Bernie Rhodenbarr, der für einige wunderbare Buchtitel Schmiere stand.
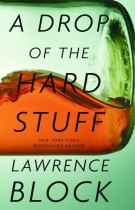 Stufe für Stufe aus der Alkoholhölle
Stufe für Stufe aus der Alkoholhölle
In der 200. Ausgabe von „American Heritage“ antwortete Lawrence Block auf eine Umfrage nach den über- bzw. unterschätztesten fiktionalen Privatdetektiven:
„My nominee for that slot would be a fellow named Matthew Scudder, the creation of a writer who shall remain, uh, nameless. I’ll tell you, if I were going to hire a private eye, Scudder’s the last one I’d pick. He’s either drunk or going to AA meetings, which leaves him with precious little time for work. His girlfriend’s a hooker, and his best buddy is a career criminal and multiple murderer. And he does weird things: In one book he clears his client of a murder the man really did commit, then frames him for one he didn’t have anything to do with. Who in his right mind would have anything to do with a guy like that? “
Block, der sich über seine Trinkervergangenheit – anders als James Lee Burke (dem hier noch eine eigene Folge gewidmet sein wird) – ziemlich ausschweigt, lässt Matthew Scudder die zwölf Stufen des AA-Programms vor und (wie es dem Suchtverlauf ja oft entspricht) auch rückwärts deklinieren. „Step by Step“ betitelte Block seine 2009 erschienenen Memoiren und meint damit nicht nur seine jahrzehntelange Leidenschaft für „racewalking“, bei uns schlicht Gehen genannt, das er in Marathon-Ausmaßen betreibt. Er meint darin: „When you get older, keeping the private stuff private seems less important … When I stopped drinking 30 years ago, I began attending meetings of a group of like-minded individuals, and over the years this Sunday gathering had become my regular weekly meeting.“
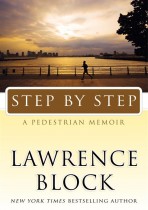 Eine der wenigen Äußerungen Blocks zu seiner eigenen Nähe zum Alkohol stammt von 1991, aus dem Nachwort zur Wiederauflage des ersten Scudder-Romans „The Sins of the Fathers“. Über seinen alkoholsüchtigen Ermittler schreibt er dort:
Eine der wenigen Äußerungen Blocks zu seiner eigenen Nähe zum Alkohol stammt von 1991, aus dem Nachwort zur Wiederauflage des ersten Scudder-Romans „The Sins of the Fathers“. Über seinen alkoholsüchtigen Ermittler schreibt er dort:
„When we started out he and I had certain things in common. I, too, was living on West Fifty-seventh Street between Eighth and Ninth Avenues. I, too, was recently separated from my wife and children. Like him, I spent a lot of time in the neighborhood gin joints, and much of it at Armstrong’s.“
In einer Kolumne für Writer’s Digest meinte er über Scudder: „I let him hang out in the same saloon where I spent a great deal of my own time. I was drinking pretty heavily around that time, and I made him a pretty heavy drinker, too. I drank whiskey, sometimes mixing it with coffee. So did Scudder.“
Eine Session mit Dave Van Ronk
Spätestens ab dem 5. Dezember 2013 wird ein alter Freund und Kneipenkumpan Blocks auch bei uns etwas bekannter werden, nämlich wenn der neue Film der Coen-Brüder bei uns in die Kinos kommt. „Inside Llewyn Davis“ ist angelehnt an die Lebensgeschichte des amerikanischen Gitarristen, Sängers und Songschreibers Dave Van Ronk (1936–2002). Seine Autobiografie „Der König von Greenwich-Village“ erschien im April 2013 im – für so etwas dankenswerterweise überaus wachen – Heyne-Verlag (Originalausgabe The Mayor of Macdougal Street, Da Capo Press 2006).
Der New Yorker Van Ronk war ein Mentor des frühen Bob Dylan und von Joni Mitchell, einer der treibenden Kräfte des Folk- und Blues-Revivals der 1960er, eine Größe im Greenwich Village, einer, der den Reverend Gary Davis ebenso in seine Musik einbrachte wie die Brechtsongs von Kurt Weill. Am 28. Juni 1969 war er einer von 13 Inhaftierten von „Stonewall Inn“, ein wichtiger Fixpunkt der internationalen Schwulenbewegung. Sein Bühnenmarkenzeichen, um beim Trinken zu bleiben, war lange Jahre ein Steinkrug für „Tullamore Dew“. Sein Song „Last Call“ hatte einen großen Auftritt in Blocks „When the Sacred Ginmill Closes“ und stand auch für den Titel gut. (Bei uns auch hin und wieder als „Gedicht“ nachzulesen)
Dem Übersetzer bin ich versucht, einen auszugeben, der aus „When the Sacred Ginmill Closes“ ein „Nach der Sperrstunde“ machen musste. Prosit, Sepp Leeb! Und nochmal einen Strich auf meinen Deckel für die 1987 in Heynes Blauer Reihe notwendigen Eindeutschungen der Songtexte von Dave Van Ronk, der in dem Roman über IRA-Schutzgelder und Betrügereien im engen Milieukreis eine Rolle spielt. Hier das Motto des Romans, eine Van-Ronk-Strophe:
„Und so verbrachten wir also wieder eine Nacht
Voller Poesie und Posen
Und jeder weiß, er wird alleine sein,
Wenn die heilige Schnapsbudike schließt.“
Im Original hört sich das so an:
„And so we’ve had another night
Of poetry and poses
And each man knows he’ll be alone
When the sacred ginmill closes.“
Heilige Schnapsbudike statt der „sacred ginmill“
Heilige Schnapsbudike, darauf muss man erst mal kommen. Die Kneipe in Blocks „Nach der Sperrstunde“ ist das Morrisseys, wo die Fenster schwarz gestrichen sind. Eigentlich sollte sie mal „Hufeisen und Handgranten“ heißen, weil es nur bei denen zählt, wenn man nah dran ist. Es ist die Stammkneipe der Iren im Viertel, und sie wird ausgeraubt. Scudder sitzt dort gerne zu vorgerückter Stunde, weil die offizielle Sperrstunde für Bars in New York vier Uhr früh ist, es sich bei Morrisseys aber um ein illegales Etablissement handelt, im ersten Stock eines Ziegelbaus in der Fifty-first Street zwischen Eleventh und Twelfth Avenue gelegen, gut besucht auch von Polizisten übrigens. Scudder sitzt da mit dem Barkeeper von Armstrong’s an zwei zusammengerückten Tischen, beobachtet genau, was ausgeschenkt wird, und weiß auch genau, was im Angebot ist:
„Ich trank Bourbon, und zwar mußte es sich dabei entweder um Jack Daniel’s oder Early Times gehandelt haben, da dies die einzigen Bourbonsorten waren, die die Morisseys führten. Sie hatten auch noch drei oder vier Scotches, Canadian Club und jeweils eine Sorte Gin oder Wodka. Zwei Biere, Budweiser und Heineken. Einen Cognac und ein paar komische MIxgetränke. Unter anderem auch Kahlúa, nehme ich an, da in diesem jahr Black Russions stark en vogue waren. Drei Sorten irischen Whiskey, Bushmill’s, Jameson und eine Marke, die sich Power‘s nannte; ich hatte das Zeug nie jemanden bestellen sehen …“
Dann wird die Kneipe überfallen, die Kasse ausgeraubt. Die Morisseys geben zum Trost eine Hausrunde aus. All das liegt einige Zeit zurück. Es war im Sommer 1975, als Ford noch Präsident war. Scudders Welt war in dieser Zeit „wie von einer unsichtbaren Macht gesteuert so weit zusammengeschrumpft, daß sie nur noch aus ein paar Blocks rund um den Columbus Circle bestand. Nach zwölf Jahren Ehe hatte ich meiner Frau und meinen zwei Söhnen den Rücken gekehrt und war in ein Hotel gezogen …“ Scudder, der lizenzlose P.I., hält sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser, säuft sich durch Bars. „Meistens hatte ich schon gegen zwei die notwendige Bettschwere, und wenn ich hin und wieder auch mal aushielt, bis die betreffende Bar gerade zumachte, so machte ich doch nur in den seltensten Fällen mal eine Nacht durch.“ Block gibt das alles Gelegenheit zu einer kleinen Kneipentour quer durch New York. Ross Thomas, mit dessen „Dämmerung in Mac’s Place“ das hier alles anfing (siehe Teil I) dürfte das gefallen haben; wir erfahren, dass O’Neal’s Baloon gegenüber dem Lincoln Center so heißt, weil ein altes Gesetz besagt, dass ein Lokal sich nicht Saloon nennen darf, das Schild aber schon fertig gemalt war und eben nur der erste Buchstabe ausgetauscht wurde.
In einer Bar kommt er mit Carolyn Cheatham ins Gespräch, sie trinkt „Amaretto mit Eis, einen süßlichen Mandellikör, der wie ein flüssiges Dessert schmeckt, aber fast so stark wie Whiskey ist … Wir kamen beide überein, daß sie ein wenig zu schnell trank. Und gerade dieses Zeug war in dieser Hinsicht besonders heimtückisch, hielt sie sich selbst vor. Dieses miese Gesöff von Amaretto paßte genau zu einer Stadt wie New York. Das war nicht wie der Bourbon, mit dem sie groß geworden war. Mit Bourbon wußte man wenigstens wie man dran war. Ich machte sie darauf aufmerksam, daß ich ein ausgesprochener Bourbonliebhaber war, was sie erfreut zur Kenntnis nahm. Es hat wohl so manches Bündnis auf belangloseren Gemeinsamkeiten gefußt; jedenfalls besiegelte sie das unsere mit einem Schluck aus meinem Glas.
„Bourbon ist eher ein bißchen vulgär“, erklärte sie darauf. „Wenn du weißt, was ich meine.“
„Ich dachte immer, es wäre das Getränk für echte Gentlemen.“
„Eher für den Gentleman, der sich mal in die Gosse begeben will. Zu dreiteiligen Anzügen mit Krawatten und teuren Privatschulen paßt schon eher Scotch. Bourbon ist eher für einen alten Knaben, der mal die Sau rauslassen will. Bourbon paßt zu einer stickig heißen Nacht wie dieser, wenn es einen nicht stört, daß einem der Schweiß in Strömen runterrinnt.“
Um es mit Thomas Wolfe zu sagen: „You can’t go home again“
„Weißt du, was mein Problem ist“, sagt Scudder, klarsichtig, in der Mitte des Buches dem Barkeeper Billie zu später Stunde, „ich kann nicht nach Hause gehen.“
„Tja, das hat doch auch Thomas Wolfe gesagt: ‚Du kannst nicht mehr nach Hause gehen‘: Das ist unser aller Problem.“
„Ich meine das vollkommen ernst … Anstatt nach Hause zu gehen, wie das jeder halbwegs vernünftige Mensch getan hätte, trudle ich wie so’ne verdammte, besoffene Brieftaube wieder hier ein.“
„Jetzt mach aber mal einen Punkt, Matt. Du bist doch ein prima Kerl, ein normal fühlendes menschliches Wesen. Eben auch nur so ein armer Schlucker, der nicht allein sein will, wenn die heilige Schnapsbudike schließt.“
„Die was?“ Ich fing zu lachen an. „Soll das hier etwa die heilige Schnapsbudike sein?“
„Kennst du den Song nicht?“
„Was für einen Song?“
„Diesen Song von Dave Van Ronk. ‘Und so verbrachten sie also wieder eine Nacht –“ Er brach ab,. „Scheiße, ich kann einfach nicht singen; nicht mal die Melodie kriege ich richtig hin. ‚Letzter Aufruf‘ Von Dave Van Ronk. Kennst du das Lied nicht?“
„Wovon redest du eigentlich die ganze Zeit?“
„Das Lied mußt du dir auf jeden Fall anhören. Auf alle Fälle. Das ist es doch, worüber wir schon die ganze Zeit reden, und außerdem ist das meine Nationalhymne, wenn du’s genau wissen willst. Komm mit.“
Er nimmt Matt mit in seine Wohnung, hält die Schallplatte hoch.
„Hier. Dave Van Ronk. Schon von ihm gehört?“
Larry Block, der mit Van Ronk befreundet war, lässt seinen Matt Scudder den Kopf schütteln:
„Hat einen holländischen Namen, sieht aus wie ein Ire und hört sich auf den paar Bluesnummern wie ein waschechter Nigger an. Spielt übrigens auch hervorragend Gitarre. Bei dem Stück spielt er allerdings gar nichts. ‚Letzter Aufruf.‘ Er singt das al fresco.“
„Na wunderbar.“
„Nicht al fresco. Wenn ich mir diesen Ausdruck doch nur mal merken könnte. Wie heißt das, wenn man ohne Instrumentalbegleitung singt?“
Van Ronks „Last Call“ – der vollständige Text
Und dann hören sie. Ein paar Mal. Scudder wird ihn wieder aufsuchen, weil er ihm die Platte vorspielen muß. Ich verzichte hier auf die deutsche Übersetzung, stattdessen die Lyrics im Original, und auch nochmal den Absatz von oben:
„Got a Dutch name, looks like a mick and I swear on the blues numbers he sounds just like a nigger. He’s also one bitchin‘ guitar player but he doesn’t play anything on this cut. ‘Last Call.’ He sings it al fresco …“
And so we’ve had another night
Of poetry and poses
And each man knows he’ll be alone
When the sacred ginmill closes.
The melody sounded like an Irish folk air. The singer did indeed sing without accompaniment, his voice rough but curiously gentle.
„Now listen to this,“ Billie said.
And so we’ll drink the final glass
Each to his joy and sorrow
And hope the numbing drunk will last
Till opening tomorrow.
„Jesus,“ Billie said.
And when we stumble back again
Like paralytic dancers
Each knows the questions he must ask
And each man knows the answer
I had a bottle in one hand, a glass in the other. I poured from the bottle into the glass. „Catch this next part,“ Billie was saying.
And so we’ll drink the final drink
That cuts the brain in sections
Where answers do not signify
And there aren’t any questions
 Billie was saying something but the words weren’t registering. There was only the song.
Billie was saying something but the words weren’t registering. There was only the song.
I broke my heart the other day
It will mend again tomorrow
If I’d been drunk when I was home
I’d be ignorant of sorrow
„Play that again,“ I said:
„Wait. There’s more.“
And so we’ll drink the final toast
That never can be spoken:
Here’s to the heart that is wise enough
To know when it’s better off broken
He said, „Well?“
„I’d like to hear it again.“
Kein Glas bereuen, aber auch keines mehr anrühren
Es regnet das ganze Wochenende. Scudder verliert den Überblick, wie viele Flaschen er schon gekillt hat.
„If I’d been drunk when I was born“, geht ihm durch den Kopf.
Aber er löst den Fall, überlebt alles. Auf den letzten beiden Seiten schließt sich die große Rückblende.
„Ich trinke nichts mehr und verkehre dementsprechend auch nicht mehr in Schnapsbudiken, seien sie nun heilig oder profan. Ich verbringen weniger Zeit damit, Kerzen anzünden, und halte mich stattdessen mehr in den Kellerräumen von Kirchen auf, wo ich meinen Kaffee ohne Bourbon trinke und aus Styroporbechern … Ich gehe oft zu den AA-Treffen … Vor zehn Jahren habe ich ständig getrunken und jetzt trinke ich überhaupt nicht mehr. Ich bereue nicht ein Glas, das ich in mich hineingeschüttet habe, aber ich hoffe bei Gott, daß ich nie wieder eines anrühren werde.“
Ein Eintrag aus Blocks Blog vom April 2013:
„Last night I paid my third visit to the set of A Walk Among the Tombstones, currently filming with Liam Neeson starring as Matthew Scudder. My first visit was to a Delancey Street diner, where I watched them film Scudder in conversation with TJ. Then Friday I went to a crumbling mansion in the Whitestone section of Queens—Yuri’s house—for a phone call between Matt and bad-guy Ray. And last night we were in Brooklyn’s Green-Wood Cemetery for Matt’s confrontation with Ray and his equally unpleasant pal.“
Fortsetzung folgt: als nächstes Larry Blocks Matthew Scudder, Teil 2, und dann Crumleys schräge Vögel, James Lee Burkes Dave Robicheaux, Westlakes Dortmunder und andere mehr. Es wird wohl insgesamt ein dreckiges (Artikel-)Dutzend werden.
Alf Mayer
Hier geht es zu Teil I, Teil II, Teil III, Teil IV, Teil V, Teil VI und Teil VII. Mehr zu Lawrence Block bei facebook und bei kaliber.38.











