Zeit wirds immer
 Christian Geissler
Christian Geissler
„Manchmal atmen die Literaturkritik und die Literaturwissenschaft auf, wenn ein Autor nach seinem Tod nach und nach in Vergessenheit gerät. Etwas komplizierter verhält sich der Fall bei dem vor fünf Jahren gestorbenen Christian Geissler. Werke wie „Das Brot mit der Feile“, „Wird Zeit, dass wir leben“ und der heftig diskutierte Roman „kamalatta“ von 1988 riefen zwar im Feuilleton Kritiker der vorderen Reihe auf den Plan. Dennoch wurde der Autor ab den neunziger Jahren vom Literaturbetrieb zunehmend wie ein toter Hund behandelt.
Das lag zum einen an ihm selbst und seiner sperrigen Haltung gegenüber diesem Betrieb, auch wenn Christian Geissler ein sehr freundlicher und nachgerade höflicher Mann war, ein unerschöpflich aufmerksamer Zuhörer zumal. Zum anderen lag es aber daran, dass das Feuilleton nicht nur mit der radikalen politischen Position des Autors Schwierigkeiten hatte, sondern mehr noch vor seiner radikalen ästhetischen Position kapitulierte. Geissler galt als hermetisch, und irgendwann war man froh, sich nicht mehr mit ihm auseinandersetzen zu müssen.
Die Literaturwissenschaft hat gar nicht erst mit dieser Auseinandersetzung begonnen, mit der rühmlichen Ausnahme von Sven Kramer, der in Lüneburg Neuere deutsche Literatur lehrt und seinem Fach bescheinigt, es habe Geisslers Werk aus der deutschen Literaturgeschichte praktisch ausgegrenzt. Trotzdem hat sich jetzt der Berliner Verbrecher Verlag, seit jeher bekannt für verdienstvolle tollkühne Unternehmen, entschlossen, eine Werkauswahl von Christian Geissler zu publizieren. Begonnen hat sie mit dem Roman „Wird Zeit, dass wir leben“ von 1976, an dem man sehr schön sehen kann, wie weit Geisslers Ästhetik von dem erzählerischen Biedermeier entfernt war, das heute unsere Literatur dominiert.“ Jochen Schimmang am 13.01.2014 in der taz.
*
Das Schicksal von Christian Geissler im „Literaturbetrieb“ ist kein Sonderfall einer fernen Vergangenheit. Man findet hunderte Beispiele, sobald man anfängt zu stöbern.
„Versäumnisse und übersehene Autoren gibt es immer. Aber in der schnellen Erstwahrnehmung neuer Bücher ist der Betrieb schon ganz rege. Die wirklich interessanten Probleme liegen auf einem anderen Feld: Es hakt daran, diese ständige Sichtung neuer Bücher und Autoren in mittel- und langfristige Selbstverständnisdebatten zu überführen, die am Literaturbegriff arbeiten.“ befand Dirk Knipphals im März 2012 in der taz.
Die Vorurteile und Pauschalen, die man benutzt, um überhaupt und hinreichend schnell agieren und Autoren abqualifizieren zu können (um sie so letztendlich handsome zu kriegen), sind aber nicht das einzige Problem. Der Betrieb mag keine freien Radikale. Sie stören den Ablauf, verletzen Tabus, sind unbequem, stellen Strukturen in Frage. Der Betrieb selbst grenzt aus und drückt außer Reichweite. Selbst der kleine, überschaubare Lyrikbetrieb ist verkliquisiert und übervölkert mit Künstlern „ die vor lauter Wimpergeklimper und Selbstvernarrtheit nur noch Stipendienanträge verfassen, netzwerken und von keiner Bühne, auf der sie einmal Fuß gefasst haben, wieder herunter zu kriegen sind.“ (Gerhard Falkner). Man macht und tun, drängelt sich um die Schale mit Plätzchen und wedelt mit den Berechtigungsscheinen aus Leipzig | Hildesheim oder mit Vernetzungsnachweisen. Draußen vor der Tür steht womöglich jemand, ders eigentlich drauf hat und wird zehn oder hundert Jahre später entdeckt. (FM)


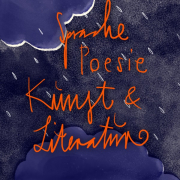

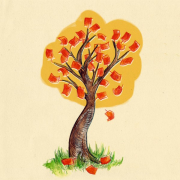




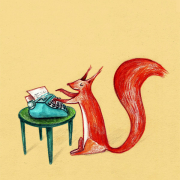
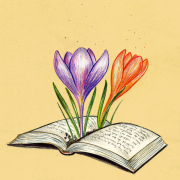

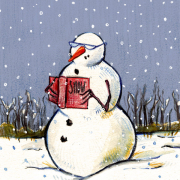
Neuen Kommentar schreiben