Die Unfreiheit der Postmoderne
„Die Postmoderne wurde geboren aus der Verzweiflung, die eine Folge der Übersättigung war. Die Poststrukturalisten beschrieben sie als Erschöpfungserscheinung, in der Annahme, dass jeder Text immer nur ein Cento und ein Palimpsest sei, also die Kombination aus bereits Gesagtem, die auf ein bereits beschriebenes Blatt eingetragen wird. Nicht nur Literatur, das Wissen eines jeden Menschen ist danach eine gigantische Lego-Konstruktion, ein genuin schöpferischer Akt erscheint daher unmöglich. Die Schriftsteller hätten dem entgegenhalten können, der Sinn der Literatur liege darin, eben dieses zu widerlegen: Jedes gelungene Werk sei eine Neuerschaffung der Sprache, und lieber solle sich ein Autor der Lächerlichkeit preisgeben, als in der Sicherheit des Banalen zu verharren. In den Bahnen der Banalität jedoch bewegte sich die Postmoderne nur allzu gerne, was auch ihren Erfolg mit ausmachte. Ihre Autoren fühlten sich beflügelt durch die Lizenz, in den grossen Topf der Literaturgeschichte zu greifen und alles Mögliche miteinander zu kombinieren.
Und die Leser? Wenn der «Tod des Autors» (Roland Barthes) tatsächlich die «Geburt des Lesers» bedeutet, dann ist der Autor für nichts gestorben: Denn der postmoderne Text lässt dem Leser keine Freiheit, im Akt des Verstehens ein gleichberechtigter Partner sein. So kam denn der Autor wieder zurück auf die Bühne – aber bleich und schwach wie der biblische Lazarus. Während er im Jenseits unterwegs gewesen war, hatte er die Fähigkeit zur Selbstreflexion verloren. Er gerierte sich als vormoderner Erzähler, im Unterschied zu diesem aber naiver, als es mittlerweile erlaubt ist.“ Olga Martynova aktuell in der NZZ


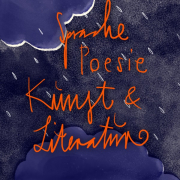

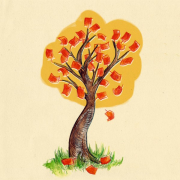




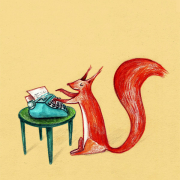
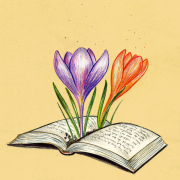

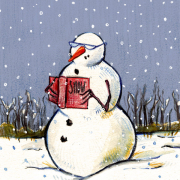
Neuen Kommentar schreiben