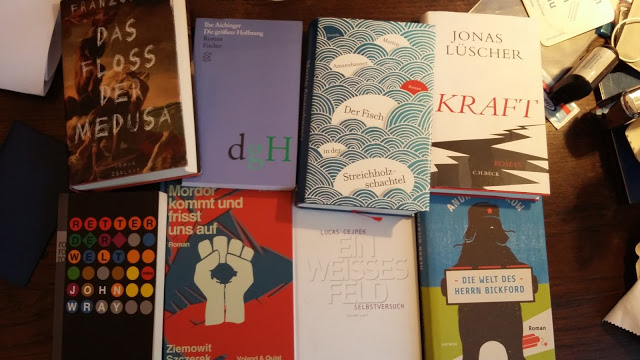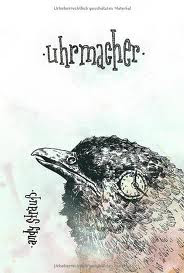Mit „Für die Galerie“ liefert der 1992 geborene Lesebühnen-, Slam- und Reisepoet Yannick Steinkellner sein Debüt ab und legt ein in Wiener-Winter-Grau gehaltens Buch vor. In der Vorrede mit Corona- und Aktualitätsbezug wird das Buch gleichermaßen gerechtfertigt, wie eingeordnet und relativiert. Steinkellner macht sich also – ganz der Tradition der Poetry-Slam-Bühnen-Figur folgend – erst mal ganz klein, um dann ganz groß raus zu kommen, ganz groß raus vorerst aus seiner Mutter. Denn los geht’s mit einem Auftakts-Black und der „Kindheit“- Einblendung. Das hat optisch was von einem Grabstein. Wird hier die Kindheit zu Grabe getragen?, fragt man sich. Nein. Es wird erst mal geboren, krass in die 1990er Jahre und Graz hineingeplatscht. Papa Postler, Mama fetzt und macht in Religion. Dass aus dem Jungen was werden muss, scheint in die 8020-respektive-8010-Wiege gelegt. Und er wird! Er wird zum Blonden mit dem WM-Ball, zum Mannschaftsarbeiter, zum sympathisch-frechen Besserwisser ohne großen Bruder aber mit großen Leidenschaften, der gerne Rolltreppe im Kastner fährt, weil man selbst in einem Konsumtempel (beim Spielkonsolen-Testen) etwas fürs Leben lernen kann: „das der Gewinner bleibt und der Verlierer den Platz räumen muss.“ (S. 27)
Unser Held und Erzähler will natürlich ein Gewinner sein, räumt aber auch ein, schlechte Tag zu haben und besonders schlecht geht’s ihm, wenn es anderen schlecht geht – konkret: seiner Familie. Den Tod seiner Großeltern verarbeitet er in einer Geschichte, die Trauerarbeit sichtbar macht in Form von Satzschleifen, die sich um den Kranz der zu Beerdigenden winden. So kann man literarisch wirkungsvoll mit Trauer umgehen und sie über Satzumwege zum Ausdruck bringen, ohne dabei formelhaft zu werden.
Wir halten zwischenzeitlich fest: Nach dem persönlichen Auftakt in der Vorrede, folgte ein vorwiegend auf Sprachwitz- und Sprachspitzfindigkeiten bauender Text, dann einer, der auf die Emotionen und Erinnerungen abzielte und einer, der die Literarizität syntaktisch bewies. Es folgt eine motivisch gearbeitete Geschichte. Das Küchenradio hält die Familie über mehrere Generationen zusammen. Das ist eine schöne Idee, funktioniert auch wunderbar, man hat die Vorfahren wie nebenbei präsentiert gekriegt und freut sich, nun richtig in deren Geschichten einzutauchen. Aber nein, es platzt der Sport herein.
Selbstbewusst machen sich die Sportgeschichten breit und klar, die knallen und schlagen wieder einen ganz anderen Ton an. Wir sind jetzt bei klassischen Vortragstexten angelangt: Lesebühnen-Prosa-Style mit Wumms und Pow und Peng! Jeder Satz ein Treffer. Warum jetzt Hirscher und Co? Weil's vom persönlichen Bild, das Steinkellner für uns (Für die Galerie) zeichnet, zum allgemeinen Österreich-Bild geht, und das ist nun mal geprägt von Wintersport und Nationalstolz.
Österreich ist Winter, Ski- und Autofahren. Wäre Österreich ein Auto, es wäre ein Puch-Wagerl oder ein Ratrac. Ja, Österreich ist feinfühlig wie ein Ratrac und jahreszeittechnisch ist Österreich ohnehin für immer Winter: mit Schneekanonen, Hüttengaudi, schlechtem Glühwein, Skilehrermentalität und Seilbahnbetreiber-Hybris. Und was macht die Österreicher*innen glücklich? Stockerlplätze (die es in Deutschland nicht mal gibt!). Und was ist die Abfahrt im Sommer? Die Formel 1. Und vor 50 Jahren waren wir da auch noch wer.
Um sein Österreichbild atmosphärisch zu verdichten fährt Steinkellner mit allerlei weiteren Textsorten auf. Da darf es schon auch mal ein Kommentar oder ein Dramolett im Dialekt sein, da hat eine Ballade ebenso Platz, wie Wortspielereien mit Erkenntnisgewinn, da steht Fan-Gesang neben Autobildlyrik.
Das großes Ganze, das hier auf vielen unterschiedlichen Arten gezeichnet wird, ist eine Momentaufnahme des Autors von sich und von Österreich. „Für die Galerie“ ist eine eindrucksvolle Stilrevue. Es ist ein Heimweh-Buch mit ambivalentem Österreich-Bild, denn Österreich verursacht mit seinem Patriotismus und seiner Weltfremdheit, seinem Größenwahn und seiner Gemütlichkeit, aus der Ferne Deutschlands besehen, eben sowohl Bauch- als auch Heimweh.
Yannick Steinkellner zeigt, was er alles drauf hat, lässt die literarischen Muskeln spielen, aber will eben nur spielen oder, um es in seinen Eingangsworten zu sagen: „sich selbst nicht zu wichtig nehmen“. Seine Geschichte wichtiger zu nehmen, das allerdings würde man sich durchaus wünschen und irgendwann dann gerne lesen wollen.