Spritz N° 230

Sprache im technischen Zeitalter Nr. 230, Juni 2019, aus dem Editorial:
Seit einiger Zeit scheint es so zu sein, als würden sich Leserinnen und Leser zunehmend wieder einmal jener Literatur zuwenden, die sich auf das wirkliche Leben beruft. Der 1968 in Oslo geborene Karl Ove Knausgård mit seinem stark autobiographisch geprägten sechsbändigen Zyklus Min kamp (Mein Kampf) steht fast beispielhaft für diese Tendenz der gegenwärtigen Literatur. Aber auch die späte Entdeckung der Französin Annie Ernaux auf dem deutschen Buchmarkt und die großen Erfolge von Didier Eribon oder Emmanuel Carrère sind Ausdruck des Interesses an biographischer Literatur. Wir haben Literaturwissenschaftlerinnen und Literaturwissenschaftler sowie Übersetzerinnen, die sich mit autofiktionalen und ähnlichen Texten beschäftigt haben, gebeten, ihr Interesse an dieser Spielart der Literatur darzulegen. So unterhielten sich die Übersetzerinnen von Ernaux und Carrère über die spezifische Problematik, ein nicht dezidiert fiktives „Ich“ von einer Sprache in eine andere zu übertragen. Die Kulturwissenschaftlerin Hanna Engelmeier beschäftigt sich mit der New Yorkerin Eileen Myles, deren Buch Chelsea Girls nächstes Jahr in Deutschland erscheinen wird. Vincent Sauer schreibt über die literarischen Anfänge von Rainald Goetz, und Samuel Hamen nähert sich dem Thema dieser Ausgabe durch die Beschäftigung mit Texten von Hans Ulrich Gumbrecht und Herbert Kapfer an, die auf unterschiedliche Weise den Ersten Weltkrieg umkreisen, jedoch beide auf vorhandenem Textmaterial basieren. Alexander Bulucz schrieb einen Beitrag, in dem er sich mit Äußerungen von Wolfgang Hilbig zu seinem Schreiben und Leben beschäftigt. Den Abschluss bildet ein Interview mit Kathrin Röggla, die gewissermaßen eine Gegenposition zur Autofiktion einnimmt: Sie spricht davon ein Recherche-Ich zu haben. Das Heft eröffnet Ulf Stolterfoht mit der »rückkehr von krähe«. Im Folgenden stellt Volker Sielaff den tschechischen Lyriker Petr Hruška vor. Last but not least drucken wir die Laudatio, die Jens Bisky auf Angelika Klüssendorf anlässlich der Vergabe des Marie Luise Kaschnitz-Preises der Evangelischen Akademie Tutzing an sie gehalten hat. Auch in ihrem Werk geht es immer wieder darum, wie man das eigene Leben in Literatur verwandelt.

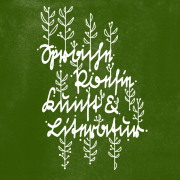


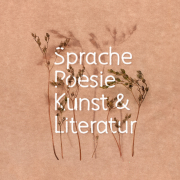

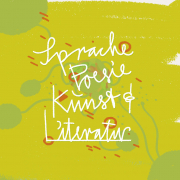
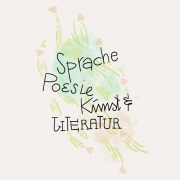
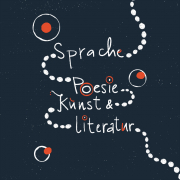

Neuen Kommentar schreiben