Neue Lyrikkritik

Es gibt wieder neue Essays auf lyrikkritik.de – und zwar in der inzestbude:
zum einen einen Essay von mir (Frank Milautzcki) über den Zubringer Serendipität, falls das etwas mit Küssen zu tun hat und mit Squash, mit der Kunde vom Fund und brasilianischer Musik:
„Der Grundgeschehen der Serendipität betrifft eine Disziplin, die man mit dem Wortpaar Suchen und Finden eingrenzen kann: wer bereit ist zu finden, spart sich das Suchen und wird von Serendipität belohnt. Suchen als Aktivität weiß, was es will. Finden als Aktivität läßt sich überraschen. Diszipliniert dabei wird die eigene Erwartung, so daß die aufnehmende Struktur Freiheitsgrade gewinnt.“
 Collage: Frank Milautzcki
Collage: Frank Milautzcki
*
Zum anderen eine Polemik von Gerhard Falkner, die sich um das richtige Verständnis seiner Hölderlin Reparatur sorgt und in der Falkner (wie so gerne) fett und derb um die Ecke kommt:
„Nun ist wie gesagt die »avantgardistische Dichtung« zum Beispiel von Schmatz oder Czernin ein gefundenes Fressen für den maßlosen Bewegungszwang solcher »Gehirntiere« wie Mosebach oder Kiefer, weil ihnen diese Texte keinen inneren Widerstand entgegenstellen. Sie sind nirgends bindend, man kann sie mit einem Kochrezept, einer Paragraphensammlung oder einer Reparaturanleitung besprechen. Was sich daraus erhellt, ist immer der vermeintliche unfehlbare Gigant. Er kann in diesen Texten nach Belieben abhausen, und kein Gedanke oder keine Konstruktion wird je von ihm dafür Rechenschaft fordern.“
Daß man es nicht falsch versteht: es geht Falkner um die Totheit der Avantgarde und die nötige Ausrichtung der Arbeit an der Sprache, die heute eine andere sein muß, als gestern.

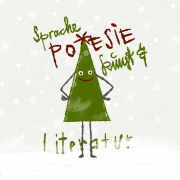
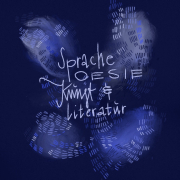
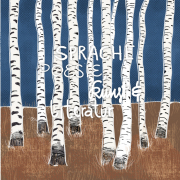
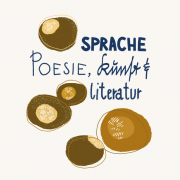



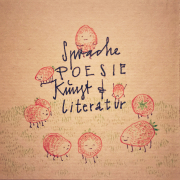
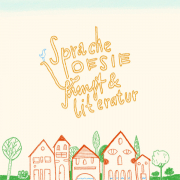
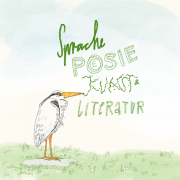
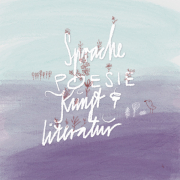
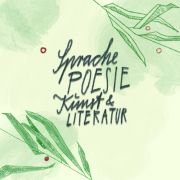
Kommentare
Lyrikkritik - Falkner
Während Jan Kuhlbrodt in seiner Polemik "Neobiedermeier oder die Rekonstruktion des Privaten" (Signaturen) noch eher vorsichtig argumentierte, dass man zur Zeit anhand der Verteilung von Preisen einen gewissen Trend hin zu einem neuen Biedermeier erahnen könne, kommt Gerhard Falkner in "Kieferrohrbruch" direkter um die Ecke, indem er schreibt, die Verbiedermeierlichung der ab 1980 Geborenen habe aufgeräumt mit dem radikalen Denken. Ich wundere mich darüber, dass die junge Generation eine solche Verallgemeinerung offenbar stillschweigend schluckt. Jedenfalls habe ich bisher noch keine Gegenstimme aus dieser Richtung vernommen. Keine Lust auf Diskurs?
Neobiedermeier oder die Rekonstruktion des Privaten
Link zum Beitrag: http://signaturen-magazin.de/jan-kuhlbrodt--neobiedermeier-oder-die-reko...
Lieber Axel Kutsch, und dies
Lieber Axel Kutsch, und dies geht natürlich nicht nur an Sie,
nun ist viel Zeit vergangen, bis sich jemand von den Angerufenen (zähle ich dazu?) sich äußert. Aber ein derart lauter Text (Falkner) und eine so zitternde Diagnose (Kuhlbrodt) erzeugen einen langen Nachhall, der sich wohl etwas Zeit lassen darf. Außerdem kommt man, wenn man nach 1980 geboren ist, sowieso immer und für alles zu spät, damit findet man sich ab.
Mein Beitrag ist lang geworden und sagt längst nicht alles, was mir zu dem Thema einfiele. Ich kann auch keine Partei ergreifen, weil mir zu viele Fälle bekannt sind, bei denen ich den Vorwürfen zustimmen würde. Ich versuche es auf eine unfeige, aber dialektische Art. Es wäre fatal gewesen, wenn nicht einer aus meinen Jahrgängen auf Ihre freundliche Aufforderung zur Beteiligung ausgerechnet in dieser Frage reagiert hätte.
Ich konzentriere mich hier auf die erkennbare Schnittmenge der beiden Texte, um die geht es Ihnen ja. Es ist letztlich die Befürchtung, die Generation der nach 1980 Geborenen könnte verzahmen, an der eigenen Domestizierung sogar noch mitwirken, sich mit ornamentalen Regungen begnügen, mit der Einrichtung der eigenen kleinen (Innen-)Welt zufrieden sein und Gedichte schreiben, die als Baupläne für ein gutes (privates) Leben lesbar sein könnten. (Der Biedermeier unternahm ja wesentlich wohnkulturelle Bemühungen, bis in seine Literaturen hinein.) Der Vorwurf erreicht meine Generation nicht zum ersten Mal, und deshalb war ich enttäuscht von beiden Texten: die Generationsanalyse (Alt analysiert Jung) ist die Gattung des Sommerloch-Journalismus – und ein kulturgeschichtlicher Kalauer, der von Platon bis zu SpiegelOnline seine Kreise zieht. Neu ist hier allerdings, dass nicht die Verrohung, sondern die Spießigkeit zum Vorwurf wird.
Falkners Klage ist (ist es denn das, eine Klage? Der entscheidende Satz fällt so kurz aus, es könnte fast affirmativ verstanden werden.) – das kennen wir alle, die wir Gedichte zu schreiben versuchen – vielleicht klüger, als ihr Kläger: „Die Verbiedermeierlichung der ab 1980 Geborenen hat aufgeräumt mit dem radikalen Denken.“ Verzeihen Sie bitte eine kurze linguistische Umwendung, sie wird zurückführen zu dem, worum es hier geht. Nicht die ab 1980 Geborenen haben aufgeräumt, sondern ihre Verbiedermeierlichung, und dieses Wort ist dabei wunderbar zweideutig: Ob wir hier mit einem aktiven oder passiven Modus konfrontiert sind, ist nicht ersichtlich. Das ist wichtig, weil mir aus Falkners Text nicht klar wird, ob er hier eine bewusste Entscheidung unterstellt (oder auch nur zuzutrauen bereit ist). Weiterhin scheint mir doch der Begriff des Aufräumens unabsichtlich positiv gewichtet zu sein. Auf eine Formel gebracht: Der, dem der Exzess vorausging, hat doch keine Wahl, als (erst einmal) aufzuräumen. (Das spricht niemanden von der Suche nach eigenen Möglichkeiten frei, auch plädiere ich nicht für eine Rückkehr zu Formen, Stoffen, Themen der Zeit vor dem „großen Exzess“.) Eine dritte Detailsicht: das radikale Denken. Das ist ein großes Wort. Radix. Die Wurzel. Ich glaube, wer schreibt, kann gar nicht entwurzelt genug sein. Wir können mit den Wurzeln, Fortsätzen, Erdfäden in einen Dialog treten, müssen uns positionieren, ja, sicher, aber radikal sein, verwurzelt sein, fixen Standpunkt zu beziehen, ihn ein Leben lang zu behalten ("Pflanze werden"), das scheint mir vermeidbar zu sein. Natürlich meint Falkner das nicht, sondern er meint eine Radikalität im ubiquitären Sinne, aber ich glaube – wie gesagt – sein Text spricht das mit, und ich nehme diesen Punkt heraus, um etwas deutlich zu machen: dass es eine einigermaßen zwiespältige Sache ist, Radikalität zu fordern oder ihr Ausbleiben zu beklagen. Dabei spricht man die Schattenseiten eines Radikalitätsbegriffs versehentlich mit an, die ich folgendermaßen benennen würde: Formzwang, Stoffzwang, Themenzwang aus Vermeidungssucht oder Gefallsucht.
Auch ich lebe „nach der Orgie“ und ich leide also unter einem Kater, den sich andere angetrunken haben. – Was das angeht, gehe ich mit Falkner mit: ein nahtloser Anschluss an den Exzess der Vorgänger/Vorreiter ist lächerlich, ist traurig, ist zeitvergessen. In der Performancekunst lässt sich das manchmal beobachten. Davor hüte man sich, das wissen auch meine Alters-genoss*innen. Man zieht seine Schlüsse, und ein jeder für sich. Mein Schluss heißt: Gedichte denken, Gedichte kommen aus dem Hinterhalt (oder dem Untergrund), und nicht als schnell entdecktes Kanonenfutter oder laute Fähnleinführer, Gedichte sind besser eine Spur zu leise als zu laut, und vielleicht besonders, wenn man jung ist. Ich halte den leiseren Ton (nicht den auslassenden, angepassten oder hamonisierenden Ton!) in unserer Zeit für subversiver, als das soziopolitische Rufen der Formen und Themen, das zuweilen gern gehört würde.
Ich räume nicht auf, sondern ich studiere meine Vorgänger und es mag das eine oder andere Gespräch mit ihnen stattfinden, auch im Gedicht, und da werde ich nicht der Einzige meines Alters sein. Ich halte viele Gedichte, die von meiner Generation geschrieben werden, für vorschnell abgetan (manchen Vorwürfen folge ich dagegen, ließe sie auch mal gegen mich gelten, so sie denn kämen). Nach den Manifesten, den Programmschriften, nach den exzessiven De- und Re- und Ent- und Wiederpolitisierungs-forderungen an die Kunst, nach dem gesamten Entautonomisierungs-begehren der Literatur gegenüber sehe ich meine Generation in einer sicherlich mittelmäßig orientierten Verfassung, erkenne aber Tendenzen, die tragfähiger sind, als es von Falkner und Kuhlbrodt vorgetragen wird.
Ein Zugeständnis sei gemacht: Meine Generation ist eine Generation von symbiotischen Karrieristen – man sucht sich seine Nischen, man konkurriert, atomisiert oder kollaboriert lieber, anstatt zu opponieren. Oben genannte monovalente Literaturen (Manifeste, Programme … ) zermürben bis heute das Wissen um die mögliche eigene Schlagkraft.
Man könnte aber ebenso zugestehen, dass hier auch niemand lyrisch kooperiert, z. B. mit einem System, einem politischen Taumel, den Erdbeben in Nepal, dem Sexismus unserer Vorgänger, dem Kapitalismus (, dem die Tempelhofer Kleingärten nicht gefallen, weil hier funktionierende Nahrung angepflanzt wird) oder der „nationale[n] Stagnation“ (Kuhlbrodt). Ich halte auch die neue Natur- und Landschaftslyrik überwiegend nicht für behaglich. Wenn man den Anthropozän-Begriff als Grundlage ernst nimmt und seine Tragweite erfasst, kann man eine Auseinandersetzung mit Problemen erkennen, deren Thematisierungen und dichterische Bearbeitungen nicht als wohnliche Gemütsgedichte abzutun sind.
Ich liebe die Diagnostik nicht. Sie braucht den Diagnostizierten. Der muss aufgebaut werden. Die Diagnose produziert ihre Diagnostizierten, und das auf eine kleinteilige, unfaire Weise. Da kommt mir die Synthese der Analyse zu sehr zuvor.
Es wäre gefährlich, zu behaupten, allein die Entscheidung, Gedichte und nicht Blogs zu schreiben sei ein subversiver oder gar politischer Akt. Es wäre aber auch falsch, zu behaupten, diese Entscheidung sei eine banale oder gar folgenlose, sie eröffnet den Dialog. Ich will mich nicht darauf herausreden, dass die Entscheidung für die Lyrik von jedem Verdacht auf Eitelkeit, Privatismus, Desinteresse freisprechen könnte, doch ihr Vorhandensein ist ein sprachliches, ökonomisches, gesellschaftliches Ärgernis, ist ein Ausnahmefall. Vielleicht wissen viele meiner Altersgruppe nicht, was sie für einen Schritt tun, wenn sie dichten. Da könnte uns der Satz von Heiner Müller helfen: „Wenn alles gesagt werden darf, kommt es darauf an, wie man es sagt.“ Nun, auch wir wählten diese Formm, in einer Zeit, in der die Produktion von Content üblicherweise ausgelagert wird. Formfragen sind Zeitfragen. Und dieses Bewusstsein sollte man haben. Wenn man Müllers Satz internalisiert hat, kann es auch mal ein Sonett sein, dann wird es schon etwas damit auf sich haben. Man soll „das Schlachthaus [nicht] mit Geranien schmücken“ (Eich). Aber eine Geranie am richtigen Ort: Gegenwort, Dichtung. Zudem darf auch die Rezeption befragt werden, ob sie nicht auch ihren Teil zu leisten hat, wenn uns Gärten, Landschaften und Interieurs gedichtet werden. Es mag mitunter etwas damit auf sich haben. Nicht immer, sicher, aber oft genug, und mir scheint, häufiger als es in beiden Texten ausgemacht wird.
Zuletzt noch dies, als Aufriss: Ich glaube, es lohnt sich sehr, noch einmal in Paul Celans Meridian zu schauen, besonders dort, wo von der Individuation die Rede ist, die doch ungleich zu „radikalprivatistischen Poetiken“ (Kuhlbrodt) verstanden werden muss und in jedem Falle kein Konzept für Kleingärtner ist.
Mit besten Grüßen,
phb.
Neuen Kommentar schreiben