30 Jahre Lettre International

Ausführliche Post von Lettre International: mit Werbung und Inhalt zu Heft Nr. 120, das ab heute, Donnerstag, den 15. März 2018, überall erhältlich ist. Es bildet den Auftakt zum „dreißigsten Jahr“ der Zeitschrift: 1988 bis 2018 = 30 Jahre Lettre International.
REAL UND DIGITAL
Bonanjo in Douala, Kamerun. Ein armseliger Stadtteil. Ein Fremder mit Notizbuch und Stift durchwandert die Straßen auf der Suche nach jenem kleinen Zwischenfall, der die Nerven seiner Leser kitzeln könnte, als ihn ein Blick trifft wie ein Schlag, eine Stimme erschüttert wie die eines Propheten aus dem Alten Testament. Hochgewachsen, mager, grauer Bart, rote Augen steht er vor ihm, der Herr von Bonanjo. Der kongolesische Schriftsteller Alain Mabanckou sieht sich einem Mann gegenüber, der sich selbst als letzten Überlebenden der Karawane bezeichnet, als Besitzer des dritten Auges, mächtiger als Kain es je war. Und dieser Zeitenwanderer erzählt ihm die Geschichte seines Landes, seines Territoriums, seiner selbst. Von unsichtbaren Vorfahren geleitet, von Träumen begleitet, konfrontiert er den Schriftsteller, den er als Spion und Instrument von Fremden betrachtet mit deren Vorurteilen, und der weißgewaschenen Bildung eines Reisenden, der nichts weiß von jenem Geist, der sich wie der Wind bewegt. Und doch befiehlt er ihm nun, diese, seine Geschichte aufzuschreiben.
100 Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkriegs 1918 erinnert der indische Autor Pankaj Mishra in seinem Essay Wilde, Räuber, Lumpen an ein verdrängtes Kapitel dieses „Großen Krieges“. Millionen Inder, Nepalesen, Senegalesen, Marokkaner, Chinesen und Vietnamesen wurden als Soldaten aus den Kolonien für die britischen, französischen oder italienischen Armeen ihrer jeweiligen Kolonialherren zum Kriegsdienst eingezogen. Sie kämpften auf deren weit entfernten Kriegsschauplätzen und wurden als Kanonenfutter in europäischen Schützengräben geopfert. Ihrer wird in offiziellen Gedenkveranstaltungen kaum je gedacht. Mishra zeichnet das historische Panorama einer weltumspannenden Rassenhierarchie und eines Kults imperialer und kolonialer weißer Vorherrschaft. „Die Liturgie des Remembrance Day leugnet ebenso wie die wehmütigen Beschwörungen des herrlichen langen Sommers von 1913 nicht nur die grausame Realität der Vorgeschichte des Ersten Weltkriegs, sondern auch das Andauern dieser Grausamkeit bis ins 21. Jahrhundert. Mit dem hundertsten Jahrestag des Kriegsendes stellt sich uns eine anspruchsvolle Aufgabe, nämlich zu erkennen, wie sehr die Vergangenheit auch unsere Gegenwart prägt und unsere Zukunft bedroht – und wie das endgültige Abdanken der weißen Kultur von der Weltherrschaft und das gleichzeitige, forschere Auftreten der bisherigen „finster-trägen“ Völker in den westlichen Ländern einige sehr alte politische Leidenschaften entfacht hat.“
Der einstige niederländische Internet-Utopist Geert Lovink analysiert die weltweiten Debatten über die Entwicklungen der Sozialen Medien und digitalen Plattformen. Der techno-soziale Raum erlebt eine Entzauberung, Unzufriedenheit mit der „kulturellen Matrix des 21. Jahrhunderts“ breitet sich aus. Eine Epidemie der Ablenkung greift um sich. Suchtphänomene, Konzentrationsverlust, Burn-out-Symptome gehen einher mit der Omnipräsenz des vernetzten Lebens. Die direkte Kommunikation eines persönlichen Austauschs erodiert. Der Hype der Online-Videos erzeugt eine televisuelle Wende im Netz. Die vielgepriesene digitale Interaktivität macht nunmehr einer „Interpassivität“ Platz. Marketingunternehmen nutzen die Plattformen mittels „Behavioral targeting“ und Wahrnehmungsmanagement zu nutzerspezifischer Informationsplazierung, die erträumten hierarchiefreien Kommunikationsräume werden zu Orten einer überwachten Aktivität. Online-Voyeurismus ist verbreitet, und man beginnt, auf seinen „digitalen Ruf“ zu achten. Mit der Erfassung und Analyse der Daten nehmen Konformismus und Risikoaversion zu. Unbehagen breitet sich aus gegenüber dieser Domestizierung sozialer Interaktion. Brauchen wir eine digitale Entgiftung? Muß man nach dem „Zugang für alle“ nun ein „Recht auf Abkoppelung“ fordern? Wie könnte man ohne Netzwerke leben? Ein Vogelflug über digitale Abgründe.
ES WAR EINMAL ... 1968
Der Pariser Dichter Jean-Christoph Bailly erinnert sich an einen wilden Aufbruch, an die Erfahrungen einer revoltierenden Jugend: Ein Baum im Mai. Der Pariser Mai 1968 – tausende kleiner Rinnsale flossen da zusammen zu einem See der Ungeduld, der über die Ufer trat. Bailly vergegenwärtigt den Tatendrang und die Leidenschaft einer Generation, welche die Welt verändern zum Gerechteren hin wollte; er erzählt von jenen Schockwellen und einer Radikalisierung, die keiner vorhergesehen hatte. Geräusche, Düfte, Plätze, Straßen, Bewegungen, Diskussionen, Forderungen, Zusammenstöße treten in Erscheinung, dichte Bilder, dramatische Szenen jener Zeit, halb erinnert, halb geträumt, die paradoxe Leichtigkeit und enorme Vitalität jener Tage, der Menschenmengen, Gesten und Gesichter, die nie ganz aus der Erinnerung verschwinden. Nichts war zu spüren von der Tragik der Geschichte – im Pariser Mai schien der Tod abwesend und ein Baum der Freiheit konnte gepflanzt werden. Persönliche poetisch-politische Erinnerungen an die Intensität und Strahlkraft eines historischen Ereignisses.
Eine Zeit des Möglichen: „Eine Ungeduld. Ein Anspruch. Ein reines Streben. Eine Verweigerung. Eine souveräne Bewegung. Eine staunenerregende Überraschung. Eine Aufwallung. Eine Kühnheit. Ein Ausbruchsversuch. Eine Emanzipation. Eine Verschwendung. Ein Vibrieren des Lebens. Ein Jubel. Ein Bruch. Ein Wachtraum. Eine Umkehr. Eine Begegnung. Ein Lauffeuer. Eine plötzliche Frische. Ein neuer Raum. Ein Fenster, zur Wiese geöffnet. Ein Aufstand des Denkens und des Wortes. Ein Schrei. Eine wahnsinnige Liebe. Ein Augenblick. Ein respektloses Lachen ... Eine Verschwörung der Gleichen.“ (Serge Velay) Die französische Historikerin Ludivine Bantigny identifiziert im Ereignis von 1968 nichts weniger als eine die Grenzen aller gesellschaftlichen Bereiche und Disziplinen überschreitenden „anthropologischen Revolution“.
Renzo Piano, heute ein international arbeitender italienischer Stararchitekt, studierte in den sechziger Jahren in Mailand, nahm an den Universitätsbesetzungen teil und wollte – wie andere – die Welt verändern: Durch eine neue Architektur, eine Umgestaltung des öffentlichen Raums, eine veränderte Urbanistik, welche die Bedürfnisse der Bürger und das Streben nach Schönheit versöhnen würde. Das Bauen sollte im Dienst sozialer Gerechtigkeit stehen. Dialoge mit Nutzern und Bewohnern sollten dabei ebenso einfließen wie avancierte Wissenschaft und Technik. Sein Hauptaugenmerk galt Projekten von öffentlichem Interesse – Schulen, Universitäten, Konzertsäle, Ausstellungshallen, Stadtstrukturen. Er erinnert sich an jene experimentierfreudige Zeit, als ein gaullistischer Kulturminister auf bahnbrechende Weise grenzüberschreitende Wettbewerbe und eine internationale Jury etablierte, um einen so revolutionären Bau wie das Pariser Centre Beaubourg zu ermöglichen. Dieser Minister, André Malraux, träumte auch davon, in jeder Stadt Frankreichs ein Kulturhaus zu schaffen, um Bücher, Musik, Theater, Kunst und Film zu einem schöpferischen Miteinander zu bringen. Renzo Piano über Entwicklungen, die es ohne diesen kulturellen Aufbruch von 1968 nicht gegeben hätte: Ethik des Bauens.
Sein „bürgerliches Weltbild mit Kirchturm und etwas Philosophie“ umreißt der Philosoph Hannes Böhringer in Russen am Rhein. Französische Revolution und Heilige Allianz, Christliches Abendland und moderne Architektur, Bürger und Staat, Gerechtigkeit und Freiheit, Frieden und Sicherheit, Volk und Gesetz, Räuber und Unternehmer, Bürger und Banden, Demokratie, Tyrannis und Oligarchie ... Macht, Verantwortung und Pflicht, Geld und Ordnung, Skepsis und Toleranz, Verantwortung, Rede und Antwort, eigene Interessen und die Interessen anderer, Bürger und Christ. „Der Bürger geht in die Kreuzherrenkirche, sein Finanzamt. Da gibt er Einkommen und Vermögen an. Er rechnet es klein und scheut auch nicht vor Betrug zurück. Ist der Staat nicht selbst eine Räuberbande? Auch der Christ geht in die Kreuzherrenkirche. Sie ist säkularisiert worden. Das saeculum ist ein Finanz- und Parkplatz. Das Geld hält die Welt vorübergehend zusammen, macht die einen reich, die anderen arm. Die meisten halten sich gerade über Wasser.
Der Bürger will seine Welt in Ordnung bringen. Das muß doch möglich sein! Darüber kann er militant werden. (...) Der Christ sieht darin die Selbsttäuschung des emanzipierten Verstandes. Die Welt läßt sich nur flicken wie ein Schuhwerk, auf das man nicht verzichten kann. Die Christen, schreibt Paulus, ziehen die Rüstung Gottes an und gehen mit ihr durch die einstürzende Welt. Die Häuser werden nicht stehen bleiben. ‘Kreuzzug oder Karneval?‘, fragen sich die Bürger am Straßenrand. (...) Die Bürger insgesamt können sich Gott sparen. Er rentiert sich nur noch für ein wenig sozialen und kulturellen Zusammenhalt. Die Christen, die durch Aufklärung und Emanzipation hindurchgegangen sind, gehen eine große Wette ein.“
Eine begriffsgeschichtliche Erkundungstour durch prozessierende Widersprüche des bürgerlichen Selbstverständnisses und die Selbsttäuschungen des emanzipierten Verstandes.
PSYCHOANALYSEN
Jeder Mensch hat einen Clown in sich, und diesen gilt es, zu befreien! Nuar Alsadir, Poetin und Psychoanalytikerin, belegt als einzige Nichtschauspielerin einen Kurs an einer legendären Clown-Schule um zu verstehen, was es mit dem spontanen Lachen auf sich hat. Psychoanalyse wie auch die Kunst des Clowning bahnen sich auf verschiedene Weise einen Weg zum Unbewußten, zum nichtsozialisierten Selbst. Der Clown erhebt sich vor einem Publikum und nimmt das Risiko auf sich, das, was in seinem Inneren steckt, aus sich herausströmen zu lassen – so, wie Patienten bei einer Psychoanalyse in freier Assoziation ihre Gedanken sich bewegen lassen, wo auch immer sie hinstreben. Während der Analytiker nach dem wahren Selbst sucht, indem er das Material durchgeht, welches ihm das Unbewußte enthüllt, versucht es der Schauspieler in der Clownsschule auf dem Wege des spontanen Ausdrucks zu entdecken. Es gilt, die innere Buntscheckigkeit freizulegen. Mut aufzubringen. Die Selbstkontrolle aufzugeben. Eine Beziehung zum wahren Selbst herzustellen. Emotionen freizusetzen. Authentisch zu agieren. Dann tritt ein Publikum in Konversation mit dem Darsteller und belohnt ihn durch sein Lachen. Sonst herrscht Stille. Ein Selbstversuch: Schule für Clowns.
Rätsel der Eifersucht löst der Schweizer Analytiker Christian Kläui. Franz Grillparzer nennt Eifersucht eine „Leidenschaft, die mit Eifer sucht, was Leiden schafft“. Sigmund Freud unterscheidet drei Formen der Eifersucht: Die normale Eifersucht, die projizierte Eifersucht, die wahnhafte Eifersucht. Die „normale“ Eifersucht verbindet Schmerz um das verlorene Liebesobjekt mit narzißtischer Kränkung und Feindseligkeit gegenüber dem Rivalen; die zweite Form der Eifersucht wurzelt in eigenen Untreueregungen, die verleugnet und auf den Partner projiziert würden. Die wahnhafte Eifersucht entspricht einer unverarbeiteten eigenen Homosexualität. Bei Freud wie bei Grillparzer treffen sich Leiden und Leidenschaft: Verlust – Schmerz, Trauer, Kränkung – und Trieb – homosexuelle, feindselige und Untreueregungen – mischen sich in der Eifersucht. Wie sieht es aus, wenn Eifersucht einzig der Imagination des Betroffenen entspringt?
Langeweile umhüllt den italienischen Psychoanalytiker Sergio Benvenuto. „Die Langeweile ist die unfruchtbarste aller menschlichen Zustände. Sie ist die Tochter des Nichts und die Mutter des Nichts. Und sie ist nicht nur an sich unfruchtbar, alles, was sich ihr nähert und was sie durchdringt, wird ihr darin gleich“, meinte der Dichter Giacomo Leopardi. Der Philosoph Martin Heidegger analysiert die „Langweile als Grundstimmung unseres Daseins heute“, die Psychoanalyse identifiziert sie als „leidvolles Begehren nach Nichts“. Langeweile umfaßt das Totschlagen der Zeit, die Kompensation halluzinierter Genüsse, den Schlaf als Morphium. Langeweile kann aber auch Peitsche der Kreativität sein: „Die Langeweile ist der Traumvogel, der das Ei der Erkenntnis ausbrütet. Ein Rascheln zwischen den Blättern verscheucht ihn“, schrieb Walter Benjamin. Eine kurzweilige Begegnung mit einem allen vertrauten Phänomen. Der schweigende Nebel
STADTKULTUREN
Der französische Philosoph Marcel Hénaff und der Journalist Olivier Mongin unterhalten sich über die Stadt. Diese ist eine soziale Maschine, ein Netz, ein öffentlicher Raum, sie akkumuliert Bauten, transportiert Menschen und Güter, koordiniert Kräfte und Kompetenzen, schafft Kommunikationsräume, transformiert sich unentwegt. Im Herzen dieser urbanen Agglomerationen erheben sich Monumente, deren Bedeutung Nützlichkeit und Funktionalität überschreitet: Solche Plätze, Tempel, Schlösser, Arenen, Theater, Kathedralen, Verwaltungsbauten besitzen hohen symbolischen Wert. Sie repräsentieren Souveränität, Rang, Ansehen. Selbstbild und Anspruch einer Stadt manifestieren sich in ihren öffentlichen Bauten. Heutzutage allerdings sendet die Gigantomanie kommerzieller Skyscraper andere Zeichen aus. Der öffentliche Raum wird von privaten Interessen belagert. Trump Tower gegen Kapitol? Untergräbt die „unsichtbare Hand“ des Marktes die Souveränität der Republik? Monument, Stadt, Macht
Rio de Janeiro ist die Herzensstadt des brasilianischen Journalisten Ruy Castro. Kaum biegt man um eine Ecke, taucht ein anderes Jahrhundert auf, in Form eines Aquädukts, einer Fassade, eines Gebäudes. Rio ist stolz darauf, eine alte Stadt zu sein, deren Epochen sich verschränken. Barocke Kirchen finden sich neben Bauwerken des Neoklassizismus, Eklektizismus neben Postmoderne, Art nouveau oder Art déco. Diese Umarmung der Vergangenheit könnte noch großzügiger ausfallen, wenn die Brasilianer nicht allzu lange den Spleen gehabt hätten, alles zu verachten, was älter ist als fünfzehn Jahre. Viele der prächtigsten Monumente wurden dem Erdboden gleichgemacht. Wenn Machthaber, Techniker und Spekulanten sich versammeln, um über die Stadt zu beraten, geht es um Geld, Abriß, Neubau, dann erzittert Rio in seinen Grundfesten. „Die Möwen erschrecken sich, das Meer wirft Sand auf die Bürgersteige, ein Kellner verschüttet Bier, und mir läuft es kalt den Rücken hinunter.“ Epochen und Moden, Tage und Nächte, Flora und Fauna – eine Zeitreise durch die Geschichte der vibrierenden, heißgeliebten Stadt am Zuckerhut: Der Zauber Rios.
Täfelchen im Hotel erinnern an Berühmtheiten, die einst hier übernachteten: Tschechow, Tschukowski, Majakowski. Von letzterem hatte der serbische Schriftsteller Bora Ćosić als junger Mann das berühmte Poem Wolke in Hosen ins Serbische übersetzt. Tote Seelen wurden hier geschrieben und es gibt ein Gogolhaus. Isaak Babels Odessa hingegen hat keinerlei Spuren zurückgelassen, seine stalinistischen Verfolger haben ganze Arbeit geleistet. Die berühmte Treppe aus Eisensteins Panzerkreuzer Potemkin macht klar: Ein geniales Auge kann aus etwas ganz Gewöhnlichem einen legendären Ort erschaffen. Geschichten über Gogol und Potemkin, die Schicksale Eisensteins und des verrückten Jungen Pankejew, die Schatten der Zarin Katharina und Sigmund Freuds kullern durch dieses literarische Stadtporträt. „So können an ein und demselben Ort nicht vergleichbare Einzelheiten aneinandergereiht, das Nicht-Verknüpfbare verknüpft werden. Weil das Leben mit seiner Parallelmontage das Rationale und Irrationale, das Wirkliche und Artifizielle, das Geschichtliche und Phantasmagorische, das Regelmäßige und Unregelmäßige, das Pythagoräische und die Akrobatik, das Weise und das Unausgeglichene, den Film, den Wahn, den Traum in sich versammelt.“
LABOR UND LABYRINTH
Ein Palimpsest, eine Sammlung von Erzählungen, eine Erfahrung, eine Architektur, eine Kreation und in ihrem Herzen ein mysteriöses Zimmer, zu dem der spanische Autor Enrique Vila-Matas den Schlüssel besitzt. Alles ist Dialog – mit Fassbinder, Rimbaud, Antonioni, Hitchcock, Bioy Casares, Dominique Gonzales-Foerster und vielen anderen. Die Erzählung des Selbst ist Werk, Spektakel, Körper, Projektionsfläche, das Leben ein Roman aus tausend Erzählungen. Marienbad elektrisch erforscht Orte, reale und fiktive, ist eine mentale Geographie, ein geistiges Fest, eine Reise, deren Stationen Bücher, Filme, künstlerische Inszenierungen sind. Diese Geschichte und macht den Leser zur voyeuristischen Ariadne in einem verzweigten mentalen Labyrinth.
Der russische Philosoph Valerij Podoroga interessiert sich für die Verbindung von Kino und Revolution im Werk der avantgardistischen Filmregisseure Dsiga Wertow und Sergei Eisenstein: Die russische Revolution wurde frühzeitig theatralisiert und ästhetisiert. Wertow wollte das Unsichtbare sichtbar machen, sein Kino-Auge sollte die soziale Realität im Dienste unbestechlicher Faktizität erkunden. Eisenstein hingegen wollte die Revolution durch den Kino-Mythos erst wirklich erschaffen: seine filmische Reinszenierung des „Sturms auf den Winterpalast“ in Oktober wurde „wahrer“ als die Wirklichkeit. Das Ereignis Revolution entsteht für ihn ex post, wenn sich der Mythos der Revolution im Selbstbewußtsein der „Siegerklasse“ ausbildet. Ein solches Ereignis bedarf eines Narrativs, das dieses zur Schau stellt. Für diese frühe Form der „Fake News“, der Manipulation von Fakten, ist die Formel „Ereignis – Narrativ – Mythos“ ausschlaggebend; das „Ereignis“ geht im „Narrativ“ und das „Narrativ“ im „Mythos“ auf: Kino und Revolution
GEOPOLITIK
„Es war der 25. Januar 1904, als Halford J. Mackinder, Professor für Geographie an der Universität von Oxford, vor der Royal Geographical Society das Wort ergriff. Sein Vortrag Der geographische Drehpunkt der Geschichte skizzierte Bezugssysteme von Raum und Politik, Land und Meer, Geographie und Universalgeschichte, Menschheitsentwicklung und Weltorganismus. Die Zuhörer waren hingerissen. Dreh- und Angelpunkt der Geschichte waren für ihn weder Europa noch die USA, sondern die eurasische Landmasse mit ihren 21 Millionen Quadratmeilen, in deren Zentrum keine Wasserwege zu den Ozeanen existieren und die von der Mobilität der Reitervölker abhing. „Mackinder argumentierte, die Zukunft globaler Machtpolitik liege nicht, wie die meisten Briten damals glaubten, in der Kontrolle der Schiffahrtswege des Planeten, sondern in jener der riesigen Landmasse, die er ‘Eurasien‘ nannte. Er stellte Afrika, Asien und Europa nicht als drei verschiedene Kontinente dar, sondern als eine einheitliche ‘Drehpunktregion‘, wie er sagte. Deren breites und tiefes Kernland – 4 000 Meilen vom Persischen Golf zum Sibirischen Meer – war so weit, daß es sich nur von den Rändern in Osteuropa oder den Küstenzonen in den umgebenden Meeren kontrollieren ließ (...) Das Herzland (the heartland) dieser riesigen Landmasse, eine ‘Angelpunktzone‘, die sich vom Persischen Golf durch die russischen Steppen bis zu den Wäldern Sibiriens erstreckte, war nach wie vor das Areal, wo der Hebel für die Herrschaft über die Welt anzusetzen war. Wer das Herzland beherrsche, beherrsche die Weltinsel, schrieb Mackinder später. Wer die Weltinsel beherrsche, befehle der Welt.“ (Alfred McCoy)
Mackinders Vision prägte Generationen wirkungsmächtiger geopolitischer Denker, doch wurde dieser Klassiker bis heute nicht ins Deutsche übersetzt. Lettre International präsentiert in dieser Ausgabe Nr. 120 nach 114 Jahren (!) endlich eine deutsche Übersetzung.
Herzland und Weltinsel: Der US-amerikanische Politikwissenschaftler Alfred McCoy hält die geopolitischen Thesen von Halford J. Mackinder für hochgradig aktuell. Von Karl Haushofer zu Paul Kennedy haben Denker Mackinders Konzept des geographischen Angelpunkts der Geschichte zur Grundlage ihrer Analysen gemacht. Der britische Historiker John Darwin verweist darauf, die Vereinigten Staaten hätten ihr kolossales Imperium aufgebaut, indem sie als erste Macht der Geschichte die strategischen Achsenpunkte an beiden Enden Eurasiens kontrollierten. Als die USA 2003 in den Irak einmarschierten, meinte der Historiker Paul Kennedy: "Es sieht so aus, als würde man in Washington Mackinders Mahnung ernst nehmen, sich des geographischen Angelpunktes der Geschichte zu versichern." Ein geopolitisches Meisterstück in jenem "Großen Spiel" gelang dem Sicherheitsberater von Präsident Jimmy Carter, Zbigniew Brezinski, mit seiner "Operation Zyklon", die der Roten Armee in Afghanistan durch die Mobilisierung militanter Muslime eine demütigende Niederlage zufügen konnte. Die elementaren geopolitischen Parameter scheinen sich kaum verändert zu haben. Ein Überblick über Grundkonstellationen der Weltpolitik.
Raum ist ein verstecktes Paradigma der Politik, und es gilt, eine aktuelle Kartographie des Realen zu skizzieren. Für den italienischen Politologen Carlo Galli ist der globale politische Raum heute von komplexen Linien durchzogen, deren Genealogie es zu verstehen gilt. Europas Zentralität beruht auf einer langanhaltenden Konfrontation mit nichteuropäischen, anthropologischen und räumlichen Faktoren. Seßhaftigkeit und Nomadismus, Übergangszonen, Grenzlinien und Frontverläufe gilt es zu berücksichtigen. Statt des abstrakten Universalismus einer globalen Räumlichkeit gilt es, differenzierte Machtlinien nachzuzeichnen, ohne einer Nostalgie für Identitäten und geschlossene Räume zu verfallen: Karthographie heute
BRIEFE, KOMMENTARE, KORRESPONDENZEN
Der polnische Reporter Andrzej Stasiuk durchquert die frühere zentralasiatische Sowjetrepublik Kasachstan. Er inspiziert das aufgegebene Atomwaffentestgelände bei Semipalatinsk, besucht die einstige Militärstadt Tschagan, verliert sich zwischen pharaonischen Bauprojekten und der Leere der Plätze der Hauptstadt Astana und stellt sich beim Waten durch das Wasser des Kaspischen Meeres sein eigenes Skelett vor.
Andreas Dorschel lauscht mit feinem Gehör der Stimme, Technik und Kunst des berühmten Tenors Andrea Bocelli und fragt nach Musikalität, Stil und dramatischer Engagiertheit des Weltstars. Leid, Freude und Geschäft verschmelzen hier in der Vermarktung eines Kults.
Armin Wertz erinnert in seiner historischen Rekonstruktion an das US-amerikanische Kriegsmassaker von My Lai vor 50 Jahren in Vietnam. Auf Ableugnung, Vertuschung, geheim gehaltene Untersuchungen, anfängliches Desinteresse der Presse folgte schließlich ein Aufschrei der Empörung. Die Welt war schockiert. Auch wenn der Hauptverantwortliche des Verbrechens von vielen Amerikanern zum Opfer und Helden stilisiert wurde, war klar: Die moralischen Kosten des Krieges waren für Amerika zu hoch. Ein Wendepunkt im Vietnamkrieg war erreicht. My Lai –„Ein Stapel Diapositive“.
Suzanne Brøgger aus Kopenhagen beschreibt interskandinavische Sensibilitäten und bereist „das längste Land der Welt mit dem dünnsten Brot der Welt“, ein Norwegen voller Naivität und Pathos, wo man alles wörtlich nimmt und mit dem dänischen Sinn für Komik wenig anfangen kann: Der norwegische Elefant.
Auf die Spuren von Peter Alexander begibt sich der Wiener Schriftsteller Herbert Maurer und schildert einen Charmeur, Tänzer, Witze-Erzähler, Quotenkönig: ein österreichisches Phänomen? Ist Österreich nur Vorzimmer zur großen Welt? Könnte Sebastian Kurz der Peter Alexander der österreichischen Innenpolitik sein?
Tom Engelhardt berichtet aus New York über die jahrzehntelange unaufhörliche Suche des Pentagon nach dem Licht am Ende der Kurve in Vietnam, Irak, Afghanistan: „Früher oder später wird es wieder besser ...“
KUNST
Die französische Künstlerin Dominique Gonzalez-Foerster führt uns Apparitions vor. Wenn es je Reines gab in unseren Vorstellungen, die amalgamiert mit Kitsch, auf diese Figuren projiziert wurden, dann wird diese Idealität hier für uns gerettet. In ihrer Kunst der Travestie erweckt die Künstlerin die von ihr selbst verkörperten Ikonen zu neuem Leben und macht sie zu unsterblichen Kunstfiguren. Wir werden durch die Magie der Attraktion in einen unbekannten Raum gebannt, der uns in seine eigene Zeitlichkeit aufnimmt. Aus ihren himmlischen Ruhestätten herabbeschworen treten uns Mythen des kollektiven Bewußtseins vor Augen: Apparitions. Unsterblich werden hier Lola Montez, Fitzcarraldo, Marilyn Monroe, Franz Kafka, Maria Callas ... Ihr Leben ist abgelaufen, nun wirken sie als Lichtgestalten, einen Raum füllend, der einzig für sie und ihre Betrachter erschaffen ist. Ihr Glanz ist von höchster Intensität. Entbunden vom Leben und vom Geschäft sind sie nun frei, ihre Auftritte erinnern an Pathosformeln. In dieser purgatorischen Wunderkammer wird die Zeit zum Raum. Zeitenthobene Posen und Gesten deuten auf eine platonische Sphäre unvergänglicher Haltungen, Sehnsüchte und Träume. Aus dieser Erweckung der Toten zum virtuellen Leben eröffnet sich dem Betrachter ein Raum vergessener Möglichkeiten. Auch er wird erweckt.

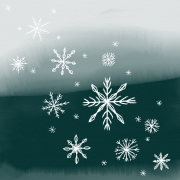


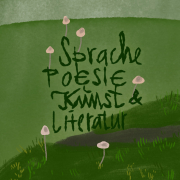
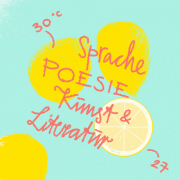
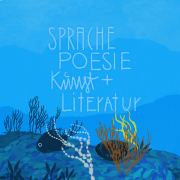
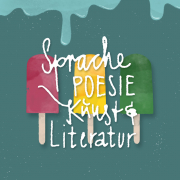
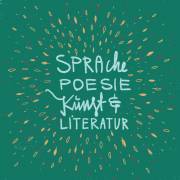
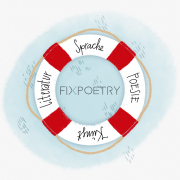
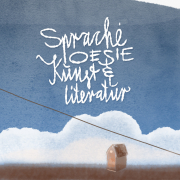
Neuen Kommentar schreiben