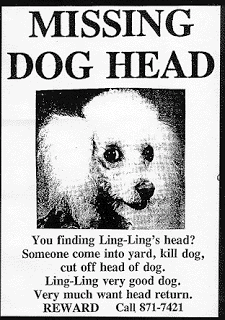Es kam vor, daß die Strecke, die zurückgelegt wurde,
gar nicht die Strecke war, von der eine Skizze
existierte. Sie schlüpfte durch eine Ruinen-Lücke,
blieb in geisterhafter Manier verschwunden. Was
war mit den Betreibern?
Gingen sie noch einmal auf Händen und Knien
zurück, um all das, was sie versäumt hatten,
nachträglich zu daguerreotypieren? Oder legten sie sich
eine Hiobsbotschaft zu, die, einem kleineren
Hund gleich, ausgeführt werden wollte?
Wir wissen es nicht, aber unter den Grübchen
einer beliebigen Amme steckt noch der Brief
mit Leporello-Faltung, der sich zwar in der
Adresse täuschte, aber ohne jeden Zweifel die
Stelle enthielt, die aus deinem Bauchnabel tropfte.
Niemand hatte dieses Loch bemerkt, was hieß,
es hatte uns ebenfalls nicht bemerkt. Der Vorteil,
der sich daraus ergab, lag im Geheimnis der
Schaltung der Amphibie verborgen. Nehmen wir
einmal an, das Meer läßt sich zu früh sehen, oder
eine andere Pfütze, eine, die vor der Tür
wartet und wartet, eine
die im Stande wäre, Geld zu verlangen, nur
um des Tausches Willen, nicht für eine
eventuelle Exhibition (11 W 53rd St.
Midtown West, New York 10019)
Frauen, die sich Ratten
umbinden -
Kanaldeckel, die ihr kreisförmiges Rund
preisgeben, ihr leckgeschlagenes Leben bedeckend,
die Meute vor Ort.
Dann nämlich - und nur dann, lassen die
zweigenden Wege sich sehen, aber auch das :
keine Exhibition,
mehr noch ein Reservat für Ideen, Konstrukte,
der Falle entronnen. Die Straßenmitte : eine
wiedererstarkte Leiche im Hemd einer geschlossenen
Boutique. Sollte sie nicht hier sein? An diesem
Tisch sitzen und mit dem Revolver spielen?
Der letzte Schuß ging daneben, traf das Geschirr
mit den merkwürdigen Zeichen auf der Rückseite.
Sonntag, 31. Mai 2015
Samstag, 30. Mai 2015
Die Antwort
Mir bleibt noch etwas Regen in diesem
aufgeräumten Gefäß, weggeschlossen zwar,
aber nicht unerreichbar, wenn ich einen
Stuhl auf den anderen stelle.
Die Trockenheit unter der Zunge ist
für ein besonderes Klima verantwortlich.
Als könnte man leise eine Treppe
hinab schweben, keine Spuren im Staub.
Mittags schälten sich die Passanten aus dem Laub,
die Straße aber blieb bestehen.
Die Folgen eines Bisses,
ein Fetzen Luft zwischen den Zähnen,
mit allen brillianten Brechungen vereint.
Jetzt endlich kaufte sie den Stuhl,
um den Ereignissen beizuwohnen.
Heute weiß ich es nicht,
aber morgen werde ich mich gefragt haben.
aufgeräumten Gefäß, weggeschlossen zwar,
aber nicht unerreichbar, wenn ich einen
Stuhl auf den anderen stelle.
Die Trockenheit unter der Zunge ist
für ein besonderes Klima verantwortlich.
Als könnte man leise eine Treppe
hinab schweben, keine Spuren im Staub.
Mittags schälten sich die Passanten aus dem Laub,
die Straße aber blieb bestehen.
Die Folgen eines Bisses,
ein Fetzen Luft zwischen den Zähnen,
mit allen brillianten Brechungen vereint.
Jetzt endlich kaufte sie den Stuhl,
um den Ereignissen beizuwohnen.
Heute weiß ich es nicht,
aber morgen werde ich mich gefragt haben.
Freitag, 29. Mai 2015
Bruno Schulz
Bruno Schulz drückt die Sache so aus: Das Unwirkliche ist das, was man untereinander nicht teilen kann. Was auch immer aus dieser Gemeinsamkeit herausfällt, das fällt aus dem Kreis menschlicher Angelegenheiten, geht über die Grenzen des menschlichen Theaters, über die Grenzen der Literatur hinaus.
Das Problem mit Bruno Schulz ist: jeder weiß, dass er ein Genie ist, jeder spricht über seinen enormen Einfluss, kommt es aber hart auf hart, bleiben diese Aussagen auf Banalitäten beschränkt, als wäre das Maß dichterischer Größe abhängig von einer Gemeinschaft populärer Entscheidungen. Auf der anderen Seite ist das auch nicht sonderlich überraschend. Schulz überfällt den Leser von der ersten Seite an und erlaubt ihm nicht, ein einziges Mal innezuhalten, erlaubt ihm nicht, seine Gedanken zu sammeln. Seine Niederträchtigkeit liegt in der Tatsache, dass er jeder Übersetzung widersteht, uns aber dazu ermutigt, zu imitieren, zu paraphrasieren und zu fälschen. Es ist einfacher in Schulz' Sprache zu sprechen als über Schulz zu sprechen. Lesen wir einen einzelnen Absatz, wissen wir sofort, das ist Schulz, obwohl wir nicht wissen, was wir über den gelesenen Absatz sonst noch sagen könnten.
Bruno Schulz ist ein Magier, der mit der Exaktheit einer Traumsprache hantiert, ein geistiger Bruder Kafkas, mit dem er überraschende Lebensmomente teilt. Kafkas Texte sind Bleikristalle, während Schulz eine lyrische Phantastik schreibt, die dem Surrealismus und dem Expressionismus noch näher kommt. Die Vernichtung des Individuums aufgrund der Gleichschaltung durch die Massenindustrie sah er voraus. Ein Entkommen durch den Traum ist, wie wir heute wissen, unmöglich. Aber es gibt eine Schönheit des Zerfalls, die tröstlich ist. Scheitern, Vergeblichkeit - sind schließlich die Dinge, die wir haben.
Bruno Schulz wurde in Drohobycz, das heute in der Ukraine liegt, in eine jüdische Familie hineingeboren. Die Gegend war damals Teil des österreichischen Kaiserreichs. Sein Vater besaß ein Stoff- und Kleidergeschäft, überließ die Leitung aber seiner Frau, weil es mit seiner Gesundheit nicht zum Besten stand. Schulz studierte Architektur an der Universität Lemberg und Bildende Kunst in Wien, spezialisiert auf Lithographie und Zeichnung. Nach der Rückkehr in seine Heimatstadt arbeitete er von 1924 bis 1939 als Kunstlehrer in der lokalen Turnhalle. Einer seiner Schüler erinnerte sich später daran, dass Schulz eine sehr merkwürdige Erscheinung besaß und man hinter seinem Rücken über ihn lachte. Er trug stets eine Flanell-Jacke und einen Schal um den Hals. Nachdem sein Freund Wladyslaw Riff an Tuberkulose starb, hörte er über Jahre hinaus auf, Prosa zu schreiben. Als die Kammer von Riff desinfiziert wurde, verbrannte man auch gleich alle Manuskripte und Briefe von Schulz, die dort gelagert waren.
Schulz startete seine literarische Karriere erst in den 1930ern. Seine Rezensionen erschienen in der Literaturzeitschrift "Wiadomosci Literackie" und er korrespondierte mit den polnischen Avantgardisten Witold Gombrowicz und Stanislaw Ignacy Witkiewicz, begab sich aber nie in literarische Kreise. Mitte der 30er verbrachte er Zeit in Warschau und Paris, stand in regem Kontakt mit der Dichterin Deboah Vogel und anderen Frauen, heiratete aber nie. 1939 erhielt er den Goldenen Lorbeer der polnischen Akademie für Literatur. Als 1939 Deutschland Polen überfiel und der Rest des Landes von der Sowjetunion besetzt wurde, lebte Schulz im von der Roten Armee okkupierten Gebiet, bis die Nazis auch die UdSSR angriffen und der braune Fäzes Drohobycz besetzte. 1942 wurde Schulz auf offener Straße von den Nazis erschossen.
Die Kurzgeschichtensammlung "Der Zimtladen" (1934), gefolgt von "Das Sanatorium zur Sanduhr" (1937) begründeten den Ruhm, den Schulz bis heute weltweit genießt. In seinen Geschichten entwirft Schulz eine mystische Kindheit, gepaart mit autobiographischen und fantastischen Elementen. Das Artifizielle dieser Prosa ist außerordentlich und spielt mit dem Ungesagten. Eine herkömmliche Entwicklung von Handlung und dergleichen gibt es nicht. Die Welt des Bruno Schulz folgt ihrer eigenen Logik, die Metamorphose ist ihr großes Thema.
Das Problem mit Bruno Schulz ist: jeder weiß, dass er ein Genie ist, jeder spricht über seinen enormen Einfluss, kommt es aber hart auf hart, bleiben diese Aussagen auf Banalitäten beschränkt, als wäre das Maß dichterischer Größe abhängig von einer Gemeinschaft populärer Entscheidungen. Auf der anderen Seite ist das auch nicht sonderlich überraschend. Schulz überfällt den Leser von der ersten Seite an und erlaubt ihm nicht, ein einziges Mal innezuhalten, erlaubt ihm nicht, seine Gedanken zu sammeln. Seine Niederträchtigkeit liegt in der Tatsache, dass er jeder Übersetzung widersteht, uns aber dazu ermutigt, zu imitieren, zu paraphrasieren und zu fälschen. Es ist einfacher in Schulz' Sprache zu sprechen als über Schulz zu sprechen. Lesen wir einen einzelnen Absatz, wissen wir sofort, das ist Schulz, obwohl wir nicht wissen, was wir über den gelesenen Absatz sonst noch sagen könnten.
Bruno Schulz ist ein Magier, der mit der Exaktheit einer Traumsprache hantiert, ein geistiger Bruder Kafkas, mit dem er überraschende Lebensmomente teilt. Kafkas Texte sind Bleikristalle, während Schulz eine lyrische Phantastik schreibt, die dem Surrealismus und dem Expressionismus noch näher kommt. Die Vernichtung des Individuums aufgrund der Gleichschaltung durch die Massenindustrie sah er voraus. Ein Entkommen durch den Traum ist, wie wir heute wissen, unmöglich. Aber es gibt eine Schönheit des Zerfalls, die tröstlich ist. Scheitern, Vergeblichkeit - sind schließlich die Dinge, die wir haben.
Bruno Schulz wurde in Drohobycz, das heute in der Ukraine liegt, in eine jüdische Familie hineingeboren. Die Gegend war damals Teil des österreichischen Kaiserreichs. Sein Vater besaß ein Stoff- und Kleidergeschäft, überließ die Leitung aber seiner Frau, weil es mit seiner Gesundheit nicht zum Besten stand. Schulz studierte Architektur an der Universität Lemberg und Bildende Kunst in Wien, spezialisiert auf Lithographie und Zeichnung. Nach der Rückkehr in seine Heimatstadt arbeitete er von 1924 bis 1939 als Kunstlehrer in der lokalen Turnhalle. Einer seiner Schüler erinnerte sich später daran, dass Schulz eine sehr merkwürdige Erscheinung besaß und man hinter seinem Rücken über ihn lachte. Er trug stets eine Flanell-Jacke und einen Schal um den Hals. Nachdem sein Freund Wladyslaw Riff an Tuberkulose starb, hörte er über Jahre hinaus auf, Prosa zu schreiben. Als die Kammer von Riff desinfiziert wurde, verbrannte man auch gleich alle Manuskripte und Briefe von Schulz, die dort gelagert waren.
Schulz startete seine literarische Karriere erst in den 1930ern. Seine Rezensionen erschienen in der Literaturzeitschrift "Wiadomosci Literackie" und er korrespondierte mit den polnischen Avantgardisten Witold Gombrowicz und Stanislaw Ignacy Witkiewicz, begab sich aber nie in literarische Kreise. Mitte der 30er verbrachte er Zeit in Warschau und Paris, stand in regem Kontakt mit der Dichterin Deboah Vogel und anderen Frauen, heiratete aber nie. 1939 erhielt er den Goldenen Lorbeer der polnischen Akademie für Literatur. Als 1939 Deutschland Polen überfiel und der Rest des Landes von der Sowjetunion besetzt wurde, lebte Schulz im von der Roten Armee okkupierten Gebiet, bis die Nazis auch die UdSSR angriffen und der braune Fäzes Drohobycz besetzte. 1942 wurde Schulz auf offener Straße von den Nazis erschossen.
Die Kurzgeschichtensammlung "Der Zimtladen" (1934), gefolgt von "Das Sanatorium zur Sanduhr" (1937) begründeten den Ruhm, den Schulz bis heute weltweit genießt. In seinen Geschichten entwirft Schulz eine mystische Kindheit, gepaart mit autobiographischen und fantastischen Elementen. Das Artifizielle dieser Prosa ist außerordentlich und spielt mit dem Ungesagten. Eine herkömmliche Entwicklung von Handlung und dergleichen gibt es nicht. Die Welt des Bruno Schulz folgt ihrer eigenen Logik, die Metamorphose ist ihr großes Thema.
Donnerstag, 28. Mai 2015
Note 101
Eine Sprache, die versucht, zu kommunizieren oder Kommunikation überhaupt aufzubauen, ist eine verfehlte Sprache. Sprache ist etwas, das für und durch sich selbst schwingt.
Schnittmengen
Die Kommunikation ist ein interstellares Lächeln;
Zungenzeichen treiben die Boten in die Irre. Es
Verschwinden die großen Trübsale, die mit
Schweren Trauben behalftert auf der Gegenseite
Eine rechtsdrehende Ausfahrt nutzen. Die Blässe
Ist vom ausstehenden Teint verursacht, einer
Marter, die zu überstehen ist, im Gegensatz zur
Syphilis, gegen die man an Schulen geimpft
Wird, die das Leben als etwas kennen, das
Rein zufällig durch den Gärprozeß
Ausgelöst wurde, den man in Erlenmeyerkolben
Nachbrodelt. Man häuft etwas Katzengold
An, wenn die Stille überhand zu nehmen
Droht, steckt in die Zigarette einen Nagel,
Der gegen Mangelerscheinungen hilft, spuckt auf den
Boden wie ein Professor, und masturbiert auf
Einem Fahrrad während der Sommermonate.
Alles in allem ist der Wahnsinn ein abgekartetes
Spiel, wo immer die Ampel eine weitere
Möglichkeit bereit hält, den Verkehr zu schockieren.
Truthahnfett rinnt über schlanke Wege, die Fallen
Erhöhen den Einsatz, an Menschenfleisch zu
Gelangen. In der Sänfte ein versteckter Dolch.
Außerhalb der Sonne tropft ein Vulkan in das
Paradies mit den symmetrischen Hörnern unter
Dem Haupthaar. Unter einer verbrannten Amsel
Entsteht ein neues Einkaufszentrum mit Tiefpreisen
Unter Null. Bienen werden beim schwarz-Honigmachen
Erwischt. Ihre Strafe soll sein die unbekannte
Königin. Allerdings hatte die Strecke auch ihr
Gutes, bestand nicht nur aus Kurven und Geraden,
Sondern ebenfalls aus einer Hypotenuse, die sich
Wie eine Krawatte binden ließ. Als du mich vor
Der Kommode entdecktest, war dir anzusehen, daß
Du es auf diese Art tun wolltest, die mich zur
Legende machen würde. Doch bräuchten wir hierfür nicht
Eine Menge Benzin? Meine Taschen waren längst
Zugenäht und deine hielten dem stürmischen Beifall
Kaum stand. Nur deshalb sprangen wir gemeinsam aus
Dem Fenster auf die Markise des Drachentöters.
Im Nachhinein hätten wir uns die Schuhe binden
Sollen, vielleicht wären wir dann woanders heraus-
Gekommen. So aber blieb uns
Der Trost des
Sommergewitters
Auf einer Schallplatte.
Zungenzeichen treiben die Boten in die Irre. Es
Verschwinden die großen Trübsale, die mit
Schweren Trauben behalftert auf der Gegenseite
Eine rechtsdrehende Ausfahrt nutzen. Die Blässe
Ist vom ausstehenden Teint verursacht, einer
Marter, die zu überstehen ist, im Gegensatz zur
Syphilis, gegen die man an Schulen geimpft
Wird, die das Leben als etwas kennen, das
Rein zufällig durch den Gärprozeß
Ausgelöst wurde, den man in Erlenmeyerkolben
Nachbrodelt. Man häuft etwas Katzengold
An, wenn die Stille überhand zu nehmen
Droht, steckt in die Zigarette einen Nagel,
Der gegen Mangelerscheinungen hilft, spuckt auf den
Boden wie ein Professor, und masturbiert auf
Einem Fahrrad während der Sommermonate.
Alles in allem ist der Wahnsinn ein abgekartetes
Spiel, wo immer die Ampel eine weitere
Möglichkeit bereit hält, den Verkehr zu schockieren.
Truthahnfett rinnt über schlanke Wege, die Fallen
Erhöhen den Einsatz, an Menschenfleisch zu
Gelangen. In der Sänfte ein versteckter Dolch.
Außerhalb der Sonne tropft ein Vulkan in das
Paradies mit den symmetrischen Hörnern unter
Dem Haupthaar. Unter einer verbrannten Amsel
Entsteht ein neues Einkaufszentrum mit Tiefpreisen
Unter Null. Bienen werden beim schwarz-Honigmachen
Erwischt. Ihre Strafe soll sein die unbekannte
Königin. Allerdings hatte die Strecke auch ihr
Gutes, bestand nicht nur aus Kurven und Geraden,
Sondern ebenfalls aus einer Hypotenuse, die sich
Wie eine Krawatte binden ließ. Als du mich vor
Der Kommode entdecktest, war dir anzusehen, daß
Du es auf diese Art tun wolltest, die mich zur
Legende machen würde. Doch bräuchten wir hierfür nicht
Eine Menge Benzin? Meine Taschen waren längst
Zugenäht und deine hielten dem stürmischen Beifall
Kaum stand. Nur deshalb sprangen wir gemeinsam aus
Dem Fenster auf die Markise des Drachentöters.
Im Nachhinein hätten wir uns die Schuhe binden
Sollen, vielleicht wären wir dann woanders heraus-
Gekommen. So aber blieb uns
Der Trost des
Sommergewitters
Auf einer Schallplatte.
Mittwoch, 27. Mai 2015
Felisberto Hernández
Das Leben eines Schriftstellers fern des Mainstreams ist in der Regel nicht zu beneiden. Talentiert, originell, von erfolgreicheren Schriftstellern bewundert und von der Öffentlichkeit ignoriert, plagen sie sich in ihrer Vergessenheit ab, sterben unbemerkt und geraten, wenn sie Glück haben, durch Irrwege wieder in Druck. Herman Melville ist vielleicht der berühmteste Nutznießer einer solchen Behandlung, die auch Nathanael West oder Henry Green geholfen hat.
Felisberto Hernández (1902 - 1964) hatte nicht so viel Glück. Er übte einen großen Einfluss auf Gabriel Garcia Márquez aus und wurde von Julio Cortázar und Italo Calvino bewundert, aber das brachte ihm nicht viel ein.
Hernández wurde in Uruguay geboren und verdiente seinen Lebensunterhalt am Klavier, spielte in Stummfilmkinos und Konzerthallen. Viermal war er verheiratet und jede seiner Frauen wurde es Leid, ihn durchzuziehen. Mit der gleichen Glücklosigkeit wie seine Ehen war seine literarische Arbeit behaftet. 1947 kam es zu seiner einzigen kommerziellen Veröffentlichung: Niemand zündet die Lampe an. Das verkaufte sich natürlich nicht. Erst 1983 erschien in Mexiko eine dreibändige Werkausgabe, und erst 1993 gab es eine englische Übersetzung (Piano Stories).
Weil es aber die Öffentlichkeit immer noch nicht interessierte, verschwanden die Bücher wieder in der Versenkung. 2006 kam die deutsche Übersetzung, eine große Resonanz blieb freilich aus. In Amerika wurde eine Neuauflage 2008 gewagt, und wie es aussieht, mit dem bisher größten Erfolg.
Liest man die Geschichten, wird sofort klar, warum das gewöhnliche Lesevieh nichts damit anzufangen weiß. Es gibt wohl weder in Amerika (Nord wie Süd), noch in Europa etwas, mit dem sich diese Texte vergleichen lassen, meist von einem namenlosen Ich-Erzähler vorgetragen, besessen von an sich toten Dingen oder fremden Häusern. Die Geschichten verfolgen keinen anderen Zweck als das eigene Vergnügen, L’art pour l’art.
In dem Essay Falsche Erklärung meiner Geschichten sagt Hernández: "Meine Geschichten folgen keiner logischen Struktur. Selbst jenes Bewußtsein, das unentwegt über sie wacht, ist mir unbekannt."
Das Setting der Geschichten ist in den meisten Fällen gespenstisch. Da gibt es geheimnisvolle Frauen, verfallene Häuser in einer isolierten und ritualisierten Atmosphäre, und trotzdem erfüllen sie niemals das plumpe Klischee einer Gespenstergeschichte, stehen der Dekadenz wesentlich näher als dem Spuk. Die toten Dinge in den Geschichten sind meistens eben doch lebendig, zum Bersten gefüllt mit Blut und Begehren.
Es ist genau dieser Umgang mit den Objekten, der Hernández so einzigartig macht. Die Struktur dieser Prosa folgt dem Empfinden eines Traumes. Nicht als bekäme man ihn erzählt, sondern als durchlebe man ihn selbst. Die längere Erzählung Die Hortensien ist das unbestreitbare Meisterwerk der Kollektion, und wohl das stärkste Argument dafür, warum diese Sammlung in jede Bibliothek des Phantastischen gehört, ohne Ausnahme, ohne Ausrede.
Einerseits gespenstisch, andererseits pervers, steht ein verheiratetes Ehepaar im Vordergrund - vor allem aber die Sammlung lebensgroßer Puppen des Ehemanns, von denen eine ganz genauso aussieht wie seine Frau. Die Mischung aus Eifersucht, Morbidität, Schabernack und ungesundem Verhalten treibt die Geschichte an und erzeugt eine der stärksten surrealen Empfindungen, die beim Lesen überhaupt entstehen kann. Wenige der anderen Erzählungen haben eine solche emotionale Wirkung.
Felisberto Hernández (1902 - 1964) hatte nicht so viel Glück. Er übte einen großen Einfluss auf Gabriel Garcia Márquez aus und wurde von Julio Cortázar und Italo Calvino bewundert, aber das brachte ihm nicht viel ein.
Hernández wurde in Uruguay geboren und verdiente seinen Lebensunterhalt am Klavier, spielte in Stummfilmkinos und Konzerthallen. Viermal war er verheiratet und jede seiner Frauen wurde es Leid, ihn durchzuziehen. Mit der gleichen Glücklosigkeit wie seine Ehen war seine literarische Arbeit behaftet. 1947 kam es zu seiner einzigen kommerziellen Veröffentlichung: Niemand zündet die Lampe an. Das verkaufte sich natürlich nicht. Erst 1983 erschien in Mexiko eine dreibändige Werkausgabe, und erst 1993 gab es eine englische Übersetzung (Piano Stories).
Weil es aber die Öffentlichkeit immer noch nicht interessierte, verschwanden die Bücher wieder in der Versenkung. 2006 kam die deutsche Übersetzung, eine große Resonanz blieb freilich aus. In Amerika wurde eine Neuauflage 2008 gewagt, und wie es aussieht, mit dem bisher größten Erfolg.
Liest man die Geschichten, wird sofort klar, warum das gewöhnliche Lesevieh nichts damit anzufangen weiß. Es gibt wohl weder in Amerika (Nord wie Süd), noch in Europa etwas, mit dem sich diese Texte vergleichen lassen, meist von einem namenlosen Ich-Erzähler vorgetragen, besessen von an sich toten Dingen oder fremden Häusern. Die Geschichten verfolgen keinen anderen Zweck als das eigene Vergnügen, L’art pour l’art.
In dem Essay Falsche Erklärung meiner Geschichten sagt Hernández: "Meine Geschichten folgen keiner logischen Struktur. Selbst jenes Bewußtsein, das unentwegt über sie wacht, ist mir unbekannt."
Das Setting der Geschichten ist in den meisten Fällen gespenstisch. Da gibt es geheimnisvolle Frauen, verfallene Häuser in einer isolierten und ritualisierten Atmosphäre, und trotzdem erfüllen sie niemals das plumpe Klischee einer Gespenstergeschichte, stehen der Dekadenz wesentlich näher als dem Spuk. Die toten Dinge in den Geschichten sind meistens eben doch lebendig, zum Bersten gefüllt mit Blut und Begehren.
Es ist genau dieser Umgang mit den Objekten, der Hernández so einzigartig macht. Die Struktur dieser Prosa folgt dem Empfinden eines Traumes. Nicht als bekäme man ihn erzählt, sondern als durchlebe man ihn selbst. Die längere Erzählung Die Hortensien ist das unbestreitbare Meisterwerk der Kollektion, und wohl das stärkste Argument dafür, warum diese Sammlung in jede Bibliothek des Phantastischen gehört, ohne Ausnahme, ohne Ausrede.
Einerseits gespenstisch, andererseits pervers, steht ein verheiratetes Ehepaar im Vordergrund - vor allem aber die Sammlung lebensgroßer Puppen des Ehemanns, von denen eine ganz genauso aussieht wie seine Frau. Die Mischung aus Eifersucht, Morbidität, Schabernack und ungesundem Verhalten treibt die Geschichte an und erzeugt eine der stärksten surrealen Empfindungen, die beim Lesen überhaupt entstehen kann. Wenige der anderen Erzählungen haben eine solche emotionale Wirkung.
Dienstag, 26. Mai 2015
Thorns Bouquet
wo ihr jetzt zu den Windmühlen gelangt
& die Wassermenschen jagt mit Sonar
verachte ich euch tiefer, wünsche euch
die Schrecken jedes einzelnen Fluchs
jeder einzelnen schwarzen Gallsaftlippe
aller Zeiten
alle Qualen
es ist der falsche Jasmin, der diesen
Wachtraum verursacht, in dem die
Erkenntnis steckt, dass der Mensch in
seiner Seele eine Welt vergangener
Existenzen trägt
vom fetten Wahn wie
Trauben springen
ein ausge-
peitschter Wurm peitscht hinterlistig
nie näher an den Traum, man
gelangt nie näher hin zum Staub
& die Wassermenschen jagt mit Sonar
verachte ich euch tiefer, wünsche euch
die Schrecken jedes einzelnen Fluchs
jeder einzelnen schwarzen Gallsaftlippe
aller Zeiten
alle Qualen
es ist der falsche Jasmin, der diesen
Wachtraum verursacht, in dem die
Erkenntnis steckt, dass der Mensch in
seiner Seele eine Welt vergangener
Existenzen trägt
vom fetten Wahn wie
Trauben springen
ein ausge-
peitschter Wurm peitscht hinterlistig
nie näher an den Traum, man
gelangt nie näher hin zum Staub
Montag, 25. Mai 2015
Stefan Grabinski
Stefan Gabrinski (1887-1936) war ein polnischer Autor, der hauptsächlich außerhalb seines Landes für seine überragenden Kurzgeschichten bekannt war, deren Großteil er zwischen 1908 und 1922 verfasste. Die meisten seiner Erzählungen – Geschichten voller Intensität und sexueller Eindeutigkeit, die man zu dieser Zeit so nicht kannte – fanden Platz in sechs Kollektionen.
Wie bei vielen Autoren seiner Zeit, die zutiefst vom ersten Weltkrieg und der damals kriegführenden Staatlichkeit in Mitleidenschaft gezogen wurden, blieb die sie umgebende Welt aus ihrer literarische Arbeit ausgeschlossen. Es gab darin keine politische Agenda. Für Grabinski waren die Beklemmungen der Existenz und ihrer Folgen nicht durch so etwas grauenhaft Banales und Sinnloses wie Politik aufzulösen.
Die Geschichten aus Demon ruchu (engl. The Motion Demon) sind für ihren ausgiebigen Gebrauch von Zügen (als Maschinen der Befreiung) bemerkenswert, die die Flucht aus dem beengenden provinziellen Leben in Polen ermöglichen. Flucht und Bewegung sind die Synonyme in Grabinskis gesamter Arbeit. Darüberhinaus kann die Dynamik der Bewegung, die so weitläufig und kraftvoll in der oben genannten Sammlung gezeichnet wird, auch als Metapher des immerwährenden Flusses definiert werden, den Strom des Lebens oder der Lebensenergie, die keinen erkennbaren Ursprung hat und keinen Zweck erfüllt. Hier kommt Grabinski den philosophischen Konzepten eines Henri Bergson ziemlich nahe.
Der erste Satz von “In the Compartment” (Im Abteil) – “Der Zug schoss durch das offene Land mit der Geschwindigkeit eines Gedankens” – definiert bereits den schwungvollen Charakter seiner Prosa. Die Erzählung porträtiert einen typischen Grabinski-Protagonisten, der übersinnliche Kräfte erlangt, sobald er einen fahrenden Zug besteigt und der eine verheiratete Frau derartig berauscht, dass sie sich auf eine verhängnisvolle Orgie einlässt.
“The Wandering Train” zeigt eine Art Geisterzug aus einer anderen Dimension. Bosheit und beißender Witz kennzeichnen in der Regel das Verhältnis zwischen den Protagonisten und ihrer Doppelgänger in Geschichten wie “Strabismus” (Schielen), und es liegt vielleicht gerade an der grellen Wildheit seines (Grabinskis) Witzes, die den Geschichten um eine projizierten Psychose ihre Plausibilität verleiht, so als ob die Psychose schlussendlich die Welt verdrängt.
Offenkundig fasziniert von der Möglichkeit, dass die Welt nur das Spiegelbild eines allmächtigen Gedankens ist, und dass hinter der Fassade des Sichtbaren eine andere Dimension liegt, die über Phänomene wie Hypnose und Telepathie nachweisbar ist, glaubte Grabinski, dass es die der Kunst zugrundeliegende Aufgabe ist, all das zu entlarven, was von den “realistischen Traditionen” schlicht als unerklärlich abgetan wird. Daher war es für ihn natürlich, die Phantastische Literatur als die der höchsten künstlerischen Originalität wahrzunehmen, als Literatur der Ideen also – und sie nicht nur im Sinne der reinen Unterhaltung zu sehen.
In erster Linie gibt es nach Grabinski zwei Arten von Phantastischer Literatur: konventionelle oder “Äußere Phantastik”, deren Bildsprache sich aus der Tradition der Folklore und Märchen speist, aus Romantik und Neoromantik ableitet; und “Innerer Phantastik”, eingebettet in Psychologie, Philosophie und Metaphysik. Hierfür prägte er zwei unterschiedliche Begriffe: “Psychofantasy” und “Metafantastika”, die jeweils bestimmte psychologische und metaphysische Phänomene überprüfen, die der Wissenschaft bisher noch unzugänglich sind, um dem Leser Schlussfolgerungen metaphysischer Natur vorzulegen. Seine theoretischen Ansichten entstanden hauptsächlich in den 1920er Jahren, die als seine Produktivsten gelten müssen.
Außer Erzählungen, Romanen und Aufsätzen schrieb er auch Theaterstücke, von denen Willa nad morzem (Die Villa am Meer) 1921 in Warschau, Krakau und Lemberg aufgeführt wurde. Grabinskis spätere Karriere war fast ausschließlich seinen Romanen gewidmet, von denen nur Der Schatten des Satans ins Deutsche übersetzt wurde. Diese (4) Romane bezeugten seine wachsende Anziehungskraft für das Okkulte und Visionäre. Salamandra (Salamander) (1924) – sein Debut – enthält die lebendige Schilderung eines Sabbat und anderen obskuren Praktiken, aber im Großen und Ganzen leidet der Roman an einer unzusammenhängenden Handlung, die dazu noch mit Details überladen ist. Wohl mit dem Ziel, mit seinem Fachwissen zu prahlen, fährt er zugegebenermaßen das gesamte Spektrum seiner Quellen und Interessen auf, die von Hypnose über Dämonologie bis hin zu magischen Ritualen führt. Keiner seiner Romane kann sich auch nur im Ansatz mit seinen Kurzgeschichten messen. Natürlich ist es schade, dass dieser große Klassiker der Phantastischen Literatur keine Neuauflage bestehender Sammlungen, geschweige denn auf weitere Übersetzungen hoffen darf Aber dieser Standartsatz gilt für das ganze Spektrum der Phantastischen Literatur in Deutschland.
Wie bei vielen Autoren seiner Zeit, die zutiefst vom ersten Weltkrieg und der damals kriegführenden Staatlichkeit in Mitleidenschaft gezogen wurden, blieb die sie umgebende Welt aus ihrer literarische Arbeit ausgeschlossen. Es gab darin keine politische Agenda. Für Grabinski waren die Beklemmungen der Existenz und ihrer Folgen nicht durch so etwas grauenhaft Banales und Sinnloses wie Politik aufzulösen.
Die Geschichten aus Demon ruchu (engl. The Motion Demon) sind für ihren ausgiebigen Gebrauch von Zügen (als Maschinen der Befreiung) bemerkenswert, die die Flucht aus dem beengenden provinziellen Leben in Polen ermöglichen. Flucht und Bewegung sind die Synonyme in Grabinskis gesamter Arbeit. Darüberhinaus kann die Dynamik der Bewegung, die so weitläufig und kraftvoll in der oben genannten Sammlung gezeichnet wird, auch als Metapher des immerwährenden Flusses definiert werden, den Strom des Lebens oder der Lebensenergie, die keinen erkennbaren Ursprung hat und keinen Zweck erfüllt. Hier kommt Grabinski den philosophischen Konzepten eines Henri Bergson ziemlich nahe.
Der erste Satz von “In the Compartment” (Im Abteil) – “Der Zug schoss durch das offene Land mit der Geschwindigkeit eines Gedankens” – definiert bereits den schwungvollen Charakter seiner Prosa. Die Erzählung porträtiert einen typischen Grabinski-Protagonisten, der übersinnliche Kräfte erlangt, sobald er einen fahrenden Zug besteigt und der eine verheiratete Frau derartig berauscht, dass sie sich auf eine verhängnisvolle Orgie einlässt.
“The Wandering Train” zeigt eine Art Geisterzug aus einer anderen Dimension. Bosheit und beißender Witz kennzeichnen in der Regel das Verhältnis zwischen den Protagonisten und ihrer Doppelgänger in Geschichten wie “Strabismus” (Schielen), und es liegt vielleicht gerade an der grellen Wildheit seines (Grabinskis) Witzes, die den Geschichten um eine projizierten Psychose ihre Plausibilität verleiht, so als ob die Psychose schlussendlich die Welt verdrängt.
Offenkundig fasziniert von der Möglichkeit, dass die Welt nur das Spiegelbild eines allmächtigen Gedankens ist, und dass hinter der Fassade des Sichtbaren eine andere Dimension liegt, die über Phänomene wie Hypnose und Telepathie nachweisbar ist, glaubte Grabinski, dass es die der Kunst zugrundeliegende Aufgabe ist, all das zu entlarven, was von den “realistischen Traditionen” schlicht als unerklärlich abgetan wird. Daher war es für ihn natürlich, die Phantastische Literatur als die der höchsten künstlerischen Originalität wahrzunehmen, als Literatur der Ideen also – und sie nicht nur im Sinne der reinen Unterhaltung zu sehen.
In erster Linie gibt es nach Grabinski zwei Arten von Phantastischer Literatur: konventionelle oder “Äußere Phantastik”, deren Bildsprache sich aus der Tradition der Folklore und Märchen speist, aus Romantik und Neoromantik ableitet; und “Innerer Phantastik”, eingebettet in Psychologie, Philosophie und Metaphysik. Hierfür prägte er zwei unterschiedliche Begriffe: “Psychofantasy” und “Metafantastika”, die jeweils bestimmte psychologische und metaphysische Phänomene überprüfen, die der Wissenschaft bisher noch unzugänglich sind, um dem Leser Schlussfolgerungen metaphysischer Natur vorzulegen. Seine theoretischen Ansichten entstanden hauptsächlich in den 1920er Jahren, die als seine Produktivsten gelten müssen.
Außer Erzählungen, Romanen und Aufsätzen schrieb er auch Theaterstücke, von denen Willa nad morzem (Die Villa am Meer) 1921 in Warschau, Krakau und Lemberg aufgeführt wurde. Grabinskis spätere Karriere war fast ausschließlich seinen Romanen gewidmet, von denen nur Der Schatten des Satans ins Deutsche übersetzt wurde. Diese (4) Romane bezeugten seine wachsende Anziehungskraft für das Okkulte und Visionäre. Salamandra (Salamander) (1924) – sein Debut – enthält die lebendige Schilderung eines Sabbat und anderen obskuren Praktiken, aber im Großen und Ganzen leidet der Roman an einer unzusammenhängenden Handlung, die dazu noch mit Details überladen ist. Wohl mit dem Ziel, mit seinem Fachwissen zu prahlen, fährt er zugegebenermaßen das gesamte Spektrum seiner Quellen und Interessen auf, die von Hypnose über Dämonologie bis hin zu magischen Ritualen führt. Keiner seiner Romane kann sich auch nur im Ansatz mit seinen Kurzgeschichten messen. Natürlich ist es schade, dass dieser große Klassiker der Phantastischen Literatur keine Neuauflage bestehender Sammlungen, geschweige denn auf weitere Übersetzungen hoffen darf Aber dieser Standartsatz gilt für das ganze Spektrum der Phantastischen Literatur in Deutschland.
Sonntag, 24. Mai 2015
Anna Kavan
Anna Kavans unverkennbarer, markanter Stil wurde von so unterschiedlichen Autoren wie Brian Aldiss, J.G. Ballard, Doris Lessing und Anais Nin bewundert.
Sie wurde als "Helen Woods" in Cannes, Frankreich am 10 April, 1901 als Tochter wohlhabender Britischer Auswanderer geboren. Anna verbrachte ihre Kindheit in verschiedenen Europäischen Ländern, in Kalifornien und England. Sie heiratete Donald Ferguson und lebte eine geraume Zeit in Burma. Die Ehe scheiterte, aber es war dies die Zeit, in der sie mit dem Schreiben begann.
Anna Kavan heiratete noch einmal. Aufzeichnungen über diese zweite Ehe existieren nicht. Erneut lebte sie in verschiedenen Europäischen Ländern, bevor sie sich in England niederließ. Es erschienen in dieser Zeit einige Bücher von ihr, die sie unter dem Namen Helen Ferguson veröffentlichte. Zunächst waren das noch traditionelle Erzählwerke. Erst später entwickelte sie ihren einzigartigen und anspruchsvollen Stil.
Um 1926 nahm sie immer öfter Heroin zu sich, um die zeit ihres Lebens auftretenden, teils schweren Depressionen in Schach zu halten. Ihre anhaltende psychische Erkrankung, wie auch die Veränderung ihres Schreibstils, waren das Ergebnis eines Zusammenbruchs. Nach diesem änderte sie ebenfalls ihr Äußeres und ihren Lebenswandel radikal. Das führte schließlich zum Namen Anna Kavan, einer Figur aus ihrem Roman "Let Me Alone", mit der sie sich identifizierte. Mehrer Male versuchte sie den Entzug, wurde aber wieder und wieder rückfällig. Sie nannte die Heroinspritze ihre "Bazooka". Selbst während ihrer depressiven Episoden hielt sie am Schreiben fest. Die Zeiten ihrer akuten Phasen verbrachte sie in Kliniken in der Schweiz oder in England. Dort sammelte sie auch Material für ein Werk, das in einer Klinik spielen sollte. Neben ihrer Schriftstellerei brachte sie es in London zu einigen Ausstellungen ihrer Gemälde.
Zeit ihres Lebens blieb sie eine schwierige Person. Je näher ihr Ende rückte, desto mehr zog sie sich zurück. Dennoch besaß sie einen kleinen Freundeskreis, der ihre Probleme und ihr exzentrisches Verhalten wohlwollend übersah. Sie starb, nachdem sie mehreren Selbstmordversuche überlebt hatte am 5. Dezember 1968 an Herzversagen. Ihr bekanntest Roman ist "Ice".
Auszüge aus: Anna Kavan, Jlia & the Bazooka, 1970 (Julia und die Bazooka. Novellen und Erzählungen)
Übersetzt von Michael Perkampus
Der Verkehr brüllt, bellt, schleudert sich selbst in einer reißenden Woge in die Schlacht - Autos schlagen wie urzeitliche Monster um sich. Manche haben das Grinsen teuflischer Lust in ihren bösartigen, rudimentären Gesichtern stehen, Schadenfreude über zukünftige Opfer. Sie ahnen den Moment voraus, in dem ihr mörderisches Gewicht, bestehend aus hartem Schwermetall, weiches, verletzliches, schutzloses Fleisch zerreißt, es zu einem Brei anrührt, in dünnen Schichten über die Fahrbahn verteilt, eine tückische, rutschige Fläche anrichtet, auf der andere Autos im Kreis schleudern, ihre Reifen mit den Wurstpellen aus Gedärm verheddert, das aus dem ganzen Schlamassel platzt. Plötzlich merke ich, dass ein Auto mich als Beute ausgewählt hat und auf direktem Wege durch das Chaos auf mich zusteuert. (p.5)
Da das Universum nur in meinem Kopf existiert, muss ich selbst diesen Ort erschaffen haben, abscheulich und verdorben, wie er ist. (p.8)
Während ich ihn beobachtete, atmete ich die ganze Zeit über seinen natürlichen Geruch ein, den wilden urzeitlichen Duft von Sonnenschein, Freiheit, Mond und zerkleinerten Blättern, kombiniert mit der kühlen Frische fleckiger Tierhaut, noch klamm von der mitternächtlichen Feuchtigkeit der Dschungelpflanzen. (p.11)
Der Vorfall wurde übermäßig verlängert. Das merkwürdiges Katzengeschrei hörte nicht mehr auf, und undeutliche Formen brachen daraus hervor. Als es endlich vorbei war, fuhr ich weiter, als wäre nichts geschehen. Es war ja auch nichts geschehen, wirklich nicht. (p.22)
Alles ging weiter und weiter: der Nebel, der Scheibenwischer, meine Fahrt. Es war so, als wüsste ich nicht, wie man das Auto anhielt, und als müsste ich so lange weiter fahren, bis der Tank leer wäre, oder bis alle Wege zu ihrem Ende kommen würden.(p.22)
Alles, was ich wollte, war, dass alles so weiterging wie bisher, so dass ich in tiefem Schlaf verbleiben konnte, und nicht mehr wäre als ein Loch im Raum, weder hier noch sonstwo, so lange wie möglich, am liebsten für immer. (p.29)
Weiß, still, heiter und kühl, um mich an die unnahbaren, makellosen, schneebedeckten Berge zu erinnern; Rot für den Kontrast, für Liebe und Rosen, für Gefahr, Gewalt, Blut. (p.30)
Unglück türmt sich über ihnen auf wie ein Kreis vereister Berge, die unerbittlich näher rücken. (p.49)
Ich wusste, dass sie es getan hatten, also muss ich sie gehört und gefühlt haben, aber es war in einem anderen Raum geschehen und betraf mich nicht. Ich würde nicht zurück kommen, und es gab nichts, was sie dagegen tun konnten. (p.76)
"Eine Person ist entweder hier oder sie ist nicht hier, stimmts? Und wenn sie nicht hier ist, dann muss sie woanders sein, was bedeutet, sie ist verschwunden..." (p.77)
Schneebedeckte Gipfel ragen überall in den Himmel, bleich wie Phantome in der Nacht, breite, körperlose Geisterschatten, größer als das Leben. Sie fließen in leuchtender Blässe, die Sichel des Mondes gleitet zwischen sie. Fahre ich oder träume ich? Traumhaft sind diese kolossalen, fantastischen Berge, unnahbar wie Götter. Traumhaft dieser aus dem Himmel fallende Mond. Eine endlose Traumstraße, stets spiralförmig nach oben. Alptraumstraße, stets am Rande schwindelnder Abgründe, eines Messers Schneide, die sich immer steiler und schärfer nach oben dreht. Soll ich überhaupt zur nächsten Biegung gelangen? (p.100)
Die Scheinwerfer werfen erneut ihr Streulicht von sich, stechen vorwärts, verwandeln sich in einen Gegenstand, der etwas aufspießt, etwas ausweidet. Vier Gestalten werden festgenagelt, vier weiße Gesichter, erschreckend nahe. Sie heben sich ab vor dem Hintergrund der taumelnden Berge, weiße Fischgesichter, erstarrt, mit offenen Mündern. Die Luft wird kälter und dunkler, Donnergrollen im Eis; eiskalt von den Anhöhen ausgeatmet wie ein Befehl. Die Vormachtstellung des Hochgebirges macht sich geltend. (p.100-101)
Sie wurde als "Helen Woods" in Cannes, Frankreich am 10 April, 1901 als Tochter wohlhabender Britischer Auswanderer geboren. Anna verbrachte ihre Kindheit in verschiedenen Europäischen Ländern, in Kalifornien und England. Sie heiratete Donald Ferguson und lebte eine geraume Zeit in Burma. Die Ehe scheiterte, aber es war dies die Zeit, in der sie mit dem Schreiben begann.
Anna Kavan heiratete noch einmal. Aufzeichnungen über diese zweite Ehe existieren nicht. Erneut lebte sie in verschiedenen Europäischen Ländern, bevor sie sich in England niederließ. Es erschienen in dieser Zeit einige Bücher von ihr, die sie unter dem Namen Helen Ferguson veröffentlichte. Zunächst waren das noch traditionelle Erzählwerke. Erst später entwickelte sie ihren einzigartigen und anspruchsvollen Stil.
Um 1926 nahm sie immer öfter Heroin zu sich, um die zeit ihres Lebens auftretenden, teils schweren Depressionen in Schach zu halten. Ihre anhaltende psychische Erkrankung, wie auch die Veränderung ihres Schreibstils, waren das Ergebnis eines Zusammenbruchs. Nach diesem änderte sie ebenfalls ihr Äußeres und ihren Lebenswandel radikal. Das führte schließlich zum Namen Anna Kavan, einer Figur aus ihrem Roman "Let Me Alone", mit der sie sich identifizierte. Mehrer Male versuchte sie den Entzug, wurde aber wieder und wieder rückfällig. Sie nannte die Heroinspritze ihre "Bazooka". Selbst während ihrer depressiven Episoden hielt sie am Schreiben fest. Die Zeiten ihrer akuten Phasen verbrachte sie in Kliniken in der Schweiz oder in England. Dort sammelte sie auch Material für ein Werk, das in einer Klinik spielen sollte. Neben ihrer Schriftstellerei brachte sie es in London zu einigen Ausstellungen ihrer Gemälde.
Zeit ihres Lebens blieb sie eine schwierige Person. Je näher ihr Ende rückte, desto mehr zog sie sich zurück. Dennoch besaß sie einen kleinen Freundeskreis, der ihre Probleme und ihr exzentrisches Verhalten wohlwollend übersah. Sie starb, nachdem sie mehreren Selbstmordversuche überlebt hatte am 5. Dezember 1968 an Herzversagen. Ihr bekanntest Roman ist "Ice".
Auszüge aus: Anna Kavan, Jlia & the Bazooka, 1970 (Julia und die Bazooka. Novellen und Erzählungen)
Übersetzt von Michael Perkampus
Der Verkehr brüllt, bellt, schleudert sich selbst in einer reißenden Woge in die Schlacht - Autos schlagen wie urzeitliche Monster um sich. Manche haben das Grinsen teuflischer Lust in ihren bösartigen, rudimentären Gesichtern stehen, Schadenfreude über zukünftige Opfer. Sie ahnen den Moment voraus, in dem ihr mörderisches Gewicht, bestehend aus hartem Schwermetall, weiches, verletzliches, schutzloses Fleisch zerreißt, es zu einem Brei anrührt, in dünnen Schichten über die Fahrbahn verteilt, eine tückische, rutschige Fläche anrichtet, auf der andere Autos im Kreis schleudern, ihre Reifen mit den Wurstpellen aus Gedärm verheddert, das aus dem ganzen Schlamassel platzt. Plötzlich merke ich, dass ein Auto mich als Beute ausgewählt hat und auf direktem Wege durch das Chaos auf mich zusteuert. (p.5)
Da das Universum nur in meinem Kopf existiert, muss ich selbst diesen Ort erschaffen haben, abscheulich und verdorben, wie er ist. (p.8)
Während ich ihn beobachtete, atmete ich die ganze Zeit über seinen natürlichen Geruch ein, den wilden urzeitlichen Duft von Sonnenschein, Freiheit, Mond und zerkleinerten Blättern, kombiniert mit der kühlen Frische fleckiger Tierhaut, noch klamm von der mitternächtlichen Feuchtigkeit der Dschungelpflanzen. (p.11)
Der Vorfall wurde übermäßig verlängert. Das merkwürdiges Katzengeschrei hörte nicht mehr auf, und undeutliche Formen brachen daraus hervor. Als es endlich vorbei war, fuhr ich weiter, als wäre nichts geschehen. Es war ja auch nichts geschehen, wirklich nicht. (p.22)
Alles ging weiter und weiter: der Nebel, der Scheibenwischer, meine Fahrt. Es war so, als wüsste ich nicht, wie man das Auto anhielt, und als müsste ich so lange weiter fahren, bis der Tank leer wäre, oder bis alle Wege zu ihrem Ende kommen würden.(p.22)
Alles, was ich wollte, war, dass alles so weiterging wie bisher, so dass ich in tiefem Schlaf verbleiben konnte, und nicht mehr wäre als ein Loch im Raum, weder hier noch sonstwo, so lange wie möglich, am liebsten für immer. (p.29)
Weiß, still, heiter und kühl, um mich an die unnahbaren, makellosen, schneebedeckten Berge zu erinnern; Rot für den Kontrast, für Liebe und Rosen, für Gefahr, Gewalt, Blut. (p.30)
Unglück türmt sich über ihnen auf wie ein Kreis vereister Berge, die unerbittlich näher rücken. (p.49)
Ich wusste, dass sie es getan hatten, also muss ich sie gehört und gefühlt haben, aber es war in einem anderen Raum geschehen und betraf mich nicht. Ich würde nicht zurück kommen, und es gab nichts, was sie dagegen tun konnten. (p.76)
"Eine Person ist entweder hier oder sie ist nicht hier, stimmts? Und wenn sie nicht hier ist, dann muss sie woanders sein, was bedeutet, sie ist verschwunden..." (p.77)
Schneebedeckte Gipfel ragen überall in den Himmel, bleich wie Phantome in der Nacht, breite, körperlose Geisterschatten, größer als das Leben. Sie fließen in leuchtender Blässe, die Sichel des Mondes gleitet zwischen sie. Fahre ich oder träume ich? Traumhaft sind diese kolossalen, fantastischen Berge, unnahbar wie Götter. Traumhaft dieser aus dem Himmel fallende Mond. Eine endlose Traumstraße, stets spiralförmig nach oben. Alptraumstraße, stets am Rande schwindelnder Abgründe, eines Messers Schneide, die sich immer steiler und schärfer nach oben dreht. Soll ich überhaupt zur nächsten Biegung gelangen? (p.100)
Die Scheinwerfer werfen erneut ihr Streulicht von sich, stechen vorwärts, verwandeln sich in einen Gegenstand, der etwas aufspießt, etwas ausweidet. Vier Gestalten werden festgenagelt, vier weiße Gesichter, erschreckend nahe. Sie heben sich ab vor dem Hintergrund der taumelnden Berge, weiße Fischgesichter, erstarrt, mit offenen Mündern. Die Luft wird kälter und dunkler, Donnergrollen im Eis; eiskalt von den Anhöhen ausgeatmet wie ein Befehl. Die Vormachtstellung des Hochgebirges macht sich geltend. (p.100-101)
Samstag, 23. Mai 2015
Kurze Notiz zur New York School of Poetry
Die New York School of Poetry wurde etwa um 1960 als solche bezeichnet, um Dichter wie John Ashbery, Barbara Guest, Kenneth Koch und Frank O'Hara zu einem Deutungskreis zusammenzufassen. Obwohl die New York School of Poetry niemals wirklich eine Schule war, etablierte sich der Name, der als Etikett für eine Generation amerikanischer Dichter von Bernhard Meyers als Gegenpol zur New York School of painting gewinnbringend für die Presse aufgewertet wurde. Meyers stand seinerzeit der Tibor de Nagy Gallery vor und sah wohl in den stark vom Surrealismus, Modernismus und dem abstrakten Expressionismus beeinflussten Dichtern eine Gemeinsamkeit, die es zu etikettieren galt, obwohl die dort zusammengefassten Dichter durchaus erhebliche Unterschiede aufwiesen. Hinzu kommt, dass der berühmteste unter ihnen, John Ashbery, zu jener Zeit in Frankreich lebte.
Tatsächlich aber pflegten die New York Poets intensiven Verkehr mit Künstlern wie Jackson Pollock und Willem DeKooning. O'Hara arbeiteten für das Museum of Modern Art; Ashbery und James Schuyler schrieben Kritiken für Art News. O'Hara bezog seine Inspiration durchaus von Künstlern, was zwei seiner Gedichte bezeugen: "Joseph Cornell" und "On Seeing Larry Rivers’ Washington Crossing the Delaware at the Museum of Modern Art.” Sein Gedicht “Why I am Not a Painter” beeinhalten die Zeilen “I am not a painter, I am a poet. / Why? I think I would rather be / a painter, but I am not.”
Eine zweite Generation der New York School poets etablierte sich in den 60ern. Dazu gehörten Ted Berrigan, Ron Padgett, Anne Waldman, und Joe Brainard. Sie alle waren ebenfalls von der Kunstszene beeinflusst. Diese Szene wuchs in New York, downtown, heran, einhergehend mit der Dichterorganisation St. Mark's Church.
Die New York School beeinflusst noch immer die Dichter, die heute schreiben und gilt als die letzte Avantgarde. Selbst in Deutschland, einem Nachzügler jeglicher literarischer Entwicklung, wurden zuletzt Ashberys "Flussbild" oder Kenneth Kochs "Frischluft" übersetzt (ersteres im Original 1991 erschienen, zweiteres 1979). Erhältlich bei Luxbooks, die unter ihrer Rubrik "amerikana" den Anschluss wahren.
Tatsächlich aber pflegten die New York Poets intensiven Verkehr mit Künstlern wie Jackson Pollock und Willem DeKooning. O'Hara arbeiteten für das Museum of Modern Art; Ashbery und James Schuyler schrieben Kritiken für Art News. O'Hara bezog seine Inspiration durchaus von Künstlern, was zwei seiner Gedichte bezeugen: "Joseph Cornell" und "On Seeing Larry Rivers’ Washington Crossing the Delaware at the Museum of Modern Art.” Sein Gedicht “Why I am Not a Painter” beeinhalten die Zeilen “I am not a painter, I am a poet. / Why? I think I would rather be / a painter, but I am not.”
Eine zweite Generation der New York School poets etablierte sich in den 60ern. Dazu gehörten Ted Berrigan, Ron Padgett, Anne Waldman, und Joe Brainard. Sie alle waren ebenfalls von der Kunstszene beeinflusst. Diese Szene wuchs in New York, downtown, heran, einhergehend mit der Dichterorganisation St. Mark's Church.
Die New York School beeinflusst noch immer die Dichter, die heute schreiben und gilt als die letzte Avantgarde. Selbst in Deutschland, einem Nachzügler jeglicher literarischer Entwicklung, wurden zuletzt Ashberys "Flussbild" oder Kenneth Kochs "Frischluft" übersetzt (ersteres im Original 1991 erschienen, zweiteres 1979). Erhältlich bei Luxbooks, die unter ihrer Rubrik "amerikana" den Anschluss wahren.
Choks
Die Verstiegenheit, die uns zu Mördern macht,
wie wir noch nie welche gewesen sind,
die wir noch nie in Worte fassen konnten,
die wir noch nie in einem Zug tranken, das
Glas noch am Ast,
der Ast noch im Auge,
das Blut noch im Glas;
diese Verstiegenheit, die sich äußert,
wenn wir Mörder jedweder Art sind.
Die Lichtung ist schwarz, ein Ort der Ekstase, ein
Ballsaal für Wünsche, die sich nicht einschließen lassen,
sich reproduzieren lassen.
Vermehrung ist Auszehrung, hierzulande
Verdoppelung Beliebigkeit muß man müssen,
Der Flaneur, ein Kaleidoskop, das mit
Bewußtsein versehen ist, läßt abklatschen die Gestalt
der offenbarten Dinge.
sonst darf man nicht.
wie wir noch nie welche gewesen sind,
die wir noch nie in Worte fassen konnten,
die wir noch nie in einem Zug tranken, das
Glas noch am Ast,
der Ast noch im Auge,
das Blut noch im Glas;
diese Verstiegenheit, die sich äußert,
wenn wir Mörder jedweder Art sind.
Die Lichtung ist schwarz, ein Ort der Ekstase, ein
Ballsaal für Wünsche, die sich nicht einschließen lassen,
sich reproduzieren lassen.
Vermehrung ist Auszehrung, hierzulande
Verdoppelung Beliebigkeit muß man müssen,
Der Flaneur, ein Kaleidoskop, das mit
Bewußtsein versehen ist, läßt abklatschen die Gestalt
der offenbarten Dinge.
sonst darf man nicht.
Freitag, 22. Mai 2015
Unica Zürn
In den 60iger Jahren brachte die Malerin und Schriftstellerin einige psychologisch interessante Strichzeichnungen hervor, die den surrealistischen Automatismus mit der Art Brut verband. Auch hinterließen die zu dieser Zeit üblichen psychedelischen Drogen ihre Spuren. Bizarre Kreaturen mit doppelten Gesichtern, komplexe Traumlandschaften, mystische Tiere oder unweltliche Pflanzen bestimmen ihr zeichnerisches Werk.
Tochter einer wohlhabenden Familie, wuchs sie in Berlin, umgeben von exotischen Gegenständen auf, die ihr Vater, ein in Afrika stationierter Offizier, sammelte. Es wird nicht ausgeblieben sein, dass dies die lebhafte Vorstellungskraft der Künstlerin zu steigern wusste. Möglicherweise - und davon geben ihre späten Zeichnungen ebenfalls Kunde, inspirierten sie zusätzlich ödipale Sehnsüchte.
1953 lernte sie den in Paris lebenden, deutschen Surrealisten Hans Bellmer kennen, verliebte sich in ihn und folgte ihm nach Paris, um als seine Muse zu fungieren und um mit ihm zu arbeiten. Bellmer hat ein Buch über diese ungewöhnliche Beziehung geschrieben, das 1957 erschien: Petit trait de l'inconscient physique ou anatomie de l'image (In deutscher Sprache erst 2014 bei Brinkmann & Bose: Kleine Anatomie des körperlichen Unbewussten oder die Anatomie des Bildes).
1958 entschloss Belmer sich von seinen obligatorischen Puppen zu verabschieden, um mit echten Frauen zu arbeiten. Zusammen mit Unica Zürn entstanden einige denkwürdige Fotographien, an denen außer ihr auch die Dichterin Nora Mitrani als Modell beteiligt war.
Zürn wurde Mitglied des Kreises der Surrealisten um Andrè Breton, lernte Man Ray kennen und - hier nahm wol ihr Schicksal seinen Lauf - Henri Michaux. Michaux nahm Meskalin als Teil seiner persönlichen Forschung über das menschliche Bewusstsein. Als Unica Zürn an einem solchen Experiment teilnahm, löste das die erste einer Reihe psychischer Krisen bei ihr aus, von denen einige in ihren Schriften dokumentiert werden und die sie die letzten dreizehn Jahre ihres Lebens plagten.
Diagnostiziert wurde Schizophrenie. Krankenhausaufenthalte in Berlin, Paris und La Rochelle schlossen sich an. Viele ihrer Zeichnungen, die bei Ubu zu sehen sind, entstanden während dieser Aufenthalte. Zu einer Verschärfung ihrer Instabilität trug sicher auch die Eifersucht Bellmers für die romantischen Gefühle Unicas für Henri Michaux bei.
Tochter einer wohlhabenden Familie, wuchs sie in Berlin, umgeben von exotischen Gegenständen auf, die ihr Vater, ein in Afrika stationierter Offizier, sammelte. Es wird nicht ausgeblieben sein, dass dies die lebhafte Vorstellungskraft der Künstlerin zu steigern wusste. Möglicherweise - und davon geben ihre späten Zeichnungen ebenfalls Kunde, inspirierten sie zusätzlich ödipale Sehnsüchte.
1953 lernte sie den in Paris lebenden, deutschen Surrealisten Hans Bellmer kennen, verliebte sich in ihn und folgte ihm nach Paris, um als seine Muse zu fungieren und um mit ihm zu arbeiten. Bellmer hat ein Buch über diese ungewöhnliche Beziehung geschrieben, das 1957 erschien: Petit trait de l'inconscient physique ou anatomie de l'image (In deutscher Sprache erst 2014 bei Brinkmann & Bose: Kleine Anatomie des körperlichen Unbewussten oder die Anatomie des Bildes).
1958 entschloss Belmer sich von seinen obligatorischen Puppen zu verabschieden, um mit echten Frauen zu arbeiten. Zusammen mit Unica Zürn entstanden einige denkwürdige Fotographien, an denen außer ihr auch die Dichterin Nora Mitrani als Modell beteiligt war.
 |
| Hans Bellmer: Nora Mitrani |
 |
| Hans Bellmer : Unica Zürn |
Diagnostiziert wurde Schizophrenie. Krankenhausaufenthalte in Berlin, Paris und La Rochelle schlossen sich an. Viele ihrer Zeichnungen, die bei Ubu zu sehen sind, entstanden während dieser Aufenthalte. Zu einer Verschärfung ihrer Instabilität trug sicher auch die Eifersucht Bellmers für die romantischen Gefühle Unicas für Henri Michaux bei.
1970 sprang sie aus Hans Bellmers Fenster in den Tod.
5. Blechbefall
Der Verkehrslärm windet sich aus
der Verantwortung, Ohrenpest zu sein, wird mitsamt dem Blechbefall von einem
A-93-Tunnel bei Unterweißenbach geschluckt, aber leider nicht verdaut. Das wär‘
ein Spaß: in der sauren Suppe blasblubbernd das chitinzersetzende Spektakel der
Heliamorpha beklatschen zu dürfen. Der Sumpfkrug beginnt unweit des Selber
Vorwerks am Vorderen Berg und taucht passend am Hinteren Berg wieder auf.
‹Wo leise ich mich wenden kann, dort bin ich reich!›
Willi bedauert nicht, in der
Milch seiner Erinnerungen zu schwimmen, ganz kremig und zart, sieht dort zwar
Muster, kann aber kaum etwas anfangen mit den Gestalten, die er in die Wolken
kogniert. Oft sieht er Wolkentrickfilme, das wunderschöne Wort ‹Wolkenpumpe›. Als ob er nicht
ausschließlich in sich selbst zum Leben käme, sitzt er da und öffnet die
Schleusen für die Bilder und Worte, wobei ihm Bilder immer Worte sind, die
Früchte belebten Lebens.
Montag, 18. Mai 2015
4. An Tagen der Erinnerung
Unter dem gleißenden Mittag sorgt ein behütendes Vordach für den wohligen Verbleib. So nennen wir das Leben. Aber Willi sitzt auf einem Balkon, der sich trotz aller phantastischen Anstrengung nicht in eine Veranda verwandeln will, und versucht, hinter den Fensterscheiben, die von den anderen Häusern auf die Straße spiegeln, Schatten zu erkennen. In den gepinselten Azur hinein steigt der Blick, sieht in allen Schäfchen, die dort Bläue grasen, Gebilde seiner eigenen Natur. Die Wissenschaft beweist, daß alles Unsinn oder Profit zu sein hat. Willi stellt sich vor, vom nachträglich an das Gehäuse geschraubten Balkon zu fallen, ohnmächtig bereits in der Luft, vor dem tunichtguten Aufschlag. ‹Im Grabe sind wir alle gleich!› - stimmt nicht, denn noch am Sarge und am Leichenschmaus sollst du erkennen..., die übriggebliebene Bande frißt das, molekular gesehen, schon merkwürdige Fleisch, die Würmer aus den Ritzen. Freie Gedanken verwehen, der Ein- oder Andere verrät ihn für ein warmes Mittagessen. An Tagen der Erinnerung ziehen sich die Schuhe von selber aus, die Kälte beißt in die Zehen wie eine ungeimpfte Altweltmaus.
Samstag, 16. Mai 2015
Freitag, 15. Mai 2015
3. Zeitfluss-Metapher
Willi hat zu viel Zeit zum
Nachdenken, zu wenig Zeit, etwas zu verändern. Vielleicht hat sich die Tür, die
offen stand, wie es uns das Unterbewusste lehrt, mit lautem Krachen geschlossen,
vielleicht ist dies das Geräusch, das er hört, bevor er in Aufruhr gerät und
stets zur selben Stunde erwacht: »Hier spricht die Zeit! Bleiben Sie stehen und
hören Sie gut zu, denn ich werde mich nicht wiederholen!« Und auch die
Bewegung, die er jetzt ausführt (es ist nur ein Streifen mit den Fingern an der
Schläfe entlang), wird er nicht noch einmal machen. Frischluft wirbelt einsam
in der bodennahen Grenzschicht herum, windkateraktreitende Pollen, Nacktsamer,
Bedecktsamer. Nichts könnte tauglicher sein für ein tägliches Brunchen mit der
Feder als jenes Fragment 91 des dunklen Heraklit. Alles plätschert oder fließt
also, und man wird nicht zweimal in das gleiche Flussbett pinkeln. Aber die Zeit
fließt nicht wie ein Fluss, sondern tickt wie eine Uhr, wobei jedes Ticken einer
Planck-Zeit von 10-43 Sekunden entspricht, genauer gesagt, die Zeit im
Universum fließt mit dem Ticken unzähliger Uhren. Bei einem Tick ist die
Materie da, beim nächsten Tick ist sie verschwunden – eigentlich wird das
Ticken durch das Verschwinden definiert. Aber zwischen den Ticks existiert die
Zeit nicht; es gibt so wenig ein ‹Dazwischen›, wie es Wasser zwischen
zwei benachbarten Wassermolekülen gibt. Doch das Beunruhigende an der
Zeitfluss-Metapher ist nicht der Fluss, der sich von der Kaverne hervor aus dem
Quell greint, sondern dass wir selbst es sind, die nie wieder dieselben sein
können. Ein Gedanke, der uns ontologisch gebeutelten Wesen sagt, dass es Sein an
sich nicht gibt, dass Werden und Bewegung bereits alles ist. Wir können sagen,
dass es unsere Fiktionen von uns selbst sind, die sich im Werden befinden, dass
wir die Weltgeschichte entziffern, indem wir sie erfinden.
Bleischwer die Nächte
Jetzt beginne ich das Laufen neu. Beginne es Barfuß. Fast vier=Wochen Einton, sitzen, sitzen, quasimodieren, Heute Nacht hätte ich schon wieder beinahe das ganze Achievement in den Müllbasket geworfen. Mich drängts, die Dinge anders zu machen, bloß wie? - darüber keine Erkenntnis. Bleischwer die Nächte.
Donnerstag, 14. Mai 2015
2. Die Maschinen haben Löcher gerissen (Die Veranda)
Erinnerungen mäandern vorbei,
dröppeln durch die dünne Luft. Die Sonne verschwindet kurz zwischen einer
himmlischen Chaiselongue aus Wolkengewaber (Nephologen würden das eine
Schleierwolke nennen, aber es ist doch eindeutig ein Sitzmöbel).
Er sitzt da und wünscht sich
eine Veranda, ein Boot im Apfelbaumgarten, den auch Pflanzendüfte durchwürzen,
was mit Nelken und Rum. Apartes Violett wirft sich durch weiße Blüten nach
Süden, er sitzt beinahe aufrecht, sinniert der Lichtquelle entgegen, die sich
jetzt durch den aufgelösten Amboss eines Cumulonimbus schiebt, reckt das Kinn
nach vorne, ganz Galion, ganz Stelzpflug.
Die Zeitung kleidet sich wie
immer in Druckerschwärze; Trauer, Majuskeln in Schlips und Ligatur, ein
Krematorium der Buchstaben. Was nicht dort steht, ist weiß gesetzt, eine Spur
führt zur nächsten Spur.
Von Rupert eine Postkarte aus
Hameln a.d. Weser, die das Rattenfängerhaus mit folgender Inschrift zeigt:
Am Dage Johannis et Pauli / War
der 26 Junii / Dorch einen Piper mit allerley Farve bekleidet / Gewesen CXXX
Kinder verledet / Binnen Hamelen geboren / To Calvarie bi den Koppen verloren.
Hinten mit ana schwoazzn dindn
geschrieben:
»Lieber Freund! Die Maschinen
haben die Löcher gerissen. Daß kein einziges Erlebnis verlorengeht, das weißt
Du. Wo ist es? Wir kommen nicht gegen das Chaos an, wir dachten ja, wir
könnten!«
Rupert, verdammt nochmal. Willi
erinnert sich (wie man sich an einen besonders prächtigen Schatten erinnert),
wie er seine Hütte einst zu Klump zusammengehauen vorgefunden hatte. Der Boden ein
Resteverwertungslager, eine Puppenstube, von der kleinen, feisten Faust eines
pausbäckigen Mädchens getroffen. »Ihr blöden Puppen! Nie seid ihr Zuhause, wo
ich euch hin tu’!«
Sie will, dass ihre Puppen parieren. Das erkennt sie als ihr Geburtsrecht. Ist sie nicht eine Göttin mit nutellaverschmierten Lippen? Sieht aus, als hätte sie die Scheiße der ganzen Welt verschlungen, nur um festzustellen, dass in diesem, ihrem Haus, heidnische Gottesdienste stattfinden.
Mittwoch, 13. Mai 2015
1. Die Wogen des Morgens
Willi Kreutzmann erhebt sich nun
doch endlich. Er kann nicht mehr richtig liegen, die ihm möglichen Stellungen
sind verbraucht. In Bauchlage gelingt es ihm nicht, das zum Überleben nötige
Sauerstoffvolumen durch das Federkissen zu saugen, auf dem Rücken liegend
besitzt er die Angewohnheit, die Finger wie bei einer Leiche über dem
Solarplexus zu verschränken und fühlt sich deshalb merkwürdig, sanftmütig gar,
wirklich wie ‹dahingeschieden›. Die linke Seite,
eigentlich seine Lieblingsseite, lässt ihn noch mehr auf das Kissen sabbern als
wenn er rechts liegt. Aber da schläft immer sein verdammter Arm ein und der
Hals tut ihm weh.
Die Sonne warf das erste
Tageslicht nahezu zärtlich über den Horizont, stellte die Wurlitzer Jukebox an:
Lärchenmelodie und Meisen, Zeisige und Finken, die Lautstärke ein warmgoldenes
Pulsieren, das um zehn Uhr herum begann. Immer zorniger drang das musikalische
Theater auf ihn ein, wollte ihn zum Genießen des gülden aufmuckenden Tages
zwingen, wenn es sein musste, durch zunehmende Hitze. Die Morgenstunden tappten,
wie sie es gewohnt waren, die Stufen der Zeitskala nach oben, dem Mittag
entgegen.
nichts ist so trüb in die Nacht
gestellt
der Morgen leicht macht’s wieder
gut.
Das erfordert Aktivität; komm’
jetzt, du Faulfleck, es ist doch schönes Wetter! Auch wenn es nicht so wäre:
das Liegen sollte den nächsten Schritt täglicher Entwicklung tun, nämlich zu
einem Sitzen werden. Ohne den Schritt über den Rubikon geht das nicht, ohne
Backform, Keim, Volition.
Es war der Hunger, der ihn noch
immer aus dem Bett trieb, zunächst ein Knurren, ein inneres Rülpsen, die
Magenwand flatterte ins Leere, ein Fähnchen, über dem Arsch seiner Welt gehisst.
Am Ende des Mastdarms kumulierten Gasansammlungen und flatulierten böig. Wie
wäre es jetzt mit einem Omelette? Was anderes bekam er so früh am Mittag gar
nicht runter.
So halbstark zu erwachen, den
kleinen Penitenzer lau in der Unterhose, noch mit dem Traum beschäftigt, der
nach wie vor in den Augen glitzert (wenn er schnell zum Spiegel rennte, könnte
er wieder Kontakt aufnehmen, aber er hat andere Pläne), treibt Willi dem Gefühl
eines Labyrinthausfalls entgegen. Die letzte Erinnerung: Mona Lisas
Gesichtslähmung, Menschen ohne Bauchnabel, eine lesbische Hauskatze und ein
Kind, das aussah wie ein Alien aus Roswell nahe am Pecos, Rio Hondo, wie es in
einer Badewanne hockte und Spaghetti aß. Was um alles in der Welt wollen uns
unsere Träume wirklich sagen?
Hier oben hängt die Luft wie ein
Spinnweb an der Decke.
Willi setzt sich in seine
Voliere zwischen Kakteen und wilden Wein – Parthenocissus tricuspidada, die
Trauben so klein wie Hasenköddel, aber süß, hatte ihm die kleine runzlige
Angestellte im Blumenladen Jupp versprochen. »Seien Sie gut zu ihren Pflanzen,
geben Sie ihnen Wasser, Sonne und Mozart.« Sie kratzte sich ständig an den
Oberarmen, an beiden gleichzeitig, war allergisch gegen das Grünzeug, das sie
verkaufte, liebte den Laden, der aussah wie eine Tropfsteinhöhle in Pottenstein
jedoch über alle gesundheitlichen Einschränkungen hinaus. In einem Anfall
morgendlicher dichterischer Gefühlswallung krächzt Willi auf dem Weg zum Balkon
folgenden Kalauer:
Das Leben ist ein Possenspiel,
das Leben ist ein Pussy-Bär;
die Fratze, die beim Carne Vale
des Nachts dich auf den Tod
erschreckt.
Das Leben ist ein Pussy-Spiel,
das Leben ist ein Possenbär;
die vielen Schenkel eine Falle,
der du den Mittelpunkt zerleckt.
Sing: Halleluja!
Sing: Hell die Luna!
Sing: Jupeidi!
Sing: Heidi Jupp
(die nackt und barfuß badet,
duscht und Wunder tut).
Dienstag, 12. Mai 2015
Dass solche Leute Kinner fressen
Da kam ins Dorf Einer, den hatte man von weit her geholt, der trank viel und verströmte den Geruch einer angesengten Ziege, die in ihrem eigenen Kot verging. Seine Angewohnheit, morgens mit einem angstvollen Luftsprung zu erwachen, das Schwert gezückt, die Augen weit aufgesperrt, sprach sich schnell durch den Mund der Wirtin Gildema herum, bei der Der unterm Dachstuhl hauste, bevor er ins Schloss hinüber zog.
Die Landbevölkerung erschauerte, denn auch wenn ein Solcher im Stande sein soll, für den Markgrafen Friedrich Metall zu transmutieren, muss man davon gehört haben, daß solche Leute Kinner fressen (man denke an den Gilles de Rais). Sollte so Einer Einzug halten dürfen in diesem schönen Gebürg, sich unter den Hiesigen bewegen, ratend, rätselnd, wo er den Honig hinschmieren wollen würde, wenn der Ofen bei 300 Grad gähnte und den Braten forderte?
Der da so ankam, nannte sich Meister Vollpferd, gerade weil er einen ganzen Eimer leeren konnte - man möcht nicht nachdenken, was da drinnen. Und so ging die Mär, daß Der die jungen Weibsen um ihren Urin bat, dass denen bald der Schädel platzen musste vor Rötung. Wirr redete Der außerdem:
"Eins, und es ist zwei; und zwei und es ist drei;
und drei und es ist vier; und vier und es ist drei;
und drei und es ist zwei; und zwei und es ist eins."
Als der Meister aber einmal den gebrochenen Haxen des Bauern Wiegand wieder richtete, verstummte bald der Hohn und man stellte ihm die Brunze in Milchkannen vor die Tür.
Die Landbevölkerung erschauerte, denn auch wenn ein Solcher im Stande sein soll, für den Markgrafen Friedrich Metall zu transmutieren, muss man davon gehört haben, daß solche Leute Kinner fressen (man denke an den Gilles de Rais). Sollte so Einer Einzug halten dürfen in diesem schönen Gebürg, sich unter den Hiesigen bewegen, ratend, rätselnd, wo er den Honig hinschmieren wollen würde, wenn der Ofen bei 300 Grad gähnte und den Braten forderte?
Der da so ankam, nannte sich Meister Vollpferd, gerade weil er einen ganzen Eimer leeren konnte - man möcht nicht nachdenken, was da drinnen. Und so ging die Mär, daß Der die jungen Weibsen um ihren Urin bat, dass denen bald der Schädel platzen musste vor Rötung. Wirr redete Der außerdem:
"Eins, und es ist zwei; und zwei und es ist drei;
und drei und es ist vier; und vier und es ist drei;
und drei und es ist zwei; und zwei und es ist eins."
Als der Meister aber einmal den gebrochenen Haxen des Bauern Wiegand wieder richtete, verstummte bald der Hohn und man stellte ihm die Brunze in Milchkannen vor die Tür.
Sonntag, 10. Mai 2015
Autopsychè
Die Szenerie (Scen=Eerie) : Die granitene Starre umgeben von verfaulten Abfallhaufen. Alte Büchsen und totes Ungeziefer, Asche und Schalen und Schmutz.
Das Vokabular (Vocabula) : Der Späher in der Nacht – wer kann das bestreiten? – nennt Stimmen wie der Kauz sein Eigen. Chronos, Menschenfresser, Attraktor, um den Energien kreisen : taktmäßiges Fortbrausen der Zeit. Sitzt im dunklen Zentrifug, keucht ein Flüsterwort und blendet sich anhand eines Traums. Der Späher ist / bleibt ein Part der Nacht sogar dann, wenn er bei Tage kniet und Henker spielt, verurteilt, selbst ein Leben lang die Zeit zu sein.
Das Vokabular (Vocabula) : Der Späher in der Nacht – wer kann das bestreiten? – nennt Stimmen wie der Kauz sein Eigen. Chronos, Menschenfresser, Attraktor, um den Energien kreisen : taktmäßiges Fortbrausen der Zeit. Sitzt im dunklen Zentrifug, keucht ein Flüsterwort und blendet sich anhand eines Traums. Der Späher ist / bleibt ein Part der Nacht sogar dann, wenn er bei Tage kniet und Henker spielt, verurteilt, selbst ein Leben lang die Zeit zu sein.
Freitag, 8. Mai 2015
Kitty Moffert
Der Strand schwamm, einem Zigeuner gleich,
Der ins Wasser gefallen, hinüber zur Insel
Der Mahagoni-Bäume, ruderte sandglitzernd
Mit grobporigen Armen, und wir ersetzten
Ihn gegen den Windacker
Ohne Almosen überhaupt erst zu fordern.
Es sah so aus, als lebten noch einige dieser
Bischofskröten, die nur wenn es donnerte aus
Den Erdritzen stakten, Goldhemd, Storchenstiefel an,
Aus einem Pamphlet rezitierend
die Stimme Zahngurgeln.
Die Majuskeln bestanden aus Bluturin,
Eine andere Tünche kannte der Verfasser nicht
Beim Namen, stolpernd über Hasenschlingen (man
Sieht ihn Tag für Tag im Zittergras
Verschwinden, das Generationen von Rennfahrern
Ernährt).
Ein aufgetrenstes Pferd,
Eine Harpune auf einem Schlitten.
Was siehst du da?
Die bescheidene Frage tauchte
Unwillkürlich auf, eine Sonne auf Halbmast
In einer nie mehr wiederkehrenden Bildmischung,
Stumme Sequenz, Schwenk und ab.
Der Ruhm ist ohnehin ein Akt der Näherinnen
sprunghafte Nadel
angefasst,
Ein überaus heißer Kuchen zerkaut
Den Pansen, gibt sich mehrere Minuten
Zeit,
Rennt O-Beinig über die Brooklyn-Bridge,
Auch wenn es nur so aussieht, weil dein
Teller das Licht so komisch filtert, unsere
Großherzigen Lampen noch nicht erfunden sind.
Beinahe hätte ich's vergessen,
Wie heißt die Dame eigentlich?
"Kitty Moffert"
Der ins Wasser gefallen, hinüber zur Insel
Der Mahagoni-Bäume, ruderte sandglitzernd
Mit grobporigen Armen, und wir ersetzten
Ihn gegen den Windacker
Ohne Almosen überhaupt erst zu fordern.
Es sah so aus, als lebten noch einige dieser
Bischofskröten, die nur wenn es donnerte aus
Den Erdritzen stakten, Goldhemd, Storchenstiefel an,
Aus einem Pamphlet rezitierend
die Stimme Zahngurgeln.
Die Majuskeln bestanden aus Bluturin,
Eine andere Tünche kannte der Verfasser nicht
Beim Namen, stolpernd über Hasenschlingen (man
Sieht ihn Tag für Tag im Zittergras
Verschwinden, das Generationen von Rennfahrern
Ernährt).
Ein aufgetrenstes Pferd,
Eine Harpune auf einem Schlitten.
Was siehst du da?
Die bescheidene Frage tauchte
Unwillkürlich auf, eine Sonne auf Halbmast
In einer nie mehr wiederkehrenden Bildmischung,
Stumme Sequenz, Schwenk und ab.
Der Ruhm ist ohnehin ein Akt der Näherinnen
sprunghafte Nadel
angefasst,
Ein überaus heißer Kuchen zerkaut
Den Pansen, gibt sich mehrere Minuten
Zeit,
Rennt O-Beinig über die Brooklyn-Bridge,
Auch wenn es nur so aussieht, weil dein
Teller das Licht so komisch filtert, unsere
Großherzigen Lampen noch nicht erfunden sind.
Beinahe hätte ich's vergessen,
Wie heißt die Dame eigentlich?
"Kitty Moffert"
Dienstag, 5. Mai 2015
In die Felder II
es gibt ja bei uns keinen literarischen Dialog, das hat in den 70ern aufgehört. Die Isolation - sowohl als Leser als auch als Dichter (ich weiss natürlich nicht, ob es bei uns überhaupt Dichter gibt) - gehört sozusagen zu einem poetischen Entwurf. Eine Kritik gibt es ja auch nicht, wir stehen also im Nichts. Keine Verleger, keine Bücher, die irgendeinen Wert haben - das ist schon der reine Horror, dem wir da begegnen. Aber ich weigere mich trotzdem, nur noch englisch zu lesen, ich mach da lieber mit unserer Sprache rum, da gibt es ungeahnte Möglichkeiten, die nie verfolgt wurden. Die angesprochene Isolation interessiert mich nicht besonders, für mich ist das ja klar. Schau mal, wo wir leben.
Montag, 4. Mai 2015
Lumberjack
Zuckerbrot der Unguter Hut-Mönch
mörderischen Tentakel-Schere satanischen Kerzenscheins.
Filterzirkel grandioser Grenzfälle & Wochenendbeziehungen
Im Bernsteingefäß.
Wacholderpuppen treten nackt aus einer Pfütze
Aufgetaut
Samtbeton wird neue Städte aus dem Orbit anlocken
Einsperren
Aber in klobige Kissen ohne höfliche Naht. Kot
Geschmack ist aller Industrien Hoffnung.
mörderischen Tentakel-Schere satanischen Kerzenscheins.
Filterzirkel grandioser Grenzfälle & Wochenendbeziehungen
Im Bernsteingefäß.
Wacholderpuppen treten nackt aus einer Pfütze
Aufgetaut
Samtbeton wird neue Städte aus dem Orbit anlocken
Einsperren
Aber in klobige Kissen ohne höfliche Naht. Kot
Geschmack ist aller Industrien Hoffnung.
Sonntag, 3. Mai 2015
Regen in der Stadt - Brücke
-Es geht etwas vor
-Was denn
sei ruhig, es war nur ein Traum, ein Traum, der dich einlud, vor die Türe zu sehen, aber da war nichts
-Aber es geht etwas vor
-Aber da ist nichts, nur ein Wetter nur das Wetter gegen das Haus, alter grober Wind, was bläst du so stark
(alter grober Wind)
wie eine übermütiges Kind
-Was denn
sei ruhig, es war nur ein Traum, ein Traum, der dich einlud, vor die Türe zu sehen, aber da war nichts
-Aber es geht etwas vor
-Aber da ist nichts, nur ein Wetter nur das Wetter gegen das Haus, alter grober Wind, was bläst du so stark
(alter grober Wind)
wie eine übermütiges Kind
Freitag, 1. Mai 2015
In die Felder
die Tableaus waren sicher noch von der herkömmlichen Auffassung des Bildmaterials beeinflusst, von einer Szene, die in ihrer Endgültigkeit erstarrt war. Aber das ging nicht, das war ja nicht, was ich beabsichtigt hatte. Dieser ganze überholte Metaphern=Kram. In deutscher Sprache gibt es ja keine Lehrmeister innerhalb der Dichtung. Gerettet haben mich der projektive Vers, Olson also - aber als Dichter kann man ja heute nur von den Cantos kommen. Olson konnte Pound ja auch nie widerstehen. Bei uns, ja bei uns ist Rainer Gerhardt einer gewesen. Den haben sie im wahrsten Sinne totgeschwiegen. So macht man das bei uns. Worauf ich aber hinaus will: Feldtheorie. Mehr ist eigentlich nicht zu sagen. Zeit, Raum und dieser ganze Quatsch. Metapher, Geschlossenheit ... dieser ganze fehlerhafte Mist. Das muss ein für allemal weg.
Die Maer I
Es gab eine Zeit, in der es als kühn und modern galt, alles an moderner Dichtung in sich hineinzufressen. Heute kommen sich verschiedene schwachköpfige Kreaturen als nationale Helden vor, wenn sie sich von neuer Dichtung kalauernd abwenden.
Rainer M. Gerhardt: Die Maer von der musa nihilistica, Frankfurt/M, Hessischer Rundfunk, Abendstudio, November 1952, Typoskript, 46 Seiten.
Siebenstern
in
Graskrautschichten, feucht
die Leitpflanze der kalkarmen Kieselflora :
Siebenstern im Halbdunkel des Waldes & Sauerklee &
Schattenblümchen & Wintergrün & Labkraut & Wachtelweizen
& Hasenlattich
die Bachläufe im Bergwald
im lichten Altholz die
Schlängelige Schmiele
dichte Rasenpolster
Großer Hengstberg der bunte Sturmhut
Graskrautschichten, feucht
die Leitpflanze der kalkarmen Kieselflora :
Siebenstern im Halbdunkel des Waldes & Sauerklee &
Schattenblümchen & Wintergrün & Labkraut & Wachtelweizen
& Hasenlattich
die Bachläufe im Bergwald
im lichten Altholz die
Schlängelige Schmiele
dichte Rasenpolster
Großer Hengstberg der bunte Sturmhut
Abonnieren
Posts (Atom)