Darwin & die Künste
 Bild: Max-Planck-Institut for the History of Science
Bild: Max-Planck-Institut for the History of Science
„Mit dem Tübinger Biologiehistoriker Thomas Junker hat nun ein gelehrter Naturwissenschaftler ein einführendes Buch vorgelegt, das wie Menninghaus’ jüngere Arbeiten die menschlichen Kunstpraktiken als funktionale, motivierte und (weitgehend, aber nicht ausschließlich) lebensförderliche Handlungen begreift. Gegenüber eindimensionalen Funktionszuschreibungen beharren beide Autoren darauf, dass Kunstpraktiken durchaus gegenläufigen Zwecken dienen können. Menninghaus’ erstes Kapitel widmete sich Darwins Konkurrenzmodell der Künste. Es erklärt vor allem jene Schmuck- und Singpraktiken, welche Rivalen im Kampf um die Gunst von Fortpflanzungspartnerinnen anwenden, um sich möglichst erfolgreich fortzufplanzen. Komplementär dazu profilierte Menninghaus ein zweites Modell der Künste als Übungsfelder des sozialen Zusammenhalts, etwa wenn gemeinsam gesungen oder getanzt wird und dadurch das Verhalten von Individuen sowie deren Gefühle und Ziele synchronisiert werden. Auch Thomas Junker erläutert sowohl den Rivalitätsaspekt der Schmuckkonkurrenz zwischen Gruppenmitgliedern als auch jenen Integrationsaspekt, dass gerade mittels kollektiver Kunstübungen ein neuer (sozialer) ‚Superorganismus‛ hergestellt werden könne, der dann im gemeinsamen Kampf ums Überleben – gegen andere Gruppen oder Tiere – über Fitness- und Selektionsvorteile verfüge. Junker neigt zu einem evolutionären Stufenmodell, das beide Arten des Kunstnutzens integriert: Künste entstanden aus sexuellen Signalen (auf dem Markt der Partnerwahl) und gewannen dann im Laufe ihrer Entwicklung zusätzliche biologische und soziale Nützlichkeiten hinzu.
…
Künste werden hier begriffen als „eine spezielle Sprache, in der sich die Menschen indirekt über ihre Lebensziele austauschen.“ Diese Lebensziele denkt sich der Biologe als weder anerzogen noch beruhend auf individueller Erfahrung. Immer noch seien sie in erster Linie Ausdruck der Natur des Menschen. Die kulturelle Umwelt liefere nur den Rahmen, in dem diese Ziele angestrebt werden. Allerdings transzendieren Kunstwerke doch auch das Gegebene. Sie eröffnen als „ästhetisch bearbeitete, gemeinschaftliche Phantasien“ einen Spiel- und Denkraum jenseits der bloßen Wirklichkeit, etwa im Hinblick auf (neue) Ziele einer Gemeinschaft. Kunst verkörpere und zeige menschliches Können. Deswegen seien nur menschlich hergestellte Artefakte Kunst. Die Gemeinschaft schätze solch herausragendes Können, weil kreative Einfälle und handwerkliche Fähigkeiten für ihr Überleben generell nützlich seien.“
Bernd Blaschke aktuell auf literaturkritik.de über Thomas Junker: Die Evolution der Phantasie. Wie der Mensch zum Künstler wurde. Hirzel Verlag, Stuttgart 2013.


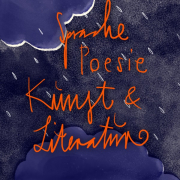

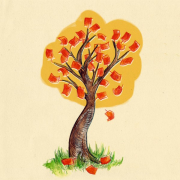




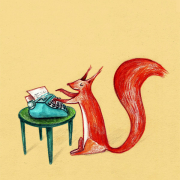
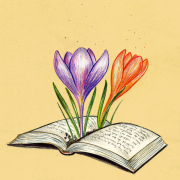

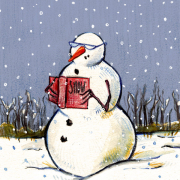
Neuen Kommentar schreiben