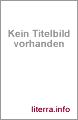|
|
Startseite > Rezensionen > Dr. Franz Rottensteiner > Mystery > Der zeitlose Winter |
Der zeitlose Winter
Link Rezi2Book: Buch konnte nicht gefunden werden.| DER ZEITLOSE WINTER
|
James A. Owen
Der zeitlose Winter (Babylon’s Meridians)
Aus dem Amerikanischen von Sara Schade
Leipzig: Festa Verlag 2004 221 S. € 18.95
(Kai Meyers Mythenwelt 3)
Der Roman beginnt nicht schlecht, mit einer Anspielung auf den berühmten Beginn von Herman Melvilles Moby Dick, es wird eine Gestalt namens „Fischmehl“ eingeführt, was lautlich an Ishmael anklingt; ein afghanischer Bücherliebhaber mit bizarrer Kriegsgeschichte, der als Matrose auf einem Seelenverkäufer fährt, einem renovierten Schrott-Öltanker, von der Besatzung „Milchkanne“ genannt, der als Schmuggelschiff die Weltmeere unsicher macht und aktuell mit einer Ladung Milchkühe von den Großen Seen in Amerika nach Europa unterwegs ist. Und einem Paket, das der Kapitän zur Beförderung übernommen hat und das Fischmehl auspackt. Darin befindet sich ein sprechender Kopf, der durch auf seiner Zunge eingeritzte Runen belebt wird, ein Skalde, der sich schließlich als der Gott Bragi herausstellt – so wie auch Fischmehl sich als einer der Erlkönige erweist, welche über das Schicksal der Welt bestimmen. Es scheint, dass es verschiedene historische Zyklen gibt, die auf mehr oder minder sanfte oder gewaltsame Weise von anderen abgelöst werden. Eine solche Totalumwälzung wird als Galder-Umkehrung bezeichnet. So wurde ein römischer (Romulus) durch den Opfertod Joshuas beendet. Das ist in einer Bibliothek festgehalten, und das wird von diversen Gestalten, darunter von einem König Lucius, der in einer steinzeitlichen Landschaft aus seinem Grab geholt wird, Hammurabi und Buddha, erörtert. Zunächst jedoch kommt es zu einem sea change in der Welt; das Meer gefriert plötzlich, das Schiff mitsamt seinen Kühen und der als Passagiere mitfahrenden Blues-Band ist auf dem Eis gestrandet, Kapitän Pickering verwandelt sich in einen Minotaurus, und es kommt zu gewaltsamen Auseinandersetzungen, bei denen das Buddha-Kind durch bloße Gedankenkraft die Gegner verbrennt oder von plötzlich auftauchenden Felsen zerquetschen lässt. Zuvor ist schon ein Pilot mit einem Flugzeug gelandet, das in der veränderten Welt ohne Treibstoff fließt. In der Hauptsache wird aber geredet, wobei sehr abstruse Erklärungen geliefert werden, in der eine geheime Bibliothek, daraus verloren gegangene Bände und Ankoriten (Anchoreten) eine zentrale Rolle spielen. Wie in den vorhergehenden Bänden und bei dem Ideenlieferanten Kai Meyer meistens, handelt es sich um eine Mythenklitterung, bei der die disparatesten Elemente zusammengeführt werden. Ich könnte nicht sagen, dass sich für mich daraus ein erkennbarer Sinn ergäbe, wie auch in den laufenden Romanen Jonathan Carrolls wird sehr viel Unsinn geschwätzt, den kein Mensch im normalen Leben glauben würde; und dass es in einer surrealistisch aus dem Lot geratenen Welt, in der alles Beliebige möglich ist, geschieht, macht die ganze Sache nicht überzeugender. Ein paar nette Einfälle, vor allem Sprachspielereien, verborgen unter sehr viel Wortgeröll, das ist der Eindruck, den zumindest ich von diesen Romanen davontrage, die letztlich derivativ und schwächlich sind, eine belanglose, intellektuell alles andere als befriedigende Spielerei.
Der Rezensent
Dr. Franz RottensteinerTotal: 59 Rezensionen
März 2018: keine Rezensionen
Franz Rottensteiner
wurde am 18.01.1942 in Waidmannsfeld/Niederösterreich geboren.
Studium der Publizistik, Anglistik und Geschichte an der Universität Wien,
1968 Dr. phil.
Rund 15 Jahre Bibliothekar an einem Forschungsinstitut, daneben Tätigkeit für verschiedene Verlage, unter ander...
Weitere Rezensionen
 |
Alien Earth - Phase 1
unbekannt - |
 |
Aljoscha der Idiot
unbekannt - |
 |
Allmachtsdackel
unbekannt - |
 |
Allmachtsdackel
unbekannt - |
 |
Alltag im Mittelalter – Das Leben in Deutschland vor 1000 Jahren
unbekannt - |
 |
Als Dämon brauchst du nie Kredit
unbekannt - |
 |
Alte Ruhrgebietsküche
unbekannt - |
 |
Am Rande des Abgrundes
unbekannt - |
 |
Amazone meines Herzens
unbekannt - |
 |
Anansi Boys
unbekannt - |
 |
Anansi Boys
unbekannt - |
 |
Anatolia Story 8
unbekannt - |
 |
Angriff der Anangu
unbekannt - |
 |
Apolos Auge
unbekannt - |
 |
Arena
unbekannt - |
 |
Argentinische Erzählungen
unbekannt - |
 |
Ark Angels 1
unbekannt - |
 |
Artemis Fowl - die verlorene Kolonie
unbekannt - |
 |
Ausgebrannt
unbekannt - |
 |
Befreiung in Camouflage
unbekannt - |
 |
Begegne deiner Fee
unbekannt - |
 |
Beste Grüße von den Simpsons
unbekannt - |
 |
Bezwinger der Natur/ Die vierte Dimension
unbekannt - |
 |
Bibi 7
unbekannt - |
 |
Bis in den Tod
unbekannt - |
 |
Blutige Geburt
unbekannt - |
 |
Bokura Ga Ita 3
unbekannt - |
 |
Creepers
unbekannt - |
 |
Das Alptraum-Netzwerk
unbekannt - |
 |
Das Amphora- Projekt
unbekannt - |
 |
Das Feen-Geschenk: Der Schlüssel zum magischen Königreich
unbekannt - |
 |
Das Gesetz des Waldes
unbekannt - |
 |
Das Grabmal der Kleopatra
unbekannt - |
 |
Das Land des Yann
unbekannt - |
 |
Das Lexikon des Dunklen
unbekannt - |
 |
Das Monster von Stonehenge
unbekannt - |
 |
Das Perfekte Dinner – Das Kochbuch
unbekannt - |
 |
Das Schlangenschwert
unbekannt - |
 |
Das Schweigen
unbekannt - |
 |
Das Schwert des Bösen
unbekannt - |
 |
Das Spiel
unbekannt - |
 |
Das unendliche Licht
unbekannt - |
 |
Dear Myself
unbekannt - |
 |
Der Cthulhu-Mythos 1976 – 2002
unbekannt - |
 |
Der entfesselte Judas
unbekannt - |
 |
Der Flatbootmann
unbekannt - |
 |
Der Kosmische Verbrecher
unbekannt - |
 |
Der Krieg der Propheten 2. Der Prinz aus Atrithau
unbekannt - |
 |
Der Kristallschädel
unbekannt - |
 |
Der letzte Tag der Schöpfung
unbekannt - |
 |
Der Magier von Maronar
unbekannt - |
 |
Der Milliardenmörder
unbekannt - |
 |
Der Mutator
unbekannt - |
 |
Der Mönch Laskaris
unbekannt - |
 |
Der Schattenlehrling
unbekannt - |
 |
Der Schrecken von Mohringen
unbekannt - |
 |
Der Sohn des Waffenmeisters
unbekannt - |
 |
Der Sternenwanderer
unbekannt - |
 |
Der unterirdische Fluss
unbekannt - |
 |
Der verliebte Teufel
unbekannt - |
 |
Der verlorene Troll
unbekannt - |
 |
Der Waltras 1
unbekannt - |
 |
Der Weg des Tanzes
unbekannt - |
 |
Die acht Namenlosen
unbekannt - |
 |
Die Alptraumfabrik
unbekannt - |
 |
Die Bedrohung
unbekannt - |
 |
Die Bestie
unbekannt - |
 |
Die brennenden Schiffe
unbekannt - |
 |
Die dunkle Herrlichkeit
unbekannt - |
 |
Die Energiekriege
unbekannt - |
 |
Die Enteigneten
unbekannt - |
 |
Die Erfindung des Kosmos
unbekannt - |
 |
Die Geschwindigkeit des Dunkels
unbekannt - |
 |
Die Herren von Sydney
unbekannt - |
 |
Die Kanonen von Dambanor II
unbekannt - |
 |
Die Kanonen von Dambanor II
unbekannt - |
 |
Die Kinder Hurins
unbekannt - |
 |
Die Lebensboten
unbekannt - |
 |
Die Liebe der Zukunft vor 100 Jahren
unbekannt - |
 |
Die Liebe der Zukunft vor 100 Jahren
unbekannt - |
 |
Die Morax
unbekannt - |
 |
Die Nebel der Dunkelheit
unbekannt - |
 |
Die Ohnmächtigen
unbekannt - |
 |
Die Ohnmächtigen
unbekannt - |
 |
Die PSI- Fabrik
unbekannt - |
 |
Die Psi-Fabrik
unbekannt - |
 |
Die Rache der Schattenreiter
unbekannt - |
 |
Die Reliktjäger
unbekannt - |
 |
Die Schatten-Chronik
unbekannt - |
 |
Die Schlacht um Triple Sun
unbekannt - |
 |
Die Schöpfungsmaschine
unbekannt - |
 |
Die Schöpfungsmaschine
unbekannt - |
 |
Die Spinnen-Seuche
unbekannt - |
 |
Die Stadt Gottes
unbekannt - |
 |
Die Sternenhorcher
unbekannt - |
 |
Die Straße zur Verdammnis
unbekannt - |
 |
Die Tochter der Himmelsscheibe
unbekannt - |
 |
Die Traumkapseln
unbekannt - |
 |
Die Verschwörung
unbekannt - |
 |
Draculas Wiederkehr
unbekannt - |
 |
Dream Kiss 2
unbekannt - |
 |
Ein Albtraum erwacht
unbekannt - |
 |
Ein Blick in die Zukunft 2407
unbekannt - |
 |
Ein zerebraler Schriftsteller und Philosoph namens Lem
unbekannt - |
 |
Eine höllische Rettung
unbekannt - |
 |
Fatimas Tränen
unbekannt - |
 |
Fletcher Moon - Privatdetektiv
unbekannt - |
 |
Fluch der Karibik – Roman zum ersten Kinofilm
unbekannt - |
 |
Flucht zum Mars
unbekannt - |
 |
Forschungsraumer CHARR
unbekannt - |
 |
Frankenstein- die Kreatur
unbekannt - |
 |
Game Master: World of Warcraft Trading Card Game Poster-Collection 1
unbekannt - |
 |
Geeks
unbekannt - |
 |
Gefesselt in Liebe
unbekannt - |
 |
Geheime Zauberkräuter – Legenden, Riten, Rezepturen
unbekannt - |
 |
Gestalt 5
unbekannt - |
 |
Grausame Städte
unbekannt - |
 |
Hainish
unbekannt - |
 |
Halbnackte Bauarbeiter
unbekannt - |
 |
Handbuch des Okkultismus
unbekannt - |
 |
Hannibal Rising
unbekannt - |
 |
Harry Potter and the Deathly Hallows
unbekannt - |
 |
Haschisch
unbekannt - |
 |
Haschisch
unbekannt - |
 |
Honigfalter
unbekannt - |
 |
Horrortrip ins Schattenland
unbekannt - |
 |
Hunger
unbekannt - |
 |
Hurricane- Zyklus
unbekannt - |
 |
Im Dorf der Telephaten
unbekannt - |
 |
Im Turm der lebenden Toten
unbekannt - |
 |
Im Zeichen der Erhabenen
unbekannt - |
 |
Imperator- die Zeitverschwörung
unbekannt - |
 |
Innocent Bird 1
unbekannt - |
 |
Inu Yasha 45
unbekannt - |
 |
Jules Verne
unbekannt - |
 |
Justice League of America 1: Gestern, heute, morgen + Der Pfad des Tornado, Kap. 1: Leben + Der Pfad des Tornado, Kap. 2: Tornado-Rot/Tornado-Blau
unbekannt - |
 |
K-A-E 29th Secret - Blank File
unbekannt - |
 |
Kamasutra heute: Sex-Geheimnisse für Liebende
unbekannt - |
 |
Karl May Welten I
unbekannt - |
 |
Karl May Welten II
unbekannt - |
 |
Kiss me, Princess 4
unbekannt - |
 |
Krieg in der Hohlwelt
unbekannt - |
 |
La Esperanza 3
unbekannt - |
 |
Land der Lügen
unbekannt - |
 |
Lerchenlicht
unbekannt - |
 |
Lexikon der deutschen Science Fiction & Fantasy 1919-1932
unbekannt - |
 |
Lexikon der deutschen Science Fiction und Fantasy 1919-1932
unbekannt - |
 |
Lumen
unbekannt - |
 |
Lumen. Wissenschatliche Novellen
unbekannt - |
 |
Lust auf Zucchini
unbekannt - |
 |
Marilyn Manson – Talking
unbekannt - |
 |
Mein König
unbekannt - |
 |
Merlins böses Ich
unbekannt - |
 |
Metan
unbekannt - |
 |
Midoris Days 2
unbekannt - |
 |
Musouka 1
unbekannt - |
 |
Nachgefragt: Europa – Basiswissen zum Mitreden
unbekannt - |
 |
Nachtwanderung
unbekannt - |
 |
Narrenturm
unbekannt - |
 |
Nighthawk
unbekannt - |
 |
Orange Planet 1
unbekannt - |
 |
Piratenfluch
unbekannt - |
 |
Prime Minister 1
unbekannt - |
 |
Psyhack
unbekannt - |
 |
Punisher – Irisches Erbe
unbekannt - |
 |
Quantico
unbekannt - |
 |
Rah Norton
unbekannt - |
 |
Reisen von Zeit zu Zeit
unbekannt - |
 |
Ritual in den Tod
unbekannt - |
 |
Rückkehr zum Mittelpunkt der Erde
unbekannt - |
 |
Septimus Heap 2- Flyte
unbekannt - |
 |
Sex, Love & Cyberspace
unbekannt - |
 |
Sherlock Holmes- eine unautorisierte Biographie
unbekannt - |
 |
Spektrum
unbekannt - |
 |
Spider-Man 3 – der offizielle Roman zum Film
unbekannt - |
 |
Star Wars 63 - Dark Times: Der Weg ins Nichts 2 + Rebellion 1.2
unbekannt - |
 |
Staw Wars: X-Wing Rogue Squadron – Requiem für einen Rogue
unbekannt - |
 |
SUN KOH
unbekannt - |
 |
Tantra – Geheimnisse östlicher Liebeskunst
unbekannt - |
 |
The 9/11 Report
unbekannt - |
 |
The Dedalus Book of Austrian Fantasy: 1890-1930
unbekannt - |
 |
The Separation
unbekannt - |
 |
The Turtle Moves!
unbekannt - |
 |
Tomb Raider: The greatest treasure of all
unbekannt - |
 |
Train Train 1
unbekannt - |
 |
Trauma
unbekannt - |
 |
und wenn unsere Welt ihr Himmel ist?
unbekannt - |
 |
Unliebsame Geschichten
unbekannt - |
 |
Vergessene Bestie. Der Werwolf in der deutschen Literatur
unbekannt - |
 |
Versklavt
unbekannt - |
 |
Wahn
unbekannt - |
 |
Welten-Verwüster
unbekannt - |
 |
Wächter der Stille
unbekannt - |
 |
Zeelander
unbekannt - |
 |
Zero-Circle of Flow 1
unbekannt - |
 |
Zugeschanzt
unbekannt - |
 |
Zwischen Tecumseh und Doktor Fu Man Chu
unbekannt - |
[Zurück zur Übersicht]
ManuskripteBITTE KEINE MANUSKRIPTE EINSENDEN!
|

Copyright © 2007 - 2018 literra.info