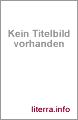|
|
Startseite > Rezensionen > Thomas Harbach > Science-Fiction > Rückkehr zum Mittelpunkt der Erde |
Rückkehr zum Mittelpunkt der Erde
Link Rezi2Book: Buch konnte nicht gefunden werden.| RÜCKKEHR ZUM MITTELPUNKT DER ERDE
|
Mit dem „Mammoth Book of New Jules Verne Adventures“ – der Originaltitel mit der Betonung auf Abenteuer und nicht unbedingt utopischer Literatur trifft die Bandbreite Vernes Schaffen deutlich besser – legen die beiden Engländer Mike Ashley eine der empfehlenswertesten Themenanthologien der letzten Jahren auf. Zum einhundertsten Todestag Vernes haben sie eine ausgezeichnete Auswahl von modernen Science Fiction Autoren versammelt, die entweder in der Tradition Vernes geschrieben, Vernes umfangreiches Werk um eine Anekdote oder Nuance bereichert oder schließlich auch seine Lebensgeschichte in ein phantastisches Szenario integriert haben. Mit einer solchen Spekulation beginnt eine der wenigen nicht exklusiv für diese Sammlung geschriebenen Kurzgeschichten: Stephen Baxter spekuliert in „Der Minister auf den Schienen“ über eine Begegnung des sehr jungen Vernes mit den ersten Eisenbahnen in England. Die Bindung zu Verne ist eher vage und hätte den Plot der Geschichte auch nicht reduziert, wenn ein unbekannter Autor oder H.G. Wells oder eine andere historische Berühmtheit eingesetzt worden wäre. Baxter bemüht sich, den schwerfälligen Ton der Abenteuerliteratur des neunzehnten Jahrhunderts zu treffen, sein Konzept wirkt allerdings schwerfällig und manchmal im Zuge der eher unwahrscheinlich klingenden Geschichte behäbig gesetzt. Mit „Der Weg des Jehan Thun“ geht Brian Stableford in seiner Fortsetzung zu „Mr. Zacharias“ auf das ganz frühe Werke Jules Vernes ein. Ähnlich wie K.W. Jeters intelligenter Roman „Das Geheimnis des Uhrmachers“ versucht Stableford, eine bedrohliche Atmosphäre zu erschaffen, die in erster Linie auf Aberglaube und Angst vor dem unvermeidlichen Fortschritt basiert. Im Gegensatz zu den oft sehr intelligenten, pointierten Texten Stablefords, fällt es ihm hier schwer, eine unterhaltsame Geschichte mit einer Botschaft zu kombinieren und nach einer guten Einführung wirkt insbesondere der Höhepunkt des eher umständlich erzählten Plots kontraproduktiv. Der Herausgeber Eric Brown macht es in der kurzen, aber sarkastisch scharfen Geschichte „Sechs Wochen im Ballon“ deutlich besser. Als Ghostwriter hat Verne die ursprüngliche Geschichte geschrieben, die von dem Reisenden mit antideutschen Bemerkungen und Kommentaren zu Bewegungen deutscher Truppen in Afrika aufgewertet worden ist. Die Folge – wie auch Vernes Texte, die oft als Tatsachenberichte und nicht als Fiktion gewertet worden sind – ist ein früh ausbrechender Krieg zwischen Deutschland und England, der sich mehr oder minder heftig über siebzig Jahre dahin zieht und in dessen Verlauf der Erste und Zweite Weltkrieg integriert werden können. Sehr intelligent mit einem Auge für eine gute Pointe baut Brown seine kurzweilig zu lesende und vor allem sehr kompakte Geschichte aus. Dabei erinnert die Inszenierung fast a eine Hommage an Sir Henry Rider Haggards Afrikageschichten und weniger an Vernes trotz aller Intelligenz apolitische Romane. James Lovegroves Satire „Londres au XXI Siecle“ auf einen sehr spät entdeckten futuristischen Roman Vernes scheitert im Kern an seiner größten Stärke, eine fragmentarische Struktur. Ist die erste Episode – eine Maschine entscheidet aufgrund populistischer Hochrechnungen, welche Art von Literatur noch verlegbar/ vekäuflich ist – noch originell, verstrickt sich Lovegrove in den folgenden Abschnitten in nicht immer originellen oder unterhaltsamen Episoden und verliert den schwachen roten Faden gänzlich aus den Augen. Die nächsten beiden Geschichten von Ian Watson und Peter Crowther setzen sich mit Jules Vernes – zumindest was die utopischen Texte angeht – besten und unterhaltsamsten Roman „Die Reise zum Mittelpunkt der Erde“ auseinander. Dabei ist der Tenor der beiden Storys sehr unterschiedlich, Ian Watsons „Riesenhafte Zwerge“ ist eine Collage aus Jules Vernes Roman, Indiana Jones – sie treffen auf eine Gruppe von Nazis, die aus Polen heraus siebzig Jahre später ebenfalls den Einstieg in die Unterwelt wagen – Abenteuer und pulpiger Handlung. Watson ist ein erfahrener Autor, der fast im Vorübergehen verschiedene Elemente kombiniert. So spielt er mit der damals populären Hohlwelttheorie und stellt die aufrechten Engländer/ Franzosen den finsteren und klischeehaft überzeichneten Nazis gegenüber. Die zweite Geschichte von Peter Crowther „Geschichten aus dem Land am Ende eines Arbeitertages“ benötigt – nicht zuletzt aufgrund ihrer Länge von über achtzig Seiten – eine gewisse Anlaufzeit. Zu Beginn wirkt sie wie eine ernsthafte Hommage an Spider Robinsons „Geschichten aus Calahan Bar´s“ und oder Arthur C. Clarkes „Geschichten aus dem weißen Hirschen“, wobei sich die erzählten Erlebnisse zum einen auf Jules Vernes Texte und zum anderen auf populäre Figuren der dreißiger Jahre – siehe Peter Lorre – beziehen. De Leser wird aber mit den einzelnen Protagonisten nicht warm und der Handlungsbogen scheint ins Leere zu laufen. Erst gegen Ende des Textes nimmt Crowther zunehmend die Idee der Reise, des Vermittelns des Abenteuers auf. Hier zeigt er eine überraschende emotionale Tiefe und das Gefühl der Melancholie, der verpassten Chancen springt von den einzelnen Protagonisten ausgehend auf den Leser über. Es ist eine Story, die einem aufmerksamen Betrachter ans Herz wächst und rückblickend betrachtet den stärksten Eindruck hinterlässt. Crowther nimmt nur wenige Motive insbesondere aus „Die Reise zum Mittelpunkt der Erde“ auf. Er entwickelt aber eine stimmige Atmosphäre und gegen Ende gelingen ihm ein oder zwei unheimliche sowie spannende Szenen mit einem metaphorischen, aber überzeugendem Abschluss. Einen weiteren Schwerpunkt bildet Vernes Roman „Von der Erde zum Mond“. Sowohl Laurent Genefords „Die wahre Geschichte über Barbicanes Reise“ als auch Stephen Baxters „Columbiad“ geht von dem Faktum aus, dass die Reise wirklich stattgefunden hat, Vernes literarische Umsetzung aber absichtlich wichtige Elemente ausgelassen hat. In beiden Geschichten wird der Bogen zu H. G. Wells und seine berühmten Science Fiction Romanen geschlagen, im ersten Fall sind die Erlebnisse der Mondfahrer erst im Wells Buch „Die ersten Menschen im Mond“ an das Licht der Öffentlichkeit gekommen, in der zweiten Geschichte versucht einer der Reisenden einen uneinsichtigen Besucher von der Wahrheit zu überzeugen. Zu den Höhepunkten gehört der Besuch der ehemaligen Abschussrampe des Baltimore Clubs, ein Zeugnis des menschlichen Fortschritts und gleichzeitig der Vergänglichkeit der Geschichte. Beide Texte sind – im Gegensatz zu Vernes oft farbenprächtigen Geschichten – eher verhalten mit einer komplexen Rückblendenstruktur geschrieben und obwohl die Kernthematik in beiden Fällen Überschneidungen zulässt, ergeben sie als ein Werk betrachtet einen interessanten, komplexen Plot mit einem tragischen Ausgang.
Fakten und Fiktion verbindet die sehr unterhaltsame, stimmungsvolle Geschichte von Gwynplaine MacIntyre. In „Tableux“ nimmt sie die tatsächliche Reise der Gebrüder Verne nach New York zum Anlass, um dem Autoren einen Einblick in eine düstere Zukunft zu geben. Nicht zuletzt aufgrund dieser Vision hat sich Vernes optimistisch- abenteuerliches Werk drastisch verändert. Der Reiz dieser Geschichte liegt in seinen subtilen Andeutungen und der von Beginn an bestimmend gezeichneten Atmosphäre. Mit „Das Geheimnis der Nautilus“ von Michael Mallory ist der Auftakt zu Jules Vernes berühmtester Schöpfung – der Nautilus des Kapitän Nemo – gemacht. Dabei verbindet der Autor in seiner Fortsetzung nicht nur wichtige, aber insbesondere in „Die geheimnisvolle Insel“ nur angedeutete Nuancen mit der Geschichte – der Vulkanausbruch des Krakatau – und schlägt den Bogen zu „Robur, dem Eroberer“. Wie viele andere Verne Experten sieht er in Robur nicht nur eine Inkarnation Nemos, sondern den nicht unbedingt in Ehren gealterten Kapitän per se. Insbesondere zu Beginn liest sich der Text trotz einer Fülle von Ideen eher schwerfällig, die Idee, einen Rahmen um das Geschehen zu platzieren, distanziert den Leser noch weiter von der sehr sachlich und emotionslos erzählten Handlung. Die erste Nemo- Geschichte der Sammlung überzeugt darum auch weniger als Erzählung, sondern wirkt wie ein Expose einer größeren Arbeit, auf die der Leser wahrscheinlich vergeblich warten muss. Dabei macht es sich der Autor auch in Bezug auf das zweite Untersee- Boot zu leicht, das scheinbar aus dem Nichts heraus entworfen und gebaut worden ist, ohne das insbesondere Kapitän Nemo eine überzeugende Begründung oder den Versuch einer Erläuterung liefern konnte. Auf einer amüsanten, aber inzwischen fast in Vergessenheit geratenen Kurzgeschichte – „Eine Idee des Dr. Ox“ – basiert Keith Brooks „Dr. Bull mischt sich ein“. In einer nicht all zu fernen Zukunft hat die Menschheit ihren Lebenswillen verloren, verbringt die Tage vor dem Fernseher mit endlosen Soaps und verzichtet auf die Kommunikation mit dem Nachbarn. Der plötzlich in der kleinen, unscheinbaren Ortschaft auftauchende Dr. Bull belebt mit einem Experiment nicht nur die Lebensgeister, sondern wahre Gefühle wie Liebe und Wut brechen ebenfalls wie im Frühling in der Oberfläche hervor. Teilweise mit fatalen Folgen. Brooks gelingt es in erster Linie, Vernes belehrenden Schreibstil – inklusiv der verschiedenen pseudowissenschaftlichen Exkursionen zu imitieren. Da die Idee zumindest seit Vernes Text keine neue mehr ist und selbst Stephen King sich in seinem „Needful Things“ an ihr versucht hat, wird durch diese Vorgehensweise ein wenig in den Hintergrund gedrängt. Allerdings fehlt – elementar für diese Thematik – auch eine persönliche Ebene zum Leser. Er kann sich weder mit den Opfern des Experiments noch mit den Tätern wirklich identifizieren, nur der Anstifter Dr. Bull wird charismatisch beschrieben. Johan Heliots „Der allererste Fall“ ist nicht nur der erste Auftritt Phileas Foggs – oder in diesem Fall seines Dieners -, sondern beleuchtet wie Phillip Jose Farmers herausragender Roman „Das andere Log des Phileas Fogg“ die wahren Hintergründe der Reise in achtzig Tagen um die Erde. In diesem Fall ist die Auflösung nicht nur überraschend – anscheinend besucht Fogg Stellen auf unserem Planeten, an denen die Verbindung zu Parallelwelten besonders dünn ist und er mit seinen Brüdern – alles bekannte fiktive Persönlichkeiten – besser Kontakt aufnehmen kann. Auch die Identität des Erzählers ist – wenn auch die Vermutungen erst in eine andere Richtung laufen – eine Überraschung. Eine gut geschriebene und vor allem inhaltlich sehr schöne Hommage an das Original, sehr geschickt verbindet der Autor verschiedene Pulpfiguren zu einer beunruhigen These und unterhält den Leser im Stile des Meisters überzeugend. In „Achtzig Briefe und ein weiterer“ von Kevin J. Anderson und Sarah Hoyt verfolgt der Leser in Briefform die Reise i achtzig Tagen um die Erde aus der Perspektive des dritten Mannes, des Polizisten Fix, der in Fogg einen skrupellosen Dieb auf der Flucht sieht. Er schreibt seinem Weib jeden Tag einen Brief, die Kurzgeschichte umfasst einen Teil dieser Briefe. Leider nutzt sich die Idee sehr schnell ab, da Fix von seiner Idee besessen ist und bis auf den weiteren Brief im Grunde nur die Erlebnisse Foggs aus einer weiteren, anderen aber nicht unbedingt neuen oder originellen Perspektive beschreibt. Am Ende erwartet der Leser im Grunde mehr als diese profane Lösung, die Fix – nach dem beruflichen Scheitern – auch privat als Verlierer dastehen lässt. Da der Leser weiterhin die Empfängerin der Briefe nicht kennt und sich kein Bild machen kann, geht die Intention dieser sehr kurzen und trotzdem gedehnt wirkenden Geschichte ins Leere. Justina Robsons „Die Liga der Abenteurer“ leidet trotz der – ebenfalls durch Alan Moores „League of Extraordinary Gentlemen“ bekannten Idee – mehr unter ihrem künstlich schwerfällig gemachten Schreibstil. Auch wenn eine Anlehnung an Moores Comic und die spätere Verfilmung nicht verneint werden kann, bringt sie einige wenige – die große scheinbar lebende Insel, auf der neben Jules Verne als Autor und Anführer der Gruppe noch eine Reihe historischer Persönlichkeiten leben und gemeinsam für das Gute auf der Welt kämpfen – gute Ideen in die Geschichte ein. Die größte Schwierigkeit besteht leider in der Tatsache, dass der übergeordnete Erzähler blass, fast unwirklich bleibt. Aus dieser Geschichte hätte eine gute Erzählerin wie Robson deutlich mehr machen können, man merkt ihrem Text die Schwierigkeit ein, dass weder Jules Verne noch das 19. Jahrhundert im Grunde ihre Themen und Zeiten sind.
„Hector Servadac Junior“ von Adam Roberts bezieht sich auf Jules Vernes ungewöhnlichen Roman „Die Reise durch die Sonnenwelt“, in dem – im Vergleich zum Kanonenclub und dessen Flug zum Mond – ganz eindeutig die technologischen Elemente in den Hintergrund getreten sind und Verne sich an einer Robinsonade in der Tradition Jonathan Swifts versucht hat. Diese Faden nimmt Roberts sehr intelligent wieder auf, Servadacs Reise wird als fiktive Geschichte aus einem Buch Vernes dargestellt, bevor die Ereignisse der Geschichte in die von Roberts entwickelte Wirklichkeit übergreifen. So phantastisch, wenn auch nicht unbedingt originell die grundlegende Idee auch sein mag, insbesondere in der deutschen Übersetzung wirkt die Geschichte schwerfällig, die Charakterisierung der einzelnen Protagonisten extrem überzogen und wenig sympathisch. Adam Roberts Stärke sind die Romanen, in denen er mit Hilfe verschiedener Handlungsebenen und deren Kombination Spannung erzeugen kann. Obwohl seine Geschichte zu den längeren Texten der Sammlung gehört, wirkt sie statisch und seltsam distanziert. Erst im letzten Drittel – als Servadac anscheinend die Reise seines Vaters zu wiederholen beginnt – lebt die Handlung auf, um dann im wahrsten Sinne des Wortes im Nichts zu enden und den Leser unbefriedigend zurückzulassen. „Die mysteriösen Iowaner“ aus der Feder Paul di Filippos ist ein weiter Höhepunkt der Sammlung. Geschickt baut er gesellschaftliche Kritik auf das Fundament einer Ansammlung von Verne Charakter, nutzt dessen Versatzstücke, um eine gänzlich andere Geschichte zu erzählen und kaum hat der Leser sich an eine eher nihilistische Lösung gewöhnt, zieht er einen weiteren Protagonisten aus dem Hut, fabuliert eine sehr gewagte, aber interessante These und beendet seinen Text zwar auf einer offenen Note, aber mit viel Schwung. Dazu kommen die oft nur angedeuteten bizarren Hintergründe, die vor dem sozialen Hintergrund des neunzehnten Jahrhunderts sehr gut entwickelt sind, aber insbesondere in ihrer Kritik durchaus auf die Gegenwart durchschlagen. Das ein Außenseiter quasi zum Resonanzkörper dieser Entwicklung wird, macht es dem Leser leichter, den einzelnen Anspielungen zu folgen. Im Gegensatz zu vielen anderen Texten dieser Sammlung sollte der Außenstehende die Originale schon sehr gut kennen, um insbesondere die Nebencharakter besser einordnen zu können. Di Filippo erweist sich zum wiederholten Male als ausgezeichneter Kurzgeschichtenautor und es ist an der Zeit, dass vielleicht einige Kleinverlage einige seiner Sammlung übersetzen und veröffentlichen. Damit dieses unterhaltsame Kleinod nicht mehr lange alleine steht.
„Altes Licht“ von Tim Lebbon leidet deutlich unter der Unentschlossenheit, die Vorlage Jules Vernes – in diesem Fall sein dunkler, nihilistischer Roman „Das Karpatenschloss“ – wirklich entschlossen umzusetzen oder als Ausgangbasis zu nehmen. Zu lange bleibt der Protagonist und damit auch der Leser in dem Schwebezustand, ob es wirklich eine Verbindung zwischen diesem verne´schen Werk und dem Schicksal der beiden sich liebenden Menschen gibt. Als diese dunkle Brücke gefunden worden ist, wickelt Lebbon fast emotionslos und z distanziert die Handlungsfäden entschlossen ab und entlässt den Leser mit einer ambivalenten Prophezeiung wieder in die Wirklichkeit. Aus der Idee der alten Taschenlampe, die besondere Lichterscheinungen bewirkt wäre deutlich mehr herausarbeiten, wenn man sich intensiver um den Plot und weniger um das Ambiente bemüht hätte. Die nächsten beiden Geschichten setzen sich mit dem Baltimore Gun Club auseinander, aber weniger mit deren ersten Abenteuer und dem Schuß zum Mond, sondern der deutlich mehr satirische Elemten enthaltenden zweiten Geschichte, in welcher die Herren die Erdachse verändern, die Arktis eisfrei machen und die von ihnen geschätzten ungeheuren Kohlvorräte abbauen wollten. Molly Brown hat sich in „Die Gesellschaft der Mondgärtner“ einer anderen abstrusen Idee angenommen, die Umweltverschmutzung im 19. Jahrhundert in Kombination mit einem frühen Terraforming des Mondes durch die Entsendung von Müllraketen, die neben den biologischen Abfällen in erster Linie Stickstoff zum Erdtrabanten transportieren sollen. Eine gelungene Parodie zeichnet sich in eine ernsthafte Idee aus, die grotesk verzerrt und dann entschlossen erzählt wird. Alles Elemente dieser bestechend unterhaltsam, sehr kompakt geschriebenen und seltsam sympathischen Story. Auch wenn in der Nacherzählung die eigentliche Idee ein wenig altbacken wird, kommt sie hier frisch und unkonventionell berichtet daher und reiht sich in die besseren Geschichten dieser Sammlung ein. Sehr viel mehr Schwierigkeiten hat Tony Ballantyne in „Eine Frage der Mathematik“. Ein wenig spröde aufgebaut, sehr distanziert geschrieben ist es immer eine knifflige Anlegenheit, den Leser in die von der eigentlichen Mission ablenkende Handlung mit einzubeziehen. Dazu fällt auch noch ein solider Brückenschlag zu den Protagonisten, die alle sehr unsympathisch und eindimensional gezeichnet daherkommen. Die Auflösung der Erzählung ist die eigentliche Enttäuschung, der Plot wird durch einen Dialog abgeschlossen, in welchem der Leser eher vor den Kopf gestoßen als aufgeklärt wird.
Obwohl Richard Lupoffs „Das Geheimnis der Sahara“ auf eine späte Erzählung Verns Bezug nimmt, erinnert seine Geschichte mehr an die klassischen Pulpabenteuer. Eine bunt gemischte Gruppe von Abenteurern macht sich auf die Suche nach einer unbekannten Art, die anscheinend in den Höhlen unter der Sahara haust. Nur die Idee des künstlich geschaffenen Sahara- Meeres wird aus Vernes Werk übernommen. Im Gegensatz zu Lupoffs oft überzeichneten, satirischen Texten ist die vorliegende Story bodenständig, mäßig spannend, aber routiniert gut geschrieben. Insbesondere am Ende mit der düsteren Andeutung einer weiteren, dann allerdings ungleicheren Auseinandersetzung zwischen den Menschen und den gefundenen Kreaturen vermisst der Leser weitere Informationen oder vor allem einen soliden Abschluss. Eine ähnliche Schwäche weißt Sharan Newmans „Die Jagd nach dem goldenen Meteor“ auf. Hier wird Jules Vernes letzter, posthum gefundener Roman mit H.G. Wells Erzählung „Die Zeitmaschine“ kombiniert. Was auf den ersten Blick wie eine gute Idee wirkt und sich zumindest zu Beginn der Handlung interessant entwickelt, verliert ihre Effektivität durch das eher plötzliche Ende, in welchem der Autor zeigt, dass er keine rechte Idee hatte, den Text wirklich überzeugend zu beenden. Zwar ist seine Auflösung von kühler Logik, aber nach einer interessanten Spielerei hätte man sich deutlich mehr Ideen und vor allem ein überzeugendes Ende gewünscht. „Die wahre Geschichte des Wilhelm Storitz“ verbindet nicht nur eine H.G. Wells Idee, sondern deren zwei mit einem obskuren Roman Jules Vernes. Michel Pagel nutzt einmal die Briefform, um dem Leser die bekanntere Version des Unsichtbaren aus H.G. Wells Roman mit der nur angelehnten Geschichte Vernes zu verbinden. Danach schließt sich im Grunde der wahre Bericht dieser Ereignisse aus der schuldbewussten Perspektive des Verursachers an. Schnell erkennt der Leser in dieser sachlich geschrieben, emotionslosen und deswegen auch nicht unbedingt
ansprechenden Geschichte die Pointe deutlich im Vorwege. Sie weckt allerdings das Interesse, die Originalfassung von Jules Vernes Roman zu lesen und dann einen Vergleich zwischen H.G. Wells und diesem Werk anzustellen.
Die letzte Geschichte – Liz Williams „Das schwimmende Hotel“ – fasst die Sammlung passend zusammen. Wie alle Texte von Jules Verne inspiriert nutzt sie dessen weltbekannte Protagonisten, um Sachverhalte im Grunde mit einem Schlagwort zu erläutern anstatt auf langwierige Erläuterungen zurückzugreifen. Darüber hinaus versucht sie nicht, eine Hommage an Jules Verne und sein Werk zu verfassen, sondern einen möglichst weitesgehend eigenständigen Weg zu gehen. In ihrem Fall ist allerdings die Geschichte zu geradlinig angelegt, insbesondere in der zweiten Hälfte des Textes sehnt sich der Leser förmlich nach weitergehenden Erklärungen und dem Aufbau einer entsprechenden Gegenposition zu dem eher sachte dahinfliessenden Strom der Geschichte. Dabei wäre insbesondere aus ihrem neureichen Protagonisten, der versucht, ein einzigartiges Projekt fertig zu stellen, deutlich mehr heraus zu kristallisieren und als Bestandteil eines umfangreicheren Werkes hätte diese Episode besser gewirkt als eigenständige Geschichte mit einem zwar richtigen Anfang, aber im Grunde keinem Ziel.
Die Sammlung umfasst eine Reihe von sehr lesenswerten Geschichten, eine Handvoll von interessanten Inspirationen und auch einige Texte, die eher die Lust wecken, die Originale
zu lesen. Das Spektrum umfasst im Grunde Jules Vernes gesamtes Werk, von den abenteuerlichen Frühwerken bis zu den düsteren Warnungen vor dem Menschen und seinem hemmungslosen Zerstörungs- und Eroberungsdrang. Viele der vorliegenden Texte nutzen dessen Werk nur als Sprungbrett zu eigenständigen Kreationen. Das Preis- Leistungsverhältnis der Sammlung macht den Kauf attraktiv, die Qualität der Geschichten ist hoch, selbst die misslungenen Hommageversuche lassen sich zumindest fließend lesen und beinhalten oft schwach umgesetzte, aber zumindest ansprechende Ideen. Außerdem stellt diese Sammlung von „neuen Jules-Verne- Geschichten“ einen guten Einstieg in das Werk des Franzosen dar. Nach den vielen oft misslungenen Verfilmungen ein guter Zeitpunkt, um sich – nicht zuletzt dank der Mühe, die sich Verlage wie Piper oder Artemis & Winkler mit sehr guten Neuübersetzungen machen – einem der beiden Väter der Science Fiction zu widmen. Dabei ist es erstaunlich, wie viele der Autoren Verne und Wells gleichzeitig abhandeln und manchmal zu verblüffenden, unterhaltsamen und vor allem spannenden Theorien kommen.
Mick Asley & Eric Brown: "Rückkehr zum Mittelpunkt der Erde"
Anthologie, Softcover, 640 Seiten
Bastei Taschenbuch 2006
ISBN 3-4042-0548-0
http://www.sf-radio.net/buchecke/science_fiction/i...
Der Rezensent
Thomas HarbachTotal: 732 Rezensionen
März 2018: keine Rezensionen
Weitere Rezensionen
 |
Alien Earth - Phase 1
unbekannt - |
 |
Aljoscha der Idiot
unbekannt - |
 |
Allmachtsdackel
unbekannt - |
 |
Allmachtsdackel
unbekannt - |
 |
Alltag im Mittelalter – Das Leben in Deutschland vor 1000 Jahren
unbekannt - |
 |
Als Dämon brauchst du nie Kredit
unbekannt - |
 |
Alte Ruhrgebietsküche
unbekannt - |
 |
Am Rande des Abgrundes
unbekannt - |
 |
Amazone meines Herzens
unbekannt - |
 |
Anansi Boys
unbekannt - |
 |
Anansi Boys
unbekannt - |
 |
Anatolia Story 8
unbekannt - |
 |
Angriff der Anangu
unbekannt - |
 |
Apolos Auge
unbekannt - |
 |
Arena
unbekannt - |
 |
Argentinische Erzählungen
unbekannt - |
 |
Ark Angels 1
unbekannt - |
 |
Artemis Fowl - die verlorene Kolonie
unbekannt - |
 |
Ausgebrannt
unbekannt - |
 |
Befreiung in Camouflage
unbekannt - |
 |
Begegne deiner Fee
unbekannt - |
 |
Beste Grüße von den Simpsons
unbekannt - |
 |
Bezwinger der Natur/ Die vierte Dimension
unbekannt - |
 |
Bibi 7
unbekannt - |
 |
Bis in den Tod
unbekannt - |
 |
Blutige Geburt
unbekannt - |
 |
Bokura Ga Ita 3
unbekannt - |
 |
Creepers
unbekannt - |
 |
Das Alptraum-Netzwerk
unbekannt - |
 |
Das Amphora- Projekt
unbekannt - |
 |
Das Feen-Geschenk: Der Schlüssel zum magischen Königreich
unbekannt - |
 |
Das Gesetz des Waldes
unbekannt - |
 |
Das Grabmal der Kleopatra
unbekannt - |
 |
Das Land des Yann
unbekannt - |
 |
Das Lexikon des Dunklen
unbekannt - |
 |
Das Monster von Stonehenge
unbekannt - |
 |
Das Perfekte Dinner – Das Kochbuch
unbekannt - |
 |
Das Schlangenschwert
unbekannt - |
 |
Das Schweigen
unbekannt - |
 |
Das Schwert des Bösen
unbekannt - |
 |
Das Spiel
unbekannt - |
 |
Das unendliche Licht
unbekannt - |
 |
Dear Myself
unbekannt - |
 |
Der Cthulhu-Mythos 1976 – 2002
unbekannt - |
 |
Der entfesselte Judas
unbekannt - |
 |
Der Flatbootmann
unbekannt - |
 |
Der Kosmische Verbrecher
unbekannt - |
 |
Der Krieg der Propheten 2. Der Prinz aus Atrithau
unbekannt - |
 |
Der Kristallschädel
unbekannt - |
 |
Der letzte Tag der Schöpfung
unbekannt - |
 |
Der Magier von Maronar
unbekannt - |
 |
Der Milliardenmörder
unbekannt - |
 |
Der Mutator
unbekannt - |
 |
Der Mönch Laskaris
unbekannt - |
 |
Der Schattenlehrling
unbekannt - |
 |
Der Schrecken von Mohringen
unbekannt - |
 |
Der Sohn des Waffenmeisters
unbekannt - |
 |
Der Sternenwanderer
unbekannt - |
 |
Der unterirdische Fluss
unbekannt - |
 |
Der verliebte Teufel
unbekannt - |
 |
Der verlorene Troll
unbekannt - |
 |
Der Waltras 1
unbekannt - |
 |
Der Weg des Tanzes
unbekannt - |
 |
Der zeitlose Winter
unbekannt - |
 |
Die acht Namenlosen
unbekannt - |
 |
Die Alptraumfabrik
unbekannt - |
 |
Die Bedrohung
unbekannt - |
 |
Die Bestie
unbekannt - |
 |
Die brennenden Schiffe
unbekannt - |
 |
Die dunkle Herrlichkeit
unbekannt - |
 |
Die Energiekriege
unbekannt - |
 |
Die Enteigneten
unbekannt - |
 |
Die Erfindung des Kosmos
unbekannt - |
 |
Die Geschwindigkeit des Dunkels
unbekannt - |
 |
Die Herren von Sydney
unbekannt - |
 |
Die Kanonen von Dambanor II
unbekannt - |
 |
Die Kanonen von Dambanor II
unbekannt - |
 |
Die Kinder Hurins
unbekannt - |
 |
Die Lebensboten
unbekannt - |
 |
Die Liebe der Zukunft vor 100 Jahren
unbekannt - |
 |
Die Liebe der Zukunft vor 100 Jahren
unbekannt - |
 |
Die Morax
unbekannt - |
 |
Die Nebel der Dunkelheit
unbekannt - |
 |
Die Ohnmächtigen
unbekannt - |
 |
Die Ohnmächtigen
unbekannt - |
 |
Die PSI- Fabrik
unbekannt - |
 |
Die Psi-Fabrik
unbekannt - |
 |
Die Rache der Schattenreiter
unbekannt - |
 |
Die Reliktjäger
unbekannt - |
 |
Die Schatten-Chronik
unbekannt - |
 |
Die Schlacht um Triple Sun
unbekannt - |
 |
Die Schöpfungsmaschine
unbekannt - |
 |
Die Schöpfungsmaschine
unbekannt - |
 |
Die Spinnen-Seuche
unbekannt - |
 |
Die Stadt Gottes
unbekannt - |
 |
Die Sternenhorcher
unbekannt - |
 |
Die Straße zur Verdammnis
unbekannt - |
 |
Die Tochter der Himmelsscheibe
unbekannt - |
 |
Die Traumkapseln
unbekannt - |
 |
Die Verschwörung
unbekannt - |
 |
Draculas Wiederkehr
unbekannt - |
 |
Dream Kiss 2
unbekannt - |
 |
Ein Albtraum erwacht
unbekannt - |
 |
Ein Blick in die Zukunft 2407
unbekannt - |
 |
Ein zerebraler Schriftsteller und Philosoph namens Lem
unbekannt - |
 |
Eine höllische Rettung
unbekannt - |
 |
Fatimas Tränen
unbekannt - |
 |
Fletcher Moon - Privatdetektiv
unbekannt - |
 |
Fluch der Karibik – Roman zum ersten Kinofilm
unbekannt - |
 |
Flucht zum Mars
unbekannt - |
 |
Forschungsraumer CHARR
unbekannt - |
 |
Frankenstein- die Kreatur
unbekannt - |
 |
Game Master: World of Warcraft Trading Card Game Poster-Collection 1
unbekannt - |
 |
Geeks
unbekannt - |
 |
Gefesselt in Liebe
unbekannt - |
 |
Geheime Zauberkräuter – Legenden, Riten, Rezepturen
unbekannt - |
 |
Gestalt 5
unbekannt - |
 |
Grausame Städte
unbekannt - |
 |
Hainish
unbekannt - |
 |
Halbnackte Bauarbeiter
unbekannt - |
 |
Handbuch des Okkultismus
unbekannt - |
 |
Hannibal Rising
unbekannt - |
 |
Harry Potter and the Deathly Hallows
unbekannt - |
 |
Haschisch
unbekannt - |
 |
Haschisch
unbekannt - |
 |
Honigfalter
unbekannt - |
 |
Horrortrip ins Schattenland
unbekannt - |
 |
Hunger
unbekannt - |
 |
Hurricane- Zyklus
unbekannt - |
 |
Im Dorf der Telephaten
unbekannt - |
 |
Im Turm der lebenden Toten
unbekannt - |
 |
Im Zeichen der Erhabenen
unbekannt - |
 |
Imperator- die Zeitverschwörung
unbekannt - |
 |
Innocent Bird 1
unbekannt - |
 |
Inu Yasha 45
unbekannt - |
 |
Jules Verne
unbekannt - |
 |
Justice League of America 1: Gestern, heute, morgen + Der Pfad des Tornado, Kap. 1: Leben + Der Pfad des Tornado, Kap. 2: Tornado-Rot/Tornado-Blau
unbekannt - |
 |
K-A-E 29th Secret - Blank File
unbekannt - |
 |
Kamasutra heute: Sex-Geheimnisse für Liebende
unbekannt - |
 |
Karl May Welten I
unbekannt - |
 |
Karl May Welten II
unbekannt - |
 |
Kiss me, Princess 4
unbekannt - |
 |
Krieg in der Hohlwelt
unbekannt - |
 |
La Esperanza 3
unbekannt - |
 |
Land der Lügen
unbekannt - |
 |
Lerchenlicht
unbekannt - |
 |
Lexikon der deutschen Science Fiction & Fantasy 1919-1932
unbekannt - |
 |
Lexikon der deutschen Science Fiction und Fantasy 1919-1932
unbekannt - |
 |
Lumen
unbekannt - |
 |
Lumen. Wissenschatliche Novellen
unbekannt - |
 |
Lust auf Zucchini
unbekannt - |
 |
Marilyn Manson – Talking
unbekannt - |
 |
Mein König
unbekannt - |
 |
Merlins böses Ich
unbekannt - |
 |
Metan
unbekannt - |
 |
Midoris Days 2
unbekannt - |
 |
Musouka 1
unbekannt - |
 |
Nachgefragt: Europa – Basiswissen zum Mitreden
unbekannt - |
 |
Nachtwanderung
unbekannt - |
 |
Narrenturm
unbekannt - |
 |
Nighthawk
unbekannt - |
 |
Orange Planet 1
unbekannt - |
 |
Piratenfluch
unbekannt - |
 |
Prime Minister 1
unbekannt - |
 |
Psyhack
unbekannt - |
 |
Punisher – Irisches Erbe
unbekannt - |
 |
Quantico
unbekannt - |
 |
Rah Norton
unbekannt - |
 |
Reisen von Zeit zu Zeit
unbekannt - |
 |
Ritual in den Tod
unbekannt - |
 |
Septimus Heap 2- Flyte
unbekannt - |
 |
Sex, Love & Cyberspace
unbekannt - |
 |
Sherlock Holmes- eine unautorisierte Biographie
unbekannt - |
 |
Spektrum
unbekannt - |
 |
Spider-Man 3 – der offizielle Roman zum Film
unbekannt - |
 |
Star Wars 63 - Dark Times: Der Weg ins Nichts 2 + Rebellion 1.2
unbekannt - |
 |
Staw Wars: X-Wing Rogue Squadron – Requiem für einen Rogue
unbekannt - |
 |
SUN KOH
unbekannt - |
 |
Tantra – Geheimnisse östlicher Liebeskunst
unbekannt - |
 |
The 9/11 Report
unbekannt - |
 |
The Dedalus Book of Austrian Fantasy: 1890-1930
unbekannt - |
 |
The Separation
unbekannt - |
 |
The Turtle Moves!
unbekannt - |
 |
Tomb Raider: The greatest treasure of all
unbekannt - |
 |
Train Train 1
unbekannt - |
 |
Trauma
unbekannt - |
 |
und wenn unsere Welt ihr Himmel ist?
unbekannt - |
 |
Unliebsame Geschichten
unbekannt - |
 |
Vergessene Bestie. Der Werwolf in der deutschen Literatur
unbekannt - |
 |
Versklavt
unbekannt - |
 |
Wahn
unbekannt - |
 |
Welten-Verwüster
unbekannt - |
 |
Wächter der Stille
unbekannt - |
 |
Zeelander
unbekannt - |
 |
Zero-Circle of Flow 1
unbekannt - |
 |
Zugeschanzt
unbekannt - |
 |
Zwischen Tecumseh und Doktor Fu Man Chu
unbekannt - |
[Zurück zur Übersicht]
ManuskripteBITTE KEINE MANUSKRIPTE EINSENDEN!
|

Copyright © 2007 - 2018 literra.info