Die CULTurMAG-Redaktion dankt Markus Pohlmeyer für seine wunderbaren Beiträge und gratuliert zu einem Jubiläum. Zum 50. Jahrestag des Kultfims 2001 (das Deutsche Filmmuseum zeigt dazu eine Ausstellung) dürfen wir Ihnen seinen 50. Essay präsentieren. Beachten Sie außerdem die Literarurliste am Schluss, die alle bei uns erschienen Artikel enthält. Viel Vergnügen beim Lesen und Nachdenken!

2001 – Stanley Kubrick: Homer im Weltraum.
Ein Essay zum Jubiläum
I
1968 erschien ein seltsames Ding am Kinohimmel – anfänglich umstritten –, das in seiner Rezeption schon bald zu einem der besten Science Fiction-Filme, sogar zum besten aller Zeiten avancieren sollte.[1] Ein Plakat verkündete: „the ultimate trip“[2]; darauf zu sehen ein stilisierter Fötus mit großen, uns anblickenden Augen (im Weltraum schwebend, ein Sternenkind?), die Unterschrift des Regisseurs Stanley Kubrick und natürlich der Titel 2001: A SPACE ODYSSEY.[3] „Die vieldeutigen Bilder des Films sind längst ins Reservoir der Pop-Ikonen eingegangen, der Film selbst – vielfach als Trip unter Einfluß von Narkotika rezipiert – erlangte Kultstatus.“[4] Ambiguität charakterisiert das ästhetische Prinzip schlechthin in diesem Werk: „2001 ist […] vom Ursprung her ein visuelles, nonverbales Experiment, das intellektuelles Gerede vermeidet und das Unterbewusstsein des Zuschauers auf eine essentielle poetische und philosophische Weise erreicht.“[5] Diese Vieldeutigkeit, die gattungsüberschreitend und synästhetisch an Konzepte einer romantischen Universalpoesie erinnern mag,[6] steht in einer eigentümlichen Spannung mit archetypischen Mustern: der Mensch als Werkzeughersteller, als Krieger, als (Weltraum)Reisender, kurz (und auch selbstreferentiell) als (Filme)Macher – oder in der deutschen Form eines altgriechischen Wortes: als Poet! „Das wichtigste Werkzeug des Filmemachers ist die Filmkamera. Mit ihrer Erfindung hat die Menschheit ein Mittel in die Hand bekommen, mit dem wir Zeit abbilden können. […] Mit der Filmkamera gelang ein Sprung in eine neue Existenzform. Wir wurden zu Herrschern über Zeit und Erinnerung. […] Der Film beschreibt etwas unwiederbringlich Vergangenes in der Präsenz-Form.“[7] Kubrick zeigt uns etwas, was wir nie hätten sehen können: unsere prähistorische Vergangenheit. Er zeigt uns eine Gegenwart in der Zukunft, wie sie sein könnte, wie er sie sieht. Der visuelle Poet – so ein Buchuntertitel – zeigt, ja malt, musiziert eine Zukunft, die Raum und Zeit überschreitet, in der lineare Zeitlichkeit aufgehoben ist, unermessliche Räume durch- und überflogen werden, damit wir der Schöpfung des Kosmos beiwohnen.[8] Ein Ereignis, was wir nie hätten sehen können; und dies alles in einer Geschichte, die gemäß ihrem Wesen über Vergangenes erzählt: Es war einmal im Jahre 2001, als …
II
Der Mensch braucht zweifache Hilfe: durch Technik, sei es mittels Waffen oder Raumstationen oder Computer, und durch eine übergeordnete Instanz. Die entscheidenden Schritte hin zum Werkzeuggebrauch (am Anfang von 2001) und von da aus zu einer neuen Stufe der Evolution (das offene Ende von 2001) werden von einem schwarzen Monolithen initiiert. Dieser muss nicht unbedingt göttlich sein, sondern steht vielleicht in seiner sich verbergenden Entzogenheit, gewissermaßen als immanente black box, nur für eine andere, höhere Zivilisation. Dies legt ja auch die Kurzgeschichte von A. C. Clarke „The Sentinel“ nahe, welche als Ausgangspunkt für dieses Filmprojekt diente und die vielleicht auch einen Hinweis geben kann, warum die Discovery zum Jupiter fliegt: „Perhaps you understand now why that crystal pyramid[9] was set upon the Moon instead of on the Earth. Its builders […] would be interested in our civilisation only if we proved our fitness to survive – by crossing space and so escaping from the Earth, our cradle.”[10] Und Kubrick braucht die weite Reise zum Jupiter auch für das HAL-Drama.
 Zeiten und Räume: Wir sehen in unsere ferne afrikanische Vergangenheit. Millionen Jahre werden dann in einem Match Cut übersprungen. Scheinbar quälend langsame Reisen zum Mond und auf dem Mond selbst;[11] das Gleiten des Raumschiffs Discovery durch die dunkle Einsamkeit in Richtung Jupiter, einer Totenbahre gleich auf ihrem Weg durch die Unterwelt; ein synästhetischer Rausch der Farben, Formen, Klänge und schließlich das Aufheben von Zeit in einer Ineinanderschachtelung ungleichzeitiger Ereignisse: Tod des Astronauten und dessen Auferstehung als neuer Mensch. Edgar Reitz spricht über Kubricks Eyes Wide Shut, gemeint könnte aber auch 2001 sein: „Kubricks Thema ist etwas Unsichtbares. Damit erweist er sich als wahrer Künstler, der begreift, daß die Filmkunst nie vom Sichtbaren erzählt, obwohl die Kamera doch so fanatisch nach der Welt der sinnlich faßbaren Reize greift […].“[12] Die Sinnlichkeit von 2001 baut meiner Meinung nach eine Atmosphäre von Einsamkeit auf, nicht nur die (immer wieder kritisierte) Maschinenästhetik, sondern auch das Gefühl von Verlorensein in einer geheimnisvollen, unvorstellbar mysteriösen und ergreifenden Schönheit, die uns im All mit seinen fremden Zivilisationen begegnet. Zivilisationen, die diesen Kosmos wie Werkzeug gebrauchen können, um andere, jüngere Lebensformen (nach ihrem Bilde?) auf höhere Stufen der Entwicklung zu heben. Ein Kosmos, den wir in diesem Film so phantastisch und irgendwie beinahe real sehen und spüren können, als lauschten wir einem modernen Homer, der von seinen dramatischen Reisen filmisch berichtet oder eine schier unglaublich schöne und geheimnisvoll schwere Geschichte darüber erfindet.
Zeiten und Räume: Wir sehen in unsere ferne afrikanische Vergangenheit. Millionen Jahre werden dann in einem Match Cut übersprungen. Scheinbar quälend langsame Reisen zum Mond und auf dem Mond selbst;[11] das Gleiten des Raumschiffs Discovery durch die dunkle Einsamkeit in Richtung Jupiter, einer Totenbahre gleich auf ihrem Weg durch die Unterwelt; ein synästhetischer Rausch der Farben, Formen, Klänge und schließlich das Aufheben von Zeit in einer Ineinanderschachtelung ungleichzeitiger Ereignisse: Tod des Astronauten und dessen Auferstehung als neuer Mensch. Edgar Reitz spricht über Kubricks Eyes Wide Shut, gemeint könnte aber auch 2001 sein: „Kubricks Thema ist etwas Unsichtbares. Damit erweist er sich als wahrer Künstler, der begreift, daß die Filmkunst nie vom Sichtbaren erzählt, obwohl die Kamera doch so fanatisch nach der Welt der sinnlich faßbaren Reize greift […].“[12] Die Sinnlichkeit von 2001 baut meiner Meinung nach eine Atmosphäre von Einsamkeit auf, nicht nur die (immer wieder kritisierte) Maschinenästhetik, sondern auch das Gefühl von Verlorensein in einer geheimnisvollen, unvorstellbar mysteriösen und ergreifenden Schönheit, die uns im All mit seinen fremden Zivilisationen begegnet. Zivilisationen, die diesen Kosmos wie Werkzeug gebrauchen können, um andere, jüngere Lebensformen (nach ihrem Bilde?) auf höhere Stufen der Entwicklung zu heben. Ein Kosmos, den wir in diesem Film so phantastisch und irgendwie beinahe real sehen und spüren können, als lauschten wir einem modernen Homer, der von seinen dramatischen Reisen filmisch berichtet oder eine schier unglaublich schöne und geheimnisvoll schwere Geschichte darüber erfindet.
III
Die Struktureinheiten von 2001 ließen sich auch so beschreiben: Monolith 1 (in der afrikanischen Savanne und Millionen Jahre später auf dem Mond, wo er entdeckt wird); die Besatzung der Discovery und HAL; Monolith 2, dem das überlebende Besatzungsmitglied David Bowman im Jupiter-System begegnet. Oder noch kürzer: Monolith A, HAL, Monolith B. Warum aber die Geschichte mit HAL? Die eher wie ein retardierendes Element wirkt? Vielleicht eines der modernen Ungeheuer, mit dem der Astronauten-Odysseus ringen muss? Scheint künstliche Intelligenz von der kosmischen Evolution ausgeschlossen? Eine Sackgasse? Die Urmenschen töten einander, HAL vernichtet die Besatzung; Dr. Floyd lügt (um das Geheimnis auf dem Mond vor den Russen zu verbergen – ein Reflex des Kalten Krieges); HAL lügt (um das Geheimnis seiner Mission zu verbergen). Die menschliche Besatzung versucht, HAL auszutricksen; HAL trickst die Besatzung aus. HAL ist mit seinem roten Auge – Gott sieht alles! – ein Überwachungsstaat im Miniuniversum der Discovery. Auch wenn wir ihn nur hören: HAL ist die Discovery. Wie konnte Kubrick ahnen, dass dies dank der medialen Auf- und Zurüstung in 2018 schon längst machbare, alltägliche, fürchterliche Realität geworden ist?[13] Es wurde schon oft bemerkt: „[…] that the first time we see astronaut David Bowman is as a reflection in HAL’s eye […]. It is almost as if the worlds of the film take place in HAL’s brain.”[14] Aber die Welten in Afrika, auf dem Mond, im Sternentor hat HAL nicht sehen können. Wir schauen durch eine (verschwundene) Kamera (nämlich die von Stanley Kubrick, der dahinter verschwindet), welche uns zur allwissenden Illusion verführt, wir könnten HAL sehen, wie er die Besatzung sieht. Der Schauspieler Jack Nicholson zitiert in einem Interview Kubricks Antwort auf die Frage, worum es bei Filmen gehe: „ … you try and photograph the photograph of the reality.“[15]
Letztlich wird HAL von Bowman – David gegen Goliath oder Odysseus, der Mann mit dem Bogen, gegen den einäugigen Zyklopen – ausgeschaltet werden. Ein Mensch gab es, ein Mensch nimmt es: das Bewusstsein von HAL. Interessant die Einschätzung von Michelangelo Antonioni: „»In 2001«, erklärte er 1969 […], »the best things in the film are the machines, which are more splendid than the idiotic humans.« […] Immerhin: ein >Idiot< trickst das künstliche >mastermind< aus.”[16] … so wie Odysseus alle kaum zu bewältigenden Gefahren bewältigt – mit Hilfe der zur Waffe umfunktionierten Vernunft.[17]
IV
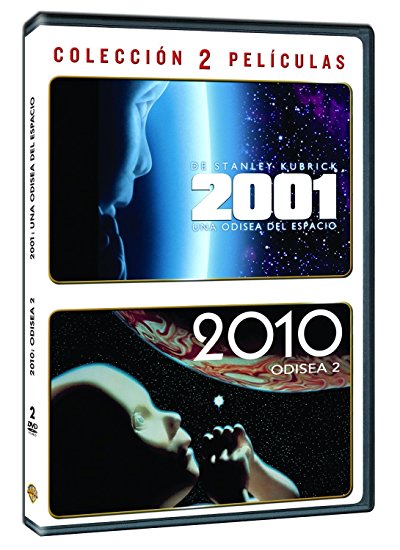 Erst die Menschen machen HAL zu einem Mörder, der sich, in Konfrontation mit seiner gottähnlichen Perfektion, in einen Strudel aus Lüge und Schuld verstrickt – und der, degradiert zu einem fehlbaren Geschöpf, von seinen fehlbaren Schöpfern bestraft wird. Die Anzahl der auftretenden Menschen in 2001 wird im Verlauf des Films immer geringer – oder fokussierter auf den einen (messianischen) Hoffnungsträger? 1968, als der Film erschien: ein Blick z.B. in das Register eines gleichnamigen GEO-Epoche zu diesem Jahr liest sich wie die Blaupause für einen apokalyptischen Horror-Roman. Wem wäre es zu verdenken, 2001 auch als Abschied von der Menschheit zu deuten? Die Artikel, hier in Auswahl, behandeln den Vietnamkrieg, die Ermordung von Robert Kennedy und Martin Luther King, dazu „Hunger als Waffe“, „Deutschlands dunkles Erbe“, Maos Kulturrevolution, den Prager Frühling …; und natürlich auch positiver: Studentenproteste, die Beatles oder „COMPUTER. Eine Maschine für die Zukunft.“[18] Und die Formen des menschlichen Zusammenlebens in 2001? Sich tötende Urhorden, Kalter Krieg, ein totalitäres System. Doch die Musik des Filmes – klassisch wie modern – zeugt von einer anderen Kulturleistung des Menschen! Ebenso die Anspielung des Titels auf den Big Bang der europäischen (Welt)Literatur: auf die Werke Homers (wobei hier sich schon die Ambivalenz in Richtung Krieg auftut). Aber Kunst und Literatur sind Metaebenen des Films, von denen die Akteure kaum berührt werden. Sprache selbst verkümmert zu Banalität und Bedeutungslosigkeit: „Rechnet man alle Dialogpassagen zusammen, so wird nur in rund einem Drittel der 149 Minuten Filmspieldauer gesprochen. Dabei ist der Dialog auf die Mitte des Films konzentriert: Der erste gesprochene menschliche Satz fällt erst 25 Minuten nach Filmbeginn. Der letzte Dialog erfolgt bereits eine halbe Stunde vor Ende des Films.“[19] Der scheinbaren, immer wieder kritisierten Fremdheit oder Unverstehbarkeit von 2001 begegnet R. Kolker mit einer historischen Kontextualisierung: es sei eine Zeit des filmischen Experimentierens gewesen (z.B. auch im italienischen Neorealismus). Aber wichtig, vielleicht sogar wichtiger war Kubricks zukunftsweisende Dekonstruktion von Science Fiction:
Erst die Menschen machen HAL zu einem Mörder, der sich, in Konfrontation mit seiner gottähnlichen Perfektion, in einen Strudel aus Lüge und Schuld verstrickt – und der, degradiert zu einem fehlbaren Geschöpf, von seinen fehlbaren Schöpfern bestraft wird. Die Anzahl der auftretenden Menschen in 2001 wird im Verlauf des Films immer geringer – oder fokussierter auf den einen (messianischen) Hoffnungsträger? 1968, als der Film erschien: ein Blick z.B. in das Register eines gleichnamigen GEO-Epoche zu diesem Jahr liest sich wie die Blaupause für einen apokalyptischen Horror-Roman. Wem wäre es zu verdenken, 2001 auch als Abschied von der Menschheit zu deuten? Die Artikel, hier in Auswahl, behandeln den Vietnamkrieg, die Ermordung von Robert Kennedy und Martin Luther King, dazu „Hunger als Waffe“, „Deutschlands dunkles Erbe“, Maos Kulturrevolution, den Prager Frühling …; und natürlich auch positiver: Studentenproteste, die Beatles oder „COMPUTER. Eine Maschine für die Zukunft.“[18] Und die Formen des menschlichen Zusammenlebens in 2001? Sich tötende Urhorden, Kalter Krieg, ein totalitäres System. Doch die Musik des Filmes – klassisch wie modern – zeugt von einer anderen Kulturleistung des Menschen! Ebenso die Anspielung des Titels auf den Big Bang der europäischen (Welt)Literatur: auf die Werke Homers (wobei hier sich schon die Ambivalenz in Richtung Krieg auftut). Aber Kunst und Literatur sind Metaebenen des Films, von denen die Akteure kaum berührt werden. Sprache selbst verkümmert zu Banalität und Bedeutungslosigkeit: „Rechnet man alle Dialogpassagen zusammen, so wird nur in rund einem Drittel der 149 Minuten Filmspieldauer gesprochen. Dabei ist der Dialog auf die Mitte des Films konzentriert: Der erste gesprochene menschliche Satz fällt erst 25 Minuten nach Filmbeginn. Der letzte Dialog erfolgt bereits eine halbe Stunde vor Ende des Films.“[19] Der scheinbaren, immer wieder kritisierten Fremdheit oder Unverstehbarkeit von 2001 begegnet R. Kolker mit einer historischen Kontextualisierung: es sei eine Zeit des filmischen Experimentierens gewesen (z.B. auch im italienischen Neorealismus). Aber wichtig, vielleicht sogar wichtiger war Kubricks zukunftsweisende Dekonstruktion von Science Fiction:
„Kubrick made a number of decisions that changed the genre for good. He strove for scientific accuracy, calling in NASA and computer scientists to advise him. The texture of his film – the sets, the models, the very movements of the people – were more detailed and more imaginatively constructed than the flying saucers and mutant aliens in aluminum foil and rubber costumes that figured in most 1950s science fiction. In place of the anticommunist hogwash of the previous decade […] he introduced a large measure of complexity, inquisitiveness, and ambiguity, which places his film closer to bet fiction literature than it is to science fiction cinema.”[20]
 Der technische Realismus steht nicht im Widerspruch zu einer fast expressionistischen, allegorisch-metaphorischen Reise durch das Sternentor. Die Fähigkeit, Werkzeuge zu gebrauchen, ist die Bedingung der Möglichkeit, die irdischen Begrenzungen des Menschseins zu überwinden. Dennoch besteht immer die Gefahr eines ambivalenten Umschlags von Technik in Destruktion. Der Nachfolgefilm 2010 (der, optisch zwar beeindruckend, aber nicht annähernd an Kubrick heranreicht) betont am Schluss: wir Menschen sind nur eine Lebensform von vielen, die vom Monolithen gefördert/beobachtet werden – hin und her geschoben auf einem kosmischen Schachbrett, ein Motiv, das in Kubricks Filmer immer wieder vorkommt. In den Folgeromanen von A. C. Clarke wird HAL eine besondere Bedeutung erhalten (… als Teil einer Trinität? Aber das wäre ein anderer Aufsatz …). Dennoch: Nachfolgefilm und –romane geben die Vieldeutigkeit von 2001 zugunsten einer eindeutigen Lesart auf – und verlieren so an Zauber und Geheimnis.
Der technische Realismus steht nicht im Widerspruch zu einer fast expressionistischen, allegorisch-metaphorischen Reise durch das Sternentor. Die Fähigkeit, Werkzeuge zu gebrauchen, ist die Bedingung der Möglichkeit, die irdischen Begrenzungen des Menschseins zu überwinden. Dennoch besteht immer die Gefahr eines ambivalenten Umschlags von Technik in Destruktion. Der Nachfolgefilm 2010 (der, optisch zwar beeindruckend, aber nicht annähernd an Kubrick heranreicht) betont am Schluss: wir Menschen sind nur eine Lebensform von vielen, die vom Monolithen gefördert/beobachtet werden – hin und her geschoben auf einem kosmischen Schachbrett, ein Motiv, das in Kubricks Filmer immer wieder vorkommt. In den Folgeromanen von A. C. Clarke wird HAL eine besondere Bedeutung erhalten (… als Teil einer Trinität? Aber das wäre ein anderer Aufsatz …). Dennoch: Nachfolgefilm und –romane geben die Vieldeutigkeit von 2001 zugunsten einer eindeutigen Lesart auf – und verlieren so an Zauber und Geheimnis.
V
Was für Konstellationen der Einsamkeit! Bowman, von der Discovery ausgesperrt, der einzige Überlebende, allein gegen den Supercomputer; diese Schachpartie sollte der Mensch gewinnen. Bowman, allein auf dem Olymp mit Jupiter und seinen Monden; allein im Sternentor, allein vor seinem prometheischen Neuschöpfer! Ach so, jene Langsamkeit, bewundert, unverstanden und gefürchtet, weil sie zum Einschlafen animiere, sie wird ausgiebig zelebriert, vor allem in den Reisen: von der Erde zur Raumstation, von dort zum Mond, dort mit einer Fähre zum Monolithen, mit der Discovery zum Jupiter. Und im Sternentor? Alles rast, fliegt, stürmt. Lichtorgien. Ekstase, die erschreckt und fasziniert. Geschwindigkeit (auch in den langsameren Sequenzen, weil sie Millionen von Jahren verdichten) scheint sich aufzuheben. Aber selbst als Raumschiffbauer kriecht Odysseus nur wie eine Schnecke durch die unvorstellbaren Dimensionen des Universums. Unter dieser Perspektive liegen Knochenwerkzeuge und Mondfähre technologisch ungefähr auf einer Ebene.
A Space Odyssey höhlt die homerischen Helden radikal aus. Es sind Typen, Statisten, kaum noch Individuen: Kain und Abel bringen sich am Wasserloch um – ein archetypisches Modell, von dem der Trojanische oder Kalte Krieg nur weitere Variationen darstellen. Bowman verliert wegen HAL seine Crew. Er schaltet ihr aus; er verlässt die Discovery, er tritt die Reise durch das Sternentor an; er steigt aus seiner Raumkapsel; er verändert sich zu einem immer älter werdenden, sterbenden Mann gemacht, wird schließlich ein Fötus. Diese Destruktion von menschlicher Gemeinschaft und ein radikales Entblößen von aller technischen Macht führen zur Konstruktion von etwas Neuem: David bleibt Mensch – und wird doch anders, namenlos im Neuanfang, ein Sternenkind. Für die endgültige Metamorphose steht der Monolith bereit: eine unbeschreiblich hohe Technologie, die sich aus unserer Ursumpf-Lurch-Perspektive der Göttlichkeit nähert? Womöglich.
Für mich sind und bleiben in diesem Film die Hauptcharaktere: der Monolith, die Raumschiffe, der Mond und HAL.
Epilog
2018
Meine Erfahrung mit Science Fiction im schulischen und universitären Unterricht – und ich bin meiner Universität sehr dankbar, dass ich einige Semester lang Seminare zu Science Fiction und Popkultur halten konnte – führt mich zu folgender Intuition bzw. These (die auch statistisch untersucht werden müsste). Jenes, auch institutionell verursachte, Verschwinden des Christentums korrespondiere mit einer Wiederkehr der Religionen, aber, so denke ich, in einer neuen Weise und anders als das, was üblicherweise darunter verstanden wird. Denn nicht mehr Familie oder Gemeinde, auch nicht mehr Schule sind heute meiner Meinung nach Orte erster religiöser Sozialisation, sondern die medial in Buch, Comic, Film, Serien etc. sich ausdifferenzierende Begegnung mit Science Fiction. Denn dieses Genre bedient sich wie kein anderes am mythologischen und archetypischen Reichtum der Weltreligionen, aber nicht nur aus kommerziellen Gründen oder weil das (bisweilen, aber nicht immer) phantastisch gute Geschichten sind, sondern auch wegen der Sprach- und Ideenlosigkeit archaischer Weltreligionen bzw. ihrer Institutionen in einer Welt der Quantenmechanik und Kosmologie, der Relativitätstheorie und Evolution, der KIs und atemberaubender Kunstwerke, wie es eben auch Filme sein können. (Bitte, das ist nur eine These!) Also: worum geht es eigentlich in der Science Fiction? Ach, nur um Gott und die Götter, das Universum und seine Bewohner, den Menschen und die Technik, kurz: um unsere Gegenwart.[21]

2001
Die Kunst im Film, das ist 2001 selbst, in der Einheit von Bild und Musik und auch Text. Wo nämlich menschliche Sprache versagen muss, eröffnen Bild und Musik Dimensionen immanenter Transzendenz der kosmischen Wunder: die Konstellationen von Sonne, Mond, Erde, Planeten, Raumschiffen und Monolith wirken in bestimmten Szenen geometrisch konstruiert, strukturiert. Und doch bleibt alles in Bewegung. So scheint in wenigen Momenten, wenn der natürliche Lauf der Dinge zugunsten eines intentionalen Arrangements unterbrochen wird, Sinn auf, der berührt, fasziniert, staunen lässt und sich gleich wieder rätselhaft entzieht. Hier sei nur eine kurze Szene angedeutet, die, einem Gemälde gleich, zutiefst beeindruckt und nicht mehr loslässt, zumindest mich. Von unten ragt der afrikanische Monolith schwarz ins Bild – wie eine Pyramide (aber ohne Spitze), an deren geraden, oberen Rand eben noch die Sonne scheint; und fast in einer Linie darüber eine nach unten gebogene, fein schimmernde Mondsichel; dazu dunkle Wolken in der Dämmerung. Was ist das? █
Markus Pohlmeyer lehrt an der Europa-Universität Flensburg
[1] Vgl. dazu auch: Markus Pohlmeyer: Mit Odysseus durch den Weltraum. Mythopoetik in der Science Fiction, in: M. Bauer – M. Jäger (Hg.): Mythopoetik in Film und Literatur, edition text + kritik, München 2011, 164-183.
[2] Vgl. dazu „Signiertes Plakat zur Wiederaufführung 1974“, in: Das Stanley Kubrick Archiv, hg. v. A. Castle, übers. v. T. J. Kinne, Köln 2016, 369.
[3] Vgl. dazu M. Benson: Space Odyssey. Stanley Kubrick, Arthur C. Clarke, and the making of a masterpiece, New York u.a. 2018, 1-8. (Auch mit Blick auf Ulysses!)
[4] B. Kiefer – M. Stiglegger: Genres, in: Handbuch Populäre Kultur. Begriffe, Theorien und Diskussionen, hg. v. H.-O. Hügel, Stuttgart – Weimar 2003, hier 190. Vgl. dazu auch beispielsweise die Referenz in Cixin Liu: Der dunkle Wald. Roman, übers. v. K. Betz, München 2018, 642.
[5] Kubrick, zitiert nach P. Duncan: Stanley Kubrick. Visueller Poet 1928-1999. Sämtliche Filme, übers. v. P. Klock, Köln 2008, 61.
[6] Vgl. dazu: F. Schlegel, in: Theorie der Romantik, hg. v. H. Uerlings, Stuttgart 2016, 79 f.
[7] E. Reitz in: T. Koebner – N. Koch (Hrsg.): »Edgar Reitz erzählt«, München 2008, 372.
[8] Vgl. dazu die Kosmogenese in Tree of Life (2011), die sich stärker an neuere Erkenntnisse aus Astrophysik und Paläontologie orientiert und in einen Theodizee-Hiob-Kontext eingebettet ist, so dass in einem gewissen Grade – bei aller Nähe – die Ambiguität von 2001 aufgegeben wird. Dennoch bleibt in beiden Fällen das erschütternde Gefühl von Marginalität zurück.
[9] In 2001 wird daraus der Monolith.
[10] A. C. Clarke: The Sentinel, in: The Collected Stories of Arthur C. Clarke, New York 2002, 301-308, hier 308.
[11] Zum Vergleich: Haben Sie schon einmal versucht, mit dem Zug von Flensburg nach Hamburg zu kommen?
[12] E. Reitz in: T. Koebner – N. Koch (Hrsg.): »Edgar Reitz erzählt«, München 2008, 356.
[13] Vgl. dazu auch T. Ramge: Mensch und Maschine. Wie Künstliche Intelligenz und Roboter unser Leben verändern, Stuttgart 2018.
[14] R. Kolker: Introduction, in: R. Kolker (Hrsg.): Stanley Kubrick’s 2001: A Space Odyssey. New Essays, Oxford University Press 2006, 3-12, hier 9.
[15] Zitiert nach: Stanley Kubrick. A Life in Pictures. Ein Film von J. Halan. DVD © 2001 Warner Bros.
[16] M. Bauer: Micheangelo Antonioni. Bild Projektion Wirklichkeit, München 2015, 360.
[17] Vgl. dazu G. A. Seeck: Homer. Eine Einführung, Stuttgart 2018.
[18] Vgl. dazu GEO-Epoche Nr. 88: 1968. Studentenrevolte, Hippies, Vietnam: Die Chronik eins dramatischen Jahres, 5.
[19] N. D. Peiler: 201 x 2001 Fragen und Antworten mit allem Wissenswerten zu Stanley Kubricks Odyssee im Weltraum, Marburg 2018, 83.
[20] R. Kolker: Introduction, in: R. Kolker (Hrsg.): Stanley Kubrick’s 2001: A Space Odyssey. New Essays, Oxford University Press 2006, 3-12, hier 7.
[21] Vgl. dazu L. A. Fiedler: Überquert die Grenze, schließt den Graben, in: Mammut März Texte 1&2, 1969-1984, hg. v. J. Schröder, 2. Aufl., Herbstein 1984, 673-697 (mit Angaben zur 1. Publikation) und Markus Pohlmeyer: Science Fiction. Filmisch-literarisches Exil des Göttlichen, Flensburger Studien zu Literatur und Theologie, Bd. 1, 2. Aufl., Hamburg 2014.
Die Veröffentlichungen von Markus Pohlmeyer bei CulturMag:
- Markus Pohlmeyer: „Prometheus“ – der neue Alien-Film von Ridley Scott. Ein Essay, in: http://culturmag.de/crimemag/markus-pohlmeyer-uber-%E2%80%9Epromotheus/55900, Zugriff: 21.08.2012
- Markus Pohlmeyer: Götterdämmerung: „The Wire“ und „Battlestar Galactica“. Ein Essay, in: http://culturmag.de/crimemag/markus-pohlmeyer-uber-zwei-seiner-serien-highlights/60480, Zugriff am 12.11.2012
- Markus Pohlmeyer: „Star Wars“: Exportschlager Demokratie – Gulliver im Outer Space, Ein Essay in: http://culturmag.de/crimemag/markus-pohlmeyer-uber-star-wars/67236 (Zugriff am 1.4.13), erschienen am 09.03.2013
- Markus Pohlmeyer: „Borgia“, in: http://culturmag.de/crimemag/essay-markus-pohlmeyer-ueber-borgia/77244, Zugriff am 24.11.2013
- Markus Pohlmeyer: „Die Neffen sind los.“ Phantomias erschreckt Nosferatu: neue Beispiele aus Walt Disneys Fiktionenmaschine, in: http://culturmag.de/rubriken/buecher/markus-pohlmeyer-walt-disneys-fiktionenmaschine/81947, 3.8.2014
- Markus Pohlmeyer: Lucky Luke oder eine kleine Aufklärungslektüre in der Kunst des modernen Verbrechens, in: http://culturmag.de/rubriken/buecher/markus-pohlmeyer-ueber-lucky-luke/82988, Zugriff am 21.9.2014
- Markus Pohlmeyer: Markus Pohlmeyer: True Detective: mit Kierkegaard vorwärts-zurück in die Hölle? GesellschaftsBILDER. Ein Essay, in: http://culturmag.de/crimemag/essay-markus-pohlmeyer-ueber-true-detective/83489, Zugriff am 13.10.2014
- Markus Pohlmeyer: Der Große Stechlin – Fontanes Reise in die Unterwelt. Ein Essay, in: http://culturmag.de/rubriken/buecher/theodor-fontane-der-stechlin-ein-essay/83910, Zugriff am 4.11.2014
- Markus Pohlmeyer: Dinos, Star Wars und die Berliner Mauer, in: http://culturmag.de/rubriken/buecher/essay-markus-pohlmeyer-zum-micky-maus-spezial-25-jahre-mauerfall/84484, Zugriff am 28.11.2014
- Markus Pohlmeyer: Apokalypsen der Moderne am Ende der Welt oder: „Neues aus Büttenwarder“ – Lokale Beispiele mit globalem Modellcharakter. Essay und Satire, in: http://culturmag.de/litmag/essay-markus-pohlmeyer-ueber-neues-aus-buettenwarder/85089, Zugriff am 19.12.2014
- Markus Pohlmeyer: ”Der missversteht die Himmlischen …“ – Essay: Gedanken zur Theodizee, in: http://culturmag.de/crimemag/essay-gedanken-zur-theodizee-von-markus-pohlmeyer/86629, Zugriff am 24.3.2015
- Markus Pohlmeyer: Gedanken über Europa und Religion – Skizzen, in: http://culturmag.de/crimemag/essay-markus-pohlmeyer-ueber-europa-und-religion/87183, Zugriff am 19.4.2015
- Markus Pohlmeyer: Science Fiction: poetologische Versuche, in: http://culturmag.de/crimemag/eassay-markus-pohlmeyer-zum-status-von-science-fiction/87386, Zugriff am 26.4.2015
- Markus Pohlmeyer: Die Maschinen – endlich ge(g)Ændert! – und Goethes Iphigenia, in: http://culturmag.de/crimemag/essay-markus-pohlmeyer-die-maschinen-endlich-gegndert-und-goethes-iphigenia-ann-leckie/87713, Zugriff am 17.5.2015
- Markus Pohlmeyer: Zuhören können – oder Franz von Assisi in „Büttenwarder“. Ein Essay, in: http://culturmag.de/litmag/markus-pohlmeyer-zuhoeren-koennen-oder-franz-von-assisi-in-buettenwarder-ein-essay/87766, Zugriff am 21.5.2015
- Markus Pohlmeyer: „Asterix – Der Papyrus des Cäsar“: (M)Ein Kommentar, in: http://culturmag.de/litmag/essay-markus-pohlmeyer-ueber-den-neuen-asterix/90252, Zugriff am 8.11.2015
- Markus Pohlmeyer: Woody Allens „Midnight in Paris” – Film. Fiktion. Philosophie, in: http://culturmag.de/litmag/essay-markus-pohlmeyer-ueber-woody-allens-midnight-in-paris/90667, Zugriff am 7.12.2015
- Markus Pohlmeyer: Die Reise des Helden und Donald Duck, in: http://culturmag.de/litmag/essay-markus-pohlmeyer-ueber-star-wars-donald-duck-und-die-heldenreise/91993, Zugriff am 6.3.2016
- Markus Pohlmeyer: Aliens: „Erlösung“ – ein Essay, in: http://culturmag.de/crimemag/essay-aliens-erloesung/92237, Zugriff am 30.3.2016
- Markus Pohlmeyer: Kein Außerhalb von Geschichten. Ein Essay zur Hermeneutik von Wilhelm Schapp, in: http://culturmag.de/litmag/essay-markus-pohlmeyer-ueber-wilhelm-schapp/92417, Zugriff am 5.4.2016
- Markus Pohlmeyer: Kunst, eine deutsche Tragödie. Gedanken zu Edgar Reitzʾ Meisternarrativ „Heimat“, , in: http://culturmag.de/litmag/essay-markus-pohlmeyer-ueber-edgar-reitz%CA%BEheimat/93073, Zugriff am 8.5.2016
- Markus Pohlmeyer: Person of Interest – oder Von der Geburt einer Göttin, digital. Ein Essay, in: http://culturmag.de/crimemag/essayfilm-markus-pohlmeyer-person-of-interest-oder-von-der-geburt-einer-goettin-digital/93217, Zugriff am 17.5.2016
- Markus Pohlmeyer: Spinosaurus – ein Samurai-Western aus der Urzeit! Ein Essay, in: http://culturmag.de/allgemein/essay-markus-pohlmeyer-spinosaurus-ein-samurai-western-aus-der-urzeit/93657, Zugriff am 8.6.2016
- Markus Pohlmeyer: Theopoiesis. Wie Echnaton und Thomas Mann Gott (er)fanden, in: http://culturmag.de/crimemag/essay-markus-pohlmeyer-theopoesis-wie-echnaton-und-thomas-mann-gott-erfanden/93914, Zugriff am 19.6.2016
- Markus Pohlmeyer: Theodor Fontane, die „Gräber der Humboldts“ und die Säkularisierung, in: http://culturmag.de/litmag/essay-ueber-theodor-fontane-die-graeber-der-humboldts-und-die-saekularisierung/95724, Zugriff am 4.10.2016
- Markus Pohlmeyer: „Die Töchter der Sonne“ – Vom Zauber der Uraufführung und ein wenig Poetologie, in: http://culturmag.de/litmag/veranstaltungskritik-die-toechter-der-sonne/95700, Zugriff am 4.10.2016.
- Markus Pohlmeyer: Borgia oder wie ein Papst und seine Familie für Machiavelli Modell standen, in: http://culturmag.de/crimemag/essay-markus-pohlmeyer-borgia-und-machiavelli/95664, Zugriff am 17.10.2016
- Markus Pohlmeyer: Weihnachten: antik und globalisiert, in: http://culturmag.de/litmag/essay-markus-pohlmeyer-ueber-den-ursprung-von-weihnachten/97161, Zugriff am 6.12.2016
- Markus Pohlmeyer: Kierkegaard: Naturalismus oder Gott in Manh(a)attan, in: http://culturmag.de/crimemag/essay-markus-pohlmeyer-kierkegaard-und-die-atombombe/97288, Zugriff am 15.12.16
- Rezension – Markus Pohlmeyer: A. Budrys Projekt Lunaa., in: http://culturmag.de/rubriken/jahreshighlights/culturmag-jahreshighlights-2016-teil-6-0-r/97575, Zugriff am 24.12.16
- Markus Pohlmeyer: Star Wars. Rogue One. Kritische Gedanken zu einer neuen Weltreligion. Ein Essay, in: http://culturmag.de/crimemag/essay-markus-pohlmeyer-star-wars-rogue-one-2016/98321, Zugriff am 15.1.17
- Markus Pohlmeyer: Person of Interest – Die letzte Staffel: Vom Tod einer Göttin. Ein Essay, in: http://culturmag.de/crimemag/tv-serie-person-of-interest-die-letzte-staffel/99737, 15.3.17
- Die Neue Welt oder Lucky Luke: Das gelobte Land. Ein Essay http://culturmag.de/crimemag/essay-markus-pohlmeyer-die-neue-welt-oder-lucky-luke-das-gelobte-land/100718, Zugriff am 17.4.17
- Got (Game of Thrones). Minimale Meditationen. Ein Essay, in: http://culturmag.de/crimemag/essay-markus-pohlmeyer-game-of-thrones-minimale-meditationen/101167, Zugriff am 15.5.17
- Markus Pohlmeyer: Reisen mit Seneca: 5 Thesen auf dem Weg mit und zu sich selbst, in: http://culturmag.de/litmag/reise-special-2017-reise-klassiker-miniaturen/101513, Zugriff am 6.6.17
- Markus Pohlmeyer: Alien: Covenant – Schwanengesang. Ein Essay http://culturmag.de/crimemag/essay-markus-pohlmeyer-alien-covenant-schwanengesang/101808, Zugriff am 16.6.17
- Markus Pohlmeyer: Auf dem Weg zum Essay. Ein Essay. http://culturmag.de/litmag/essay-markus-pohlmeyer-auf-dem-weg-zum-essay/102135, Zugriff am 5.7.17
- Markus Pohlmeyer: Arrival. Ein kurzer hermeneutischer Kommentar: http://culturmag.de/crimemag/essay-markus-pohlmeyers-kommentar-zu-arrival/102405, Zugriff am 15.08.17
- Markus Pohlmeyer: Verzaubert und entzaubert: die nah-ferne Welt der Mickey Maus,http://culturmag.de/crimemag/essay-markus-pohlmeyer-verzaubert-und-entzaubert-die-nah-ferne-welt-der-mickey-maus/102977; Zugriff am 19.09.17
- Die Huld(a) auf dem Felde oder: Ein arroganter Engel, ein irrender Held und ein impliziter Esel. Gedanken – weitab vom Wege – zu Thomas Manns Joseph und seine Brüder,http://culturmag.de/litmag/thomas-mann-joseph-und-seine-brueder/104603, Zugriff am 7.12.17, zuerst erschienen in: M. Pohlmeyer: Zwischen Welten verstrickt IV. Weltraum, Wildwest und allerlei wunderliche Wege, Hamburg 2017, 81-90.
- Markus Pohlmeyer: Reise ins Multiversum – Reisen im Multiversum. Gedanken zu Blake Crouch: Dark Matter. Der Zeitenläufer, in: http://culturmag.de/crimemag/essay-markus-pohlmeyer-reise-ins-multiversum-reisen-im-multiversum/105185, Zugriff am 17.12.18.
- Markus Pohlmeyer: Paläoart: Wie Künstler durch die Zeiten sahen (Rezension zu: Z. Lescaze: Paläo-Art, 2017): http://culturmag.de/rubriken/buecher/buch-zoe-lescaze-palaeo-art/105296, Zugriff am 17.12.18.
- Markus Pohlmeyer: Weihnachten kommt aus Indien – Interdependenzen. Ein Versuch, in: http://culturmag.de/crimemag/essay-markus-pohlmeyer-weihnachten-kommt-aus-indien-interdependenzen-ein-versuch/105236, Zugriff am 17.12.18 (zuerst in: Markus Pohlmeyer: Weihnachten kommt aus Indien – Interdependenzen. Ein Versuch, in: M. Pohlmeyer – B. Schmelz (Hrsg.): Weihnanchten. Von der globalisierten Postmoderne in die Antike – (un)gewohnte Zugänge, Flensburger Studien zu Literatur und Theologie, Bd. 11, Hamburg 2017, 115-131.)
- Markus Pohlmeyer: Nachdenken über Stephen Hawking und andere kosmische Träume(r). Ein Essay, in: http://culturmag.de/crimemag/essay-markus-pohlmeyer-ueber-stephen-hawking/108662, Zugriff am 14.4.2018.
- Markus Pohlmeyer: Lucky Luke: Lucky Kid – oder Aus der Kindheit eine Helden. Ein Essay , in: http://culturmag.de/crimemag/essay-markus-pohlmeyer-lucky-luke/108706, Zugriff am 14.4.2018.
- Markus Pohlmeyer: Blade Runner 2049. Liebe und Einsamkeit, transhuman und nach der Apokalypse. Ein Essay, in: http://culturmag.de/crimemag/essay-markus-pohlmeyer-zu-blade-runner-2049/108648, Zugriff am 14.4.2018.
- Markus Pohlmeyer: Kleine Hymne auf: Robert Silverberg (Hg.): Science Fiction Hall of Fame 2. Die besten Storys 1948-1963, Golkonda Verlag, München – Berlin 2018 http://culturmag.de/crimemag/markus-pohlmeyer-ueber-science-fiction-religion/109091, Zugriff am 16.5.18
- Markus Pohlmeyer: Notizen aus dem Paläo-Museum, in: http://culturmag.de/crimemag/notizen-aus-dem-palaeo-museum/109742, Zugriff am 15.6.18
- Markus Pohlmeyer: Mit Kierkegaard im Serienland. Gedanken zur zweiten Staffel von Fargo. Ein Essay, in:http://culturmag.de/crimemag/serie-fargo-2/109805, Zugriff am 15.6.18
- Markus Pohlmeyer: Stanley Kubricks „2001“ – Homer im Weltraum. Ein Essay, in:http://culturmag.de/crimemag/markus-pohlmeyer-ueber-stanley-kubricks-2001-homer-im-weltraum/109870, Zugriff am 15.6.18











