Ein bißchen Debatte
 Literaturbetrieb
Literaturbetrieb
„Man brauche sich nur eine Hornbrille aufsetzen und ein bisschen schlau über Roland Barthes schwadronieren, schon sei man drin. Ob Kesslers Diagnose eines zu homogenen Literaturbetriebs stimmt, wird seither rege diskutiert – allerdings auch überwiegend verneint. Neben der "Welt", der "Süddeutschen Zeitung" und der "taz" meldeten sich auch Blogger und Literaten zu Wort und fragten, ob soziales Milieu und mangelnde Relevanz überhaupt so wie von Kessler behauptet korrelieren. In ihrem Debattenbeitrag weist Olga Grjasnowa darauf hin, dass man gerade den Literaturinstituten keinen Sozialmilieu-Vorwurf machen könne: Kaum ein Studium habe so egalitäre Zugangsvoraussetzungen wie das zum Kreativen Schreiben oder Diplomschriftsteller. Wer politisch relevante Gegenwartsliteratur suche, könne sie sehr wohl finden.“ Schrieb gestern die WELT.
Es geht hier aber nicht wirklich um Zugangsvoraussetzungen, sondern um Setzungen, Sphärengrammatiken und genretypische Individualdesigns – es geht um Bravheit als Eintrittskarte. Man kann auf Kessler auf verschieden Art antworten, vieles macht Sinn, auch wie es jetzt Olga Grjasnowa tut:
„ … es sind auch tatsächlich Klassenfragen, die hier verhandelt werden sollten: Die sogenannten bildungsfernen Schichten werden mit RTL2 und ProSieben abgespeist, nur die wenigsten können sich Bücher für einen durchschnittlichen Preis von zwanzig Euro leisten, Arbeiterkinder findet man selten an deutschen Universitäten und Kinder mit ungeklärtem Aufenthaltsstatus dürfen oft noch nicht einmal eine Schule besuchen.
… Es geht noch immer um Herkunft, aber auch um politische Teilhabe und kulturelle Hegemonie. Doch Kessler verwechselt eine politische mit einer literarischen Diskussion. Problematisch ist nicht die bildungsbürgerliche Herkunft der Autoren, problematisch ist, dass in unserer Gesellschaft nur bestimmte Personen Zugang zur Bildung und zum symbolischen Kapital bekommen.
Es sind politische Fragen, keine ästhetischen – und schon gar keine, die an einer Autorenbiografie festgemacht werden können.“
Nicht an der speziellen Person, das ist unstrittig, aber an dem, was zum Personalen gehört, an der Brauchbarkeit des Designs und der Performance. Der Betrieb sucht sich auch aus, wer in ihm wirken darf.
„… die Stromlinienförmigkeit der jungen deutschen Gegenwartsliteratur liegt nicht allein in der Erfolgsorientiertheit ihrer Verfasserinnen und Verfasser begründet. Sie ist Ergebnis ihres schichtenspezifischen Horizonts. Das gilt für den literarischen Betrieb insgesamt: Literatur wird in Deutschland von Menschen produziert, vermarktet und rezipiert, die aus gut situierten Verhältnissen stammen. Die Funktions- und Entscheidungsträger des literarischen Feldes, Autoren, Lektoren, Feuilletonisten, Angehörige von Preisjurys, Leiter von Literaturhäusern, sie bewegen sich alle in ein und demselben hermetisch abgeschlossenen gesellschaftlichen Teilsystem. Über Habitus, familiäre Kontakte und eigenes Netzwerken ist es ihnen gelungen, direkt nach dem Studium, ohne nennenswerte Lebenserfahrungen außerhalb ihres eigenen Sozialverbunds, ihr Pöstchen im Betrieb zu ergattern.“ Enno Stahl in der taz.
Ich würde das Attribut „gut situierte Verhältnisse“ weglassen. Es gibt dennoch eine Reihe anderer Attribute, mit denen man sich schmücken und im Literaturbetrieb unterkommen kann: das sind zum Beispiel Studienjahre in Hildesheim oder Leipzig, das sind Stipendien, Preise, Aufenthalte – regelrechte „Auszeichnungskarrieren“, die man als schmucke Shawl sich umwirft und die bei Türstehern für Wirkung sorgen . Es gibt das Designbegehren zu kleidsamen Biobis zu kommen. Der Betrieb will (wie bei alten Quartettspielen) wissen, wieviel PS und Hubraum der Wagen hat und nicht, ob er sich gut fahren lässt. Ein Literaturstudium ist so etwas wie das Grundoutfit, in dem man auf der Party zumindest nicht doof aussieht. Der Hemdsärmelige passt da nicht, er riecht nach Schweiß, Schmutz, Öl, Schmiere. Er riecht nach Betroffenheit und Erde. Das falsche Parfum. Er kommt schon mal nicht rein. Enno Stahl hat unbedingt Recht den Blick auszuweiten auf den Betrieb. Es ist schon auch durch ihn bedingt, wer im Laden tanzen darf und wer nicht.
„ Was ich mich frage: Warum kommen in Kesslers Text die beiden Begriffe "Handwerk" und "Talent" nicht vor? Wer hat Talent? Die "Professorenkinder", die "Bundestagsdirektoren-Tochter", der "Richter-" oder "Managersohn" oder "die mit Häkchen über den Nachnamen"?“ Olga Grjasnowa. Gute Frage - ist wirklich nur das passgenau designte Klientel talentiert? Oder gibt es Siebeinstellungen, die uns glauben machen, nur dieses Klientel hätten ausreichend Talent und Handwerk, einfach, weil sie am Ende rauskommen und eine Kesslersche Diagnostik überhaupt erst möglich machen.
Ist eines der Siebe vielleicht auch Hilflosigkeit? Der Ruf nach Ausweispapieren, um das notwendige Urteil zu erleichtern?
Ist unser Literaturbetrieb ein Betrieb, der (womöglich nur in Teilbereichen, aber immerhin) Klischees und Marken nutzt, um zu funktionieren? Ich meine: ja.
Und Akteure, die clever genug sind nicht mehr nur auf ihr Talent zu vertrauen, liefern.


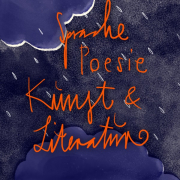

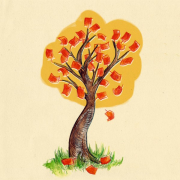




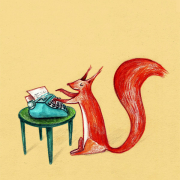
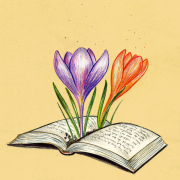

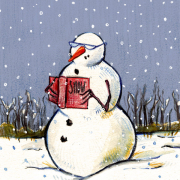
Neuen Kommentar schreiben