Les Gueules Cassées

Gestern eröffnete eine neue Ausstellung in der Kunsthalle Mainz.
Zur offiziellen Vertragsunterzeichnung im Schloss Versailles am 28. Juni 1919 nehmen fünf französische Kriegsveteranen im Spiegelsaal Aufstellung. Ihre Gesichter sind von Granatsplittern zerfurcht und entstellt. Die Versehrten stehen hier als am Leben gehaltene Kriegsdenkmäler, die sich in den barocken Spiegeln erbarmungslos vervielfältigen. Der Anblick der Männer bringt Ministerpräsident Clemenceau zum Weinen. Auch die deutschen Delegierten müssen an diesem „Mahnmal“ vorbeidefilieren. Keiner von ihnen wird je ein Wort über diese Inszenierung der Kriegsgräuel verlieren.
„Les Gueules Cassées“ wurden sie im Ersten Weltkrieg genannt: Die „zerfetzten Gesichter“ (eigentlich „zerschlagenen Fressen“) sind fortan fester Bestandteil der Ikonografie des „Großen Kriegs“. Die Kunsthalle Mainz nimmt das Jahr 1914 zum Anlass, „Les Gueules Cassées“ in einer Ausstellung zu vergegenwärtigen. Sie zeigt Verwundung, Schmerz und Verlust aus dem Blickwinkel zeitgenössischer Kunst. Illustriert wird weder die politische noch die militärische Geschichte des Ersten Weltkriegs. Vielmehr versammelt diese Ausstellung herausragende Positionen der Gegenwartskunst, die die Narben des Kriegs offenlegen: Angst, Trauma und prekäre Erinnerung.
Der Anblick von Gesichtsverletzungen erzeugt Schauer und Scham. Wenn mehrmals täglich US-amerikanische Black- Hawk-Helikopter das Gebäude der Kunsthalle Mainz überfliegen, wird der lokale Bezug offenkundig. Die Hubschrauber sind auf dem knapp zehn Kilometer entfernten Flughafen Wiesbaden-Erbenheim stationiert, dem Hauptquartier der US-Streitkräfte in Europa. Die Schwerverwundeten aus den Kriegen im Irak und in Afghanistan werden in den hiesigen Militärkrankenhäusern medizinisch versorgt. Die „Gueules Cassées“ der Gegenwart sind in unmittelbarer Nähe, jedoch anders als die Versehrten des Ersten Weltkriegs der Öffentlichkeit entzogen und aus Propagandagründen nicht sichtbar.
Doris Salcedo wird mit ihrer Installation in der Tate Modern in London bekannt. In der Turbinenhalle des Museums bricht ein Riss auf und wird seiner ganzen Länge von 160 m immer breiter. Es geht um Ausgrenzung und Segregation, aber auch um Linien in der Architektur und die Narben an Bauten und Existenz. Otto Dix’ verschollenes Bild „Die Kriegskrüppel“ ist die Vorlage für einen kurzen Film der israelischen Künstlerin Yael Bartana. Die Invaliden, die Dix in pazifistischer Absicht überzeichnete, werden animiert. „Entartete Kunst lebt“ heißt das eindrückliche Werk. Markus Schinwald manipuliert historische Stiche und Lithografien. Personen, ursprünglich bürgerliche Porträts, erscheinen mit körperlichen Gebrechen, Ban-dagen, Prothesen und sperrigen medizinischen Hilfen. Die britische Künstlerin Tacita Dean beschäftigt sich in ihrer Serie von Fotogravuren mit der düsteren Ästhetik der Katastrophendarstellung. Sie bezieht sich auf die Praxis der Stummfilmzeit, zwei Schlussvarianten zu drehen, ein Happy End für das amerikanische, ein melancholisches Ende für das russische Publikum. Peter Piller arbeitet ebenfalls mit Archivmaterial. Er reproduziert historische Postkarten von Blindgängern im Ersten Weltkrieg und kombiniert Fotos von Schlachtfeldern mit Meereswogen. William Kentridge erzählt in „Zeno Writing“ die Geschichte einer literarischen Figur von Italo Svevo in animierten Bildern vor dem Hintergrund der Wirren 1914. Wade Guyton zeigt ein abstraktes Bild in monochromem Schwarz. Zwischen zwei monumentalen Flächen bleibt eine vieldeutige Fuge, eine Narbe im Gestaltlosen. Agnès Geoffray beschäftigt sich mit Gesten und traumhaften Erscheinungen. Die historischen „Gueules Cassées“ sind Bestandteil ihrer unbehaglichen Kunst. Anne Schneider benutzt gebrauchte Jutesäcke als Wandteile, Bodenbeläge und skulpturale Versatzstücke. Originale Moulagen und Gipsabgüsse des Frontarztes Julian Zilz, bedeutender Kieferchirurg an der Ostfront um 1914, führen die anatomische Realität der Gesichtsverletzungen vor Augen.Karlheinz Stockhausen komponierte ein Stück für ein Streichquartett und vier Helikopter. Das bedrohliche Surren der Rotorblätter wird mit einem Kreischen überspannter Saiten vermengt. Ein Video zeigt die erste Aufführung im Jahr 1991. Der Mainzer Künstler Thomas Hombach zeigt wiederverwertete Gegenstände aus der Zeit des Ersten und des Zweiten Weltkriegs. Patronen, Gasmasken und anderes Gerät wurden in Alltagsgegenständen umgearbeitet.


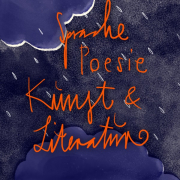

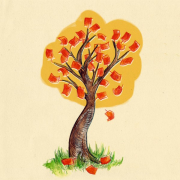




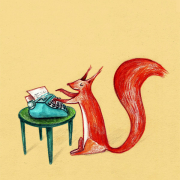
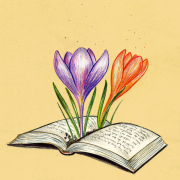

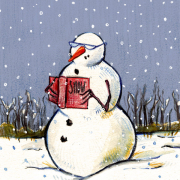
Neuen Kommentar schreiben