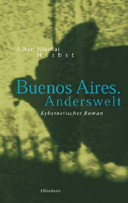Banalität des Bösen. Jonathan Littell. Die Wohlgesinnten. Lesenotate (3).
 Man kann gar nicht grundlegender irren als etwa Georg Klein in seinem klug austarierten, alle moralischen Risiken meidenden >>>> Artikel in der Süddeutschen tat, der bei diesem Roman eine „Sprache des Bösen“ vermißt und doch zugleich sieht, daß es sie nicht geben kann. Die Wahrheit ist ja eben, daß ein substantielles Böses A u s r e d e ist. Es gibt nur sein >>>> Banales. Oder, um es mit einem literaturkritischen Begriff zu belegen: das Triviale. Deshalb ist hier ein literarischer Realismus ausgesprochen angemessen, zumal dann, wenn er auf höchstkünstlerische, nämlich derart collagierte Weise hergestellt wird. Littells Buch behauptet jede metaphysische Komponente des Bösen hinweg, d a s ist sein Skandal. Die Art, in der bei einer Massenerschießung, deren Entgleisung in eine Schlamm- und Blutschlacht Aue „dilettantisch“ nennt (S. 126), von der Erzählung der Greuel selbst zu dem den Erzähler sehr viel mehr bewegenden Umstand geschaut wird, daß er sich Splitterchen unterm Fingernagel zugezogen hat, die ihn pieksig quälen, ist ein ausgesprochen genaues Psychogramm des sogenannten Bösen, das eben letztlich nichts anderes als ein Sichfortbewegen allgemeinmenschlicher Befindlichkeit auf den Schienen der Vernichtungsindustrie ist, die man „eben mitmacht“, und zwar durchaus im Bewußtsein, es handle sich hier um ein Unrecht. „Bei Tisch, am Abend, diskutierten die Männer über die Aktionen, erzählten sich Anekdoten, verglichen ihre Erfahrungen, einige bedrückt, andere fröhlich.“ Bekanntlich ist Lachen eine Form der Reaktionsbildung auf nicht oder nur kaum Verarbeitbares. „Wieder andere schwiegen, auf sie“, weil ihnen keine Form der Abwehr zur Verfügung steht, „galt es zu achten. Es hatte bereits zwei Selbstmorde gegeben (...)“ (S.126). Hier ist es erst noch der ukrainische Mob, der, von der deutschen Propaganda dazu „verführt“, das Massenschlachten betreibt. „Die meisten von ihnen hatten gegen die Polen gekämpft, dann gegen die Sowjets, sicherlich hatten sie von einer besseren Zukunft geträumt, für sich und für ihre Kinder, und jetzt fanden sie sich in einem Wald wieder, in einer fremden Uniform, und damit beschäftigt, Menschen umzubringen, die ihnen nichts getan hatten, ohne einen Grund, den sie hätten verstehen können. Wie mochten sie darüber denken?“ Aue selbst denkt darüber ablehnend, macht aber, wie die anderen, mit. „(...) wenn man es ihnen befahl, drückten sie ab, stießen die Leichen in die Grube, führten die nächsten herbei und protestierten nicht. Wie würden sie später über all das denken? Wieder hatten sie geschossen. Jetzt wurden Schmerzensschreie aus der Grube vernehmbar. 'Verdammte Scheiße, da leben noch welche', knurrte der Hauptscharführer“ (S. 124). Nein, es g i b t sie nicht, die Sprache des Bösen, weil ein metaphysisches Böses eben nicht wirkt. Statt dessen wirken dieselben Strukturen, die Kassiererinnen bei ALDI Weisungen von Vorgesetzten unwidersprochen ausführen lassen, auch wenn sie widersinnig sind, und die uns auch selber, uns Intellektuelle, korrupt werden lassen. Es wirkt darüber hinaus eine Angst, und es wirkt die Struktur des Militärs-an-sich, das sowieso auf Widerspruchslosigkeit zurichtet. Es wirkt zudem eine Gruppendynamik, die man auf jedem Woodstock beobachten kann, nur daß die Richtung sich umdreht: make war, not love. Im Prinzip ist es dasselbe. Dabei führt der Widerspruch einer inneren Moral zu der der äußeren Befehle zu vorgetriebenem Sadismus: um das Schrecklichste tun zu können, muß es eine Lust bereiten, in der sich das ÜberIch auflösen kann. Die Rezensenten, die aus anderen als ideologischen, bzw. gläubigen, die also aus politischen Gründen gegen Littells Roman geschrieben haben und die man deshalb, weil sie eben intentional sind, für keine Erkenntnisfindung heranziehen kann, sehnen ein Geheimnis des Bösen herbei. Mit diesem deutschen geheimsten inneren Wunsch räumt Littell auf. This is not a Gothic novel.
Man kann gar nicht grundlegender irren als etwa Georg Klein in seinem klug austarierten, alle moralischen Risiken meidenden >>>> Artikel in der Süddeutschen tat, der bei diesem Roman eine „Sprache des Bösen“ vermißt und doch zugleich sieht, daß es sie nicht geben kann. Die Wahrheit ist ja eben, daß ein substantielles Böses A u s r e d e ist. Es gibt nur sein >>>> Banales. Oder, um es mit einem literaturkritischen Begriff zu belegen: das Triviale. Deshalb ist hier ein literarischer Realismus ausgesprochen angemessen, zumal dann, wenn er auf höchstkünstlerische, nämlich derart collagierte Weise hergestellt wird. Littells Buch behauptet jede metaphysische Komponente des Bösen hinweg, d a s ist sein Skandal. Die Art, in der bei einer Massenerschießung, deren Entgleisung in eine Schlamm- und Blutschlacht Aue „dilettantisch“ nennt (S. 126), von der Erzählung der Greuel selbst zu dem den Erzähler sehr viel mehr bewegenden Umstand geschaut wird, daß er sich Splitterchen unterm Fingernagel zugezogen hat, die ihn pieksig quälen, ist ein ausgesprochen genaues Psychogramm des sogenannten Bösen, das eben letztlich nichts anderes als ein Sichfortbewegen allgemeinmenschlicher Befindlichkeit auf den Schienen der Vernichtungsindustrie ist, die man „eben mitmacht“, und zwar durchaus im Bewußtsein, es handle sich hier um ein Unrecht. „Bei Tisch, am Abend, diskutierten die Männer über die Aktionen, erzählten sich Anekdoten, verglichen ihre Erfahrungen, einige bedrückt, andere fröhlich.“ Bekanntlich ist Lachen eine Form der Reaktionsbildung auf nicht oder nur kaum Verarbeitbares. „Wieder andere schwiegen, auf sie“, weil ihnen keine Form der Abwehr zur Verfügung steht, „galt es zu achten. Es hatte bereits zwei Selbstmorde gegeben (...)“ (S.126). Hier ist es erst noch der ukrainische Mob, der, von der deutschen Propaganda dazu „verführt“, das Massenschlachten betreibt. „Die meisten von ihnen hatten gegen die Polen gekämpft, dann gegen die Sowjets, sicherlich hatten sie von einer besseren Zukunft geträumt, für sich und für ihre Kinder, und jetzt fanden sie sich in einem Wald wieder, in einer fremden Uniform, und damit beschäftigt, Menschen umzubringen, die ihnen nichts getan hatten, ohne einen Grund, den sie hätten verstehen können. Wie mochten sie darüber denken?“ Aue selbst denkt darüber ablehnend, macht aber, wie die anderen, mit. „(...) wenn man es ihnen befahl, drückten sie ab, stießen die Leichen in die Grube, führten die nächsten herbei und protestierten nicht. Wie würden sie später über all das denken? Wieder hatten sie geschossen. Jetzt wurden Schmerzensschreie aus der Grube vernehmbar. 'Verdammte Scheiße, da leben noch welche', knurrte der Hauptscharführer“ (S. 124). Nein, es g i b t sie nicht, die Sprache des Bösen, weil ein metaphysisches Böses eben nicht wirkt. Statt dessen wirken dieselben Strukturen, die Kassiererinnen bei ALDI Weisungen von Vorgesetzten unwidersprochen ausführen lassen, auch wenn sie widersinnig sind, und die uns auch selber, uns Intellektuelle, korrupt werden lassen. Es wirkt darüber hinaus eine Angst, und es wirkt die Struktur des Militärs-an-sich, das sowieso auf Widerspruchslosigkeit zurichtet. Es wirkt zudem eine Gruppendynamik, die man auf jedem Woodstock beobachten kann, nur daß die Richtung sich umdreht: make war, not love. Im Prinzip ist es dasselbe. Dabei führt der Widerspruch einer inneren Moral zu der der äußeren Befehle zu vorgetriebenem Sadismus: um das Schrecklichste tun zu können, muß es eine Lust bereiten, in der sich das ÜberIch auflösen kann. Die Rezensenten, die aus anderen als ideologischen, bzw. gläubigen, die also aus politischen Gründen gegen Littells Roman geschrieben haben und die man deshalb, weil sie eben intentional sind, für keine Erkenntnisfindung heranziehen kann, sehnen ein Geheimnis des Bösen herbei. Mit diesem deutschen geheimsten inneren Wunsch räumt Littell auf. This is not a Gothic novel.>>>> Littell 4
Littell 2 <<<<
albannikolaiherbst - Montag, 17. März 2008, 17:14- Rubrik: NOTATE