Was dich zur Form treibt. (II).
Künstler zu sein, formuliert >>>> Zschorsch, ist nicht so sehr die Wahl eines Berufes, schon gar nicht die eines Jobs, den einer, der über Fantasie verfüge, sich zum Gelderwerb kultiviere. Sondern es sei eine Haltung, eine Lebenshaltung Lebensform. Er hat damit recht. (Weshalb sich alles vorgeblich ‚neue’, moderne usw. Kunstverständnis erübrigt, das die Erschaffung von Kunstwerken in gesellschaftssoziale Bezüge setzt oder verlangt, sie müsse sich etwa den industriellen Produktionsbedingungen der medialen Welt anpassen - das genau muß sie weder, noch kann sie es).
Lebensform bedeutet, ich verstehe die Geschehen der realen Welt immer auch als Material für Geschichten (für Gedichte, für Musiken, Bilder usw); Haltung bedeutet, dem stelle ich mich. Wiederum heißt ‚immer a u c h’, daß zugleich die Geschehen-selbst nicht uneigentlich werden: sie geschehen n i c h t, damit man eine Geschichte schreibt. Sondern sie geschehen, vorgängig, tatsächlich und mit allen persönlichen Konsequenzen, allem persönlichen Glück, allem persönlichen Leid. Die Geschichte dann wird hinzugeschrieben, das Bild hinzugemalt, die Musik hinzukomponiert. Kunst kommt immer zum Leben h i n z u: sie füllt Welt um eine weitere Realisierung von Leben an. D e s h a l b, n u r deshalb, macht sie die Welt reicher. Es ist ein Irrtum anzunehmen, Kunst setzte sich an die Stelle von Leben, sie sei entweder Substitution oder Bewältigung. Bewältigung ist sie a u c h, aber Bewältigung trifft nicht ihren Kern: Sie könnte nämlich gerade auch k e i n e Bewältigung sein, sondern die Konflikte noch verschärfen. Nur spielt dieser Aspekt bei ihrer Entstehung - immer vorausgesetzt, sie gelingt - keine andere Rolle als die eines, sagen wir, dynamischen Katalysators: persönliche Betroffenheit ist der drängende I m p u l s in die Form. Doch je strenger diese beachtet wird, um so weniger spielt schließlich persönliche Betroffenheit im Kunstwerk noch eine Rolle. Es wäre eine Geschichte sonst auf ihre Leser gar nicht übertragbar. Wir können das Leid und das Glück eines anderen nicht als eigenes empfinden („wir sind immer allein“), wir können es aber sehr wohl bei Gestalten der Kunst („wir sind n i c h t immer allein“): gerade, weil ihnen die Form das Eigene nimmt und zu etwas Allgemeinem werden läßt:: etwas, das andere a l s Eigenes in sich hineinnehmen und miterleben können::: die Kunstfigur wird zum Introjekt des Rezipienten.
„Wir werden allein geboren“, hat meine Mutter einmal gesagt, „wir sterben allein, alles dazwischen sind Verbindungen auf Vorläufigkeit.“ Genau dem setzt Kunst ein emphatisches NEIN entgegen und macht sich zum radikalen Vermittler zwischen Du, Ich und Wir. Sie macht das Eigene, das dem Anderen real fremd ist, zu dem Realen Inneren des Anderen. Insofern ist sie immer auf Entindividuation aus, auf Verschmelzung: das hat sie mit dem erotischen Akt gemein. Deshalb sind Kunst und Eros verwandt. (Adorno sprach von Eros & Erkenntnis und diagnostizierte ein selbes für die Philosophie).
Lebensform bedeutet, ich verstehe die Geschehen der realen Welt immer auch als Material für Geschichten (für Gedichte, für Musiken, Bilder usw); Haltung bedeutet, dem stelle ich mich. Wiederum heißt ‚immer a u c h’, daß zugleich die Geschehen-selbst nicht uneigentlich werden: sie geschehen n i c h t, damit man eine Geschichte schreibt. Sondern sie geschehen, vorgängig, tatsächlich und mit allen persönlichen Konsequenzen, allem persönlichen Glück, allem persönlichen Leid. Die Geschichte dann wird hinzugeschrieben, das Bild hinzugemalt, die Musik hinzukomponiert. Kunst kommt immer zum Leben h i n z u: sie füllt Welt um eine weitere Realisierung von Leben an. D e s h a l b, n u r deshalb, macht sie die Welt reicher. Es ist ein Irrtum anzunehmen, Kunst setzte sich an die Stelle von Leben, sie sei entweder Substitution oder Bewältigung. Bewältigung ist sie a u c h, aber Bewältigung trifft nicht ihren Kern: Sie könnte nämlich gerade auch k e i n e Bewältigung sein, sondern die Konflikte noch verschärfen. Nur spielt dieser Aspekt bei ihrer Entstehung - immer vorausgesetzt, sie gelingt - keine andere Rolle als die eines, sagen wir, dynamischen Katalysators: persönliche Betroffenheit ist der drängende I m p u l s in die Form. Doch je strenger diese beachtet wird, um so weniger spielt schließlich persönliche Betroffenheit im Kunstwerk noch eine Rolle. Es wäre eine Geschichte sonst auf ihre Leser gar nicht übertragbar. Wir können das Leid und das Glück eines anderen nicht als eigenes empfinden („wir sind immer allein“), wir können es aber sehr wohl bei Gestalten der Kunst („wir sind n i c h t immer allein“): gerade, weil ihnen die Form das Eigene nimmt und zu etwas Allgemeinem werden läßt:: etwas, das andere a l s Eigenes in sich hineinnehmen und miterleben können::: die Kunstfigur wird zum Introjekt des Rezipienten.
„Wir werden allein geboren“, hat meine Mutter einmal gesagt, „wir sterben allein, alles dazwischen sind Verbindungen auf Vorläufigkeit.“ Genau dem setzt Kunst ein emphatisches NEIN entgegen und macht sich zum radikalen Vermittler zwischen Du, Ich und Wir. Sie macht das Eigene, das dem Anderen real fremd ist, zu dem Realen Inneren des Anderen. Insofern ist sie immer auf Entindividuation aus, auf Verschmelzung: das hat sie mit dem erotischen Akt gemein. Deshalb sind Kunst und Eros verwandt. (Adorno sprach von Eros & Erkenntnis und diagnostizierte ein selbes für die Philosophie).
[Poetologie.
Döllnsee, Küchentisch.
Nebenan schläft der Junge, und
der Profi hantiert ordnend herum.]
Döllnsee, Küchentisch.
Nebenan schläft der Junge, und
der Profi hantiert ordnend herum.]
albannikolaiherbst - Samstag, 8. Juli 2006, 09:09- Rubrik: Arbeitsjournal
































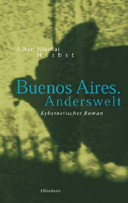






Trackback URL:
http://albannikolaiherbst.twoday.net/stories/2309376/modTrackback