Ernst Fuchs gewidmet. Die Arbeits-, eher aber Besinnungsjournale des Dienstags und Mittwochs, dem 9. wie 10. November 2015. Und für Jean-Claude Brisseau.

In Ernst Fuchs' Musiksalon
Fotografie (©): >>>> Gaga Nielsen
Wenn es einen Gott gibt, ist er vielleicht
kein Softy, aber er ist mit Sicherheit ein
sehr guter Mathematiker.
Jean-Claude Brisseau, Á lAventure
Sie haben keine Erinnerung und hören auf,
bevor sie eigentlich angefangen haben.
Jean-Luc Godard, Prénom Carmen
[9. November
Arbeitswohnung, 18.17 Uhr
Verdi, Aida]
Arbeitswohnung, 18.17 Uhr
Verdi, Aida]
Waschsalon.
Ernst Fuchs ist gestorben; das deutsche Feuilleton läßt ihn einen Bohémien sein, kaum mehr. Seine Bedeutung für Eros, Mythos, Pathos wird ignoriert. „Banausen“, schrieb mir Gaga Nielsen, die >>>> dort sehr schön über ihn geschrieben und >>>> Fotoalben über ihn und seine direkte Umgebung veröffentlicht hat. Aber vielleicht, dachte ich, werde ich ja auch bestraft, weil ich mich mit Traumschiff zu nah an den Tod herangewagt habe, weil das eine Blasphemie, mindestens eine Übertretung ist, ein Übertritt war, der Menschen nicht nachgesehen wird.
Meine Gedanken drehen sich.
Aufhören, bevor man eigentlich anfängt. Furcht vorm Verlust der Autonomie, auch vorm Erscheinen der Erscheinung. Semele verbrennt und hinterläßt uns aber den Wein. Lieber den schlechten status quo, weil er vertraut ist, aufrecht erhalten, als etwas möglicherweise Gutes zu beginnen, das aber Risiken birgt. Der Frosch sitzt so lange im zunehmend wärmeren, schließlich siedenden Wasser, bis er tot ist und gart. Er springt nicht hinaus, sondern harrt seinem Tod regungslos entgegen. So die Menschen, wenn sie etwas verändern müßten, auch wenn sie‘s wissen, daß sie müßten. „Frau Doktor, Frau Doktor, helfen Sie“, war aus ihrer Praxis eine stehende Redewendung Dos, „aber so, daß sich nichts ändert.“
Ich hatte nie viel Kontakt zu Fuchs, aber er war einer der Hinausspringer. Das sah ich seinen Bildern immer an und habe sie dennoch nicht in meiner Nähe Quartier nehmen lassen. Weshalb nicht?
Nun ist es zu spät. Nielsen verdanke ich‘s, daß ich Fuchsens Tod überhaupt mitbekommen habe. Ich hockte zu tief in anderem, etwa in >>>>> dieser und der mit ihr zusammenhängenden Auseinandersetzung >>>> dort, deren eines Ergebnis nun wohl auch der Bruch zwischen Sabine Scho und mir ist.
Verdi hören, Tag um Tag. Daß ich überhaupt wieder Musik höre!
Auch engen Freunden gefällt meine Haltung nicht, auch entfernteren Verbündeten gefällt sie nicht. Ich werde damit leben müssen. Es geht mir nun, da ich mir wieder meine Position und ihre Gründe deutlich gemacht habe, erheblich besser als in den Wochen vorher. Ich kann meinen Frieden mit der Erfolglosigkeit machen, weil sie systemisch ein logisches Ergebnis ist. Kein status quo mag Rebellen.
Und wie auffällig schwer sich diese Gesellschaft mit dem Genie tut! Es hat keinen Platz im Profanen, keinen Platz unter denen, die um jeden Preis kalkulieren können wollen, ob Macht, ob Umsatz, ob das eigene Leben.
„Sie sind im Loch“, sagte Godard. Ihre Erinnerungen bestehen aus der morgigen Abzahlungsrate. „Wir alle sind im Gefängnis und müssen lernen, es uns etwas kommoder drin zu machen“, rät in >>>> Á l'Aventure, dem dritten Teil der Choses secrètes, die Mutter ihrer Tochter, die zurecht nicht auf sie hört. Man sieht der Mutter die gefällige, in ihrem Fall ökonomisch gut versorgte Verhärmtheit schon an.
[Mittwoch, 11 November
8.07 Uhr
Verdi, Il Trovatore]
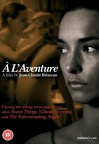
Ernst Fuchs ist gestorben; das deutsche Feuilleton läßt ihn einen Bohémien sein, kaum mehr. Seine Bedeutung für Eros, Mythos, Pathos wird ignoriert. „Banausen“, schrieb mir Gaga Nielsen, die >>>> dort sehr schön über ihn geschrieben und >>>> Fotoalben über ihn und seine direkte Umgebung veröffentlicht hat. Aber vielleicht, dachte ich, werde ich ja auch bestraft, weil ich mich mit Traumschiff zu nah an den Tod herangewagt habe, weil das eine Blasphemie, mindestens eine Übertretung ist, ein Übertritt war, der Menschen nicht nachgesehen wird.
Meine Gedanken drehen sich.
Aufhören, bevor man eigentlich anfängt. Furcht vorm Verlust der Autonomie, auch vorm Erscheinen der Erscheinung. Semele verbrennt und hinterläßt uns aber den Wein. Lieber den schlechten status quo, weil er vertraut ist, aufrecht erhalten, als etwas möglicherweise Gutes zu beginnen, das aber Risiken birgt. Der Frosch sitzt so lange im zunehmend wärmeren, schließlich siedenden Wasser, bis er tot ist und gart. Er springt nicht hinaus, sondern harrt seinem Tod regungslos entgegen. So die Menschen, wenn sie etwas verändern müßten, auch wenn sie‘s wissen, daß sie müßten. „Frau Doktor, Frau Doktor, helfen Sie“, war aus ihrer Praxis eine stehende Redewendung Dos, „aber so, daß sich nichts ändert.“
Ich hatte nie viel Kontakt zu Fuchs, aber er war einer der Hinausspringer. Das sah ich seinen Bildern immer an und habe sie dennoch nicht in meiner Nähe Quartier nehmen lassen. Weshalb nicht?
Nun ist es zu spät. Nielsen verdanke ich‘s, daß ich Fuchsens Tod überhaupt mitbekommen habe. Ich hockte zu tief in anderem, etwa in >>>>> dieser und der mit ihr zusammenhängenden Auseinandersetzung >>>> dort, deren eines Ergebnis nun wohl auch der Bruch zwischen Sabine Scho und mir ist.
Verdi hören, Tag um Tag. Daß ich überhaupt wieder Musik höre!
Auch engen Freunden gefällt meine Haltung nicht, auch entfernteren Verbündeten gefällt sie nicht. Ich werde damit leben müssen. Es geht mir nun, da ich mir wieder meine Position und ihre Gründe deutlich gemacht habe, erheblich besser als in den Wochen vorher. Ich kann meinen Frieden mit der Erfolglosigkeit machen, weil sie systemisch ein logisches Ergebnis ist. Kein status quo mag Rebellen.
Und wie auffällig schwer sich diese Gesellschaft mit dem Genie tut! Es hat keinen Platz im Profanen, keinen Platz unter denen, die um jeden Preis kalkulieren können wollen, ob Macht, ob Umsatz, ob das eigene Leben.
„Sie sind im Loch“, sagte Godard. Ihre Erinnerungen bestehen aus der morgigen Abzahlungsrate. „Wir alle sind im Gefängnis und müssen lernen, es uns etwas kommoder drin zu machen“, rät in >>>> Á l'Aventure, dem dritten Teil der Choses secrètes, die Mutter ihrer Tochter, die zurecht nicht auf sie hört. Man sieht der Mutter die gefällige, in ihrem Fall ökonomisch gut versorgte Verhärmtheit schon an.
[Mittwoch, 11 November
8.07 Uhr
Verdi, Il Trovatore]
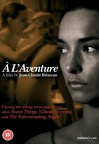
Ich sah den Film gestern nacht und war baff über die Verbindung von freilich ausgesucht schönen Frauenkörpern, kosmologischer Spekulation, bzw. kosmologischen Fantasien und Mystik. Typisch für französische Filmästhetik sind die Szenen stark über Dialoge und so gut wie gar nicht über „Action“ (Äktschn, ecco) geführt, was auf bemerkenswerte Weise dennoch Spannung aufbaut. Brisseau verlegt sie schlichtweg in den Kopf seiner Zuschauer:innen und versucht wirklich das, was sein Thema ist: weiblicher Sexualität, weiblichem Begehren, ja mehr noch: dem weiblichen Orgasmus auf die Spur zu bekommen. Das funktioniert interessanterweise über so etwas wie ständige Versuchsaufbaue. Männer sind dabei fast nur Beobachter; der Regisseur selbst nimmt sich in ihnen zurück, um, wie er in seinem zweiten Spielfilm der Trilogie, >>>> Les Anges exterminateurs, sagen läßt, „nicht die eigenen Fantasien zu inszienieren“; insofern ist das Setting fast ein psychoanalytisches aus Übertragung und Gegenübertragung, wobei der junge Psychologe, der von den Frauen recht eigentlich seinerseits geführt wird, auf die eigene Distanzierung schließlich vergißt und, wie später gesagt wird, „zu weit geht“, also eine Grenze überschreitet. Das stellt eine rasend interessante, in humanistischem Sinn – etwa wie Schoppe bei Jean Paul - komische Figur fest, der „eigentliche“ Beobachter des Geschehens, ein philosophierender Taxifahrer, der immer wieder mit der Hauptheldin des Films Gespräche auf einer Parkbank führt. Er eigentlich ist der gefallene Engel, der dem Film seinen deutschen Untertitel gibt. Die Trilogie-an-sich hat einen typisch dummdeutschen Titel verpaßt bekommen: Heimliche Spiele 1 – 3. Das schielt auf sensationsgeiles Publikum, das sich an Hardcore nur heimlich und schlechtgewissig traut.
Gewiß, einiges mutet bei Brisseau nach Softporno an, aber eben nur auf der obersten Oberfläche, nicht, wenn man die übrigen Strukturen hinzudenkt. Brüste und Mösen kann man auch ohne diese, unabgelenkt von ihnen, betrachten. Die deutsche Kritik würde auch hier, wäre es ein Buch, von >>>> „überfrachtet“ reden; hätte sie übrigens auch bei Godard tun müssen, aber, wie gesagt, sie tut‘s ja nur bei deutschen, bzw. deutschsprachigen Künstlern.
Indem nun Brisseau das „Männliche“ aus dem Film herauszunehmen versucht, setzt sich ein starker Akzent auf quasi-lesbische Liebe, aber körperliche Liebe eben als weiblichen Ausdruck mystischer Zusammenhänge. Die Verbundenheit mit Männern wird fast immer nur behauptet. Das ist sicher eine Schwäche, hebt sich aber im zweiten Film, der letztlich ein Metakommentar zum ersten ist, wieder auf (den ersten werde ich mir erst heute abend ansehen: Ich sehe die Trilogie sehr bewußt in umgekehrter Reihenfolge, weil ich auf die Weise die künstlerische Konstruktion genauer erkennen kann).
Bemerkenswert ist in jedem Fall, wie nahe Brisseaus Szenen einerseits tantrischen, andererseits den neupaganen Vorstellungen eines Zweigs der Frauenbewegung kommen; dabei ist allerdings die Aussparung dieses Männlichen durchaus problematisch, insoweit die Faszination durch den Phallus fehlt. Wie mir einmal eine Geliebte sagte: „Weißt du, weshalb wir so gerne die Adern auf den Unterarmen von Männern ansehen? - Sie erinnern an die des prall durchbluteten Schwanzes.“ Eine andere Gefährtin, zwei Jahrzehnte davor, berichtete von dem rauschhaften Gefühl, das die Eichel in ihr auslöste, wenn sie sich unter den Gaumen drückt, „als ob der ganze Kopf platzt, aber ungeheuer glückhaft“.
Ich bin gespannt, ob sich Brisseau noch auf diese Wege begeben wird. Vielleicht ist seine diesbezügliche Zurückhaltung auch einfach nur dem Umstand geschuldet, daß die Darstellung des erigierten Gliedes nach wie vor für hart-pornografisch gilt, was einem Spielfilm das „normale“ Kino verschließt. Die häufigen, ja zentralen Masturbationsszenen der Trilogie übertreten eh schon Tabus (hübsch etwa, und sofort geradezu nachempfinfbar die Szene mit der Kugel). Brisseau verzichtet aber sicher nicht aus Pornoscheu auf die pornotypische Großaufnahme, sondern weil er sich sehr viel mehr auf die Gesichter der Frauen konzentriert, auf deren orgasmischen Ausdruck. Er hofft, aus dem puren Ansehen Wahrheit zu erfahren – als würde das Mystische aus ihnen im Moment des Höhepunkts wie ein (Er)Leuchten hinausstrahlen: lebende und lebendige Imago des Erleuchtetseins, Erscheinung quasi selbst. Und manchmal i s t es auch so.
Im umfassendsten Grunde sind Brisseaus Filme ebenso nichtkonfessionelle wie tiefreligiöse Meditationen. Wenn er ein pragmatisches Anliegen hat, dann die Rücknahme der jahrhundertealten Desavouierung der weiblichen Sexualität – und ihrer Verinnerlichung (Internalisierung) in „den“ Frauen selbst: - in d i e (:Akkusativ) Frauen, eine Formulierung, die den Prozeß als diejenige patriarchal-sexualfeindliche Strategie bezeichnet, die er eben war und ist. Gleichzeitig streift er das allein profan-Praktische ihrer Verfügbarkeit von der Sexualität wieder ab, das scheinEmanzipatorische, das sich selbst wie ein zuhandnes Ding benutzbar macht. Es geht ihm ganz offensichtlich weniger um rationale „Aufklärung“ als um Näherungen an die sinnlichste Form des Heiligen, die wir kennen.
Daß mir das nah ist, muß ich hier nicht eigens hinschreiben.
Da schloß das Neuralrohr sich, erstmals ward Seele. Ein Wunder ist nicht, wenn sie ein Gott einhauchte, sondern wie chemisch vollkommen sie, ganz wie der Geist, körperlich ist und aus Körpern gemacht. Daß sie sich weiß, das ist das Wunder. Denn wäre sie übersinnlich, sie wär kein Geheimnis. Chemie ist sakral und die Physis, der Bios (fließ, Regnitz, fließe). Organisches Regen, Orgasmen, Regresse. Heiliges Progesteron, das die Uterusschleimhaut aufschüttelt wie für den Kopf eines Liebsten, der herziehen möchte, damit’s die Empfängnis bequem hat.
Gewiß, einiges mutet bei Brisseau nach Softporno an, aber eben nur auf der obersten Oberfläche, nicht, wenn man die übrigen Strukturen hinzudenkt. Brüste und Mösen kann man auch ohne diese, unabgelenkt von ihnen, betrachten. Die deutsche Kritik würde auch hier, wäre es ein Buch, von >>>> „überfrachtet“ reden; hätte sie übrigens auch bei Godard tun müssen, aber, wie gesagt, sie tut‘s ja nur bei deutschen, bzw. deutschsprachigen Künstlern.
Indem nun Brisseau das „Männliche“ aus dem Film herauszunehmen versucht, setzt sich ein starker Akzent auf quasi-lesbische Liebe, aber körperliche Liebe eben als weiblichen Ausdruck mystischer Zusammenhänge. Die Verbundenheit mit Männern wird fast immer nur behauptet. Das ist sicher eine Schwäche, hebt sich aber im zweiten Film, der letztlich ein Metakommentar zum ersten ist, wieder auf (den ersten werde ich mir erst heute abend ansehen: Ich sehe die Trilogie sehr bewußt in umgekehrter Reihenfolge, weil ich auf die Weise die künstlerische Konstruktion genauer erkennen kann).
Bemerkenswert ist in jedem Fall, wie nahe Brisseaus Szenen einerseits tantrischen, andererseits den neupaganen Vorstellungen eines Zweigs der Frauenbewegung kommen; dabei ist allerdings die Aussparung dieses Männlichen durchaus problematisch, insoweit die Faszination durch den Phallus fehlt. Wie mir einmal eine Geliebte sagte: „Weißt du, weshalb wir so gerne die Adern auf den Unterarmen von Männern ansehen? - Sie erinnern an die des prall durchbluteten Schwanzes.“ Eine andere Gefährtin, zwei Jahrzehnte davor, berichtete von dem rauschhaften Gefühl, das die Eichel in ihr auslöste, wenn sie sich unter den Gaumen drückt, „als ob der ganze Kopf platzt, aber ungeheuer glückhaft“.
Ich bin gespannt, ob sich Brisseau noch auf diese Wege begeben wird. Vielleicht ist seine diesbezügliche Zurückhaltung auch einfach nur dem Umstand geschuldet, daß die Darstellung des erigierten Gliedes nach wie vor für hart-pornografisch gilt, was einem Spielfilm das „normale“ Kino verschließt. Die häufigen, ja zentralen Masturbationsszenen der Trilogie übertreten eh schon Tabus (hübsch etwa, und sofort geradezu nachempfinfbar die Szene mit der Kugel). Brisseau verzichtet aber sicher nicht aus Pornoscheu auf die pornotypische Großaufnahme, sondern weil er sich sehr viel mehr auf die Gesichter der Frauen konzentriert, auf deren orgasmischen Ausdruck. Er hofft, aus dem puren Ansehen Wahrheit zu erfahren – als würde das Mystische aus ihnen im Moment des Höhepunkts wie ein (Er)Leuchten hinausstrahlen: lebende und lebendige Imago des Erleuchtetseins, Erscheinung quasi selbst. Und manchmal i s t es auch so.
Im umfassendsten Grunde sind Brisseaus Filme ebenso nichtkonfessionelle wie tiefreligiöse Meditationen. Wenn er ein pragmatisches Anliegen hat, dann die Rücknahme der jahrhundertealten Desavouierung der weiblichen Sexualität – und ihrer Verinnerlichung (Internalisierung) in „den“ Frauen selbst: - in d i e (:Akkusativ) Frauen, eine Formulierung, die den Prozeß als diejenige patriarchal-sexualfeindliche Strategie bezeichnet, die er eben war und ist. Gleichzeitig streift er das allein profan-Praktische ihrer Verfügbarkeit von der Sexualität wieder ab, das scheinEmanzipatorische, das sich selbst wie ein zuhandnes Ding benutzbar macht. Es geht ihm ganz offensichtlich weniger um rationale „Aufklärung“ als um Näherungen an die sinnlichste Form des Heiligen, die wir kennen.
Daß mir das nah ist, muß ich hier nicht eigens hinschreiben.
albannikolaiherbst - Mittwoch, 11. November 2015, 09:31- Rubrik: Arbeitsjournal
































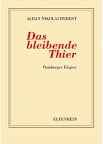












Trackback URL:
http://albannikolaiherbst.twoday.net/stories/ernst-fuchs-dagger-gewidmet-die-arbeits-eher-aber-besinnungsjournale-d/modTrackback