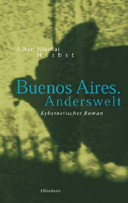|
|
Ich habe eine Ästhetik durchzufechten, die nicht gewollt wird. Deshalb sagt man mir gern, ich nähme mich zu wichtig. Dabei bin ich mir durchaus im klaren darüber, daß ich beileibe nicht der einzige bin, dem es so geht. Aber ich gehöre zu den wenigen, die sich nicht zurückziehen, sondern den Kampf auch öffentlich aufgenommen haben. Damit stehe ich in einer langen Tradition von Künstlern, denen ebenfalls nichts anderes übrigblieb, als "sich schrecklich wichtig" zu nehmen. Es wäre sonst von ihrer Arbeit nämlich nichts mehr da, und die Museen wären halb leer und die Konzertsäle taub. Man denke an Breton, an Berlioz, an Heinrich von Kleist, an Gustav Mahler und van Gogh. Auch das verbotene Buch wäre dann nicht geschrieben, nicht der ANDERSWELT-Zyklus, nicht der WOLPERTNGER, nix. Diese Romane entstanden und erschienen nur, i n d e m ich "mich wichtig nahm"; das mußte ich tun, seit mir von ziemlich allem Anfang an klargemacht wurde: Wir wollen dich nicht. Hätte ich mich n i c h t "wichtig genommen", ich wäre heute Angestellter in irgend einem Unternehmen und huddelte von meinem Job frustriert vor mich hin. Aber meine Arbeit ist kein Tütü, die man halt so macht, noch gar, wenn einem grad danach ist. Sie ist schon gar kein "Entertainment". Man i s t vielmehr diese Arbeit, weil die ganze Person, die sie trägt, mit sich für sie einsteht und in sie eingeht. Da ist ja kein andrer, der das täte, da ist nur man selbst. In einer solchen Situation ist jeder Schlag ins Gesicht dieser Arbeit zugleich ein Schlag ins Gesicht der "Person ganz persönlich". Ich will gewiß niemandem erklären, was intensiv sei und was verletzend und wie mißverstanden ich sei und mein Werk. Sondern ich schreibe darüber (unter vielem anderen), ich drücke es aus. Daß es einigen Leuten lieber wäre, ich schwiege und ließe der Welt, in Biermanns Worten, "ihren sozialistischen Gang", ist schon klar. Das nicht zu tun, stört nämlich den bürgerlichen, kommoden Betrieb, stört die Korruption, stört das Schöntun, stört das hehre Menschenbild insgesamt, das man so allgemein vor sich herträgt. Abgesehen davon, wäre ich dann als Autor schon lange nicht mehr existent.
Zum Verhältnis von Privatheit und Öffentlichkeit habe ich im letzten Jahr häufig publiziert; auch das hat vielen nicht gefallen. Ich werde die Konsequenzen tragen, selbstverständlich, auch wenn sie Ausgrenzung bedeuten. Aber ich werde mich nicht brechen lassen. Auch nicht, wenn ich dafür auf die Zuneigung von mir wichtigen Menschen verzichten muß. Und möge das noch so wehtun. Ich werde darüber schreiben, werde meine Traurigkeit zugeben, aber ich werde drum nicht verstummen. Denn hier wirkt kein privater, sondern ein künstlerischer Zusammenhang, und zwar schon deshalb, weil das "Material" eines Dichters in allererster Linie einmal er selber ist; es bleibt ihm, will er nicht nur bloß-äußerlich beschreiben oder Betroffenheit ausdrücken, sondern verstehen und in die Sprache bekommen, gar nichts anderes übrig.
Als ich Die Dschungel begann, habe ich strikt alles Private herausgehalten, ja gegen die vielen privaten Weblogs polemisiert. Im Verlauf der Arbeit hat sich meine Perspektive verschoben, und ich bin jetzt fast auf der gegenüberliegenden Seite angelangt. Diese Bewegung ist zugleich von mir beobachtet und formuliert worden; Die Dschungel haben sie allezeit auch theoretisch begleitet. Eine solche Arbeit nehme ich nicht zurück, und zwar eben deshalb, w e i l ich mich nicht zu wichtig nehme. Ich trag ja ganz im Gegenteil nur bittre Konsequenzen davon. Ich nehme vielmehr meine A r b e i t wichtig. Das in der Tat. Und ein ‚z u’ wichtig gibt es da nicht. Die Dschungel und auch das Tagebuch sind ein Teil dieser Arbeit. Wenn sie privat und öffentlich nicht zu unterscheiden vermag, liegt es daran, daß es diesen so praktisch-funktionalen Unterschied in der Kunst nicht gibt. Der Beruf hebt ihn auf, oder man muß noch in den Texten heucheln. In anderen Berufen ist er allerdings wichtig und nötig, dagegen sage ich nichts.
albannikolaiherbst - Donnerstag, 1. September 2005, 13:11- Rubrik: Arbeitsjournal
Wir sind die Leute vom Betrieb
Und haben uns ganz schrecklich lieb
Wenn einer sagt: Den wolln wer nicht
Dann wolln wir alle, daß er bricht
Dann lügen wir, dann hetzen wir
Wir haben feine Gaben
Dem schlimmen Bub zu schaben
Sie mobben alle vier:
Der Heuchler, der Schieber,
Der Ducker und der Denunziant
Beherrschen sowieso das Land
Da ist uns mittun lieber.
Refrain im Gänsechor:
Wes’ Geist uns in die Suppe spuckt
Des’ Körper in der Schlinge zuckt.
Heißà!
albannikolaiherbst - Donnerstag, 1. September 2005, 00:32- Rubrik: Buchverbot
Ungefugger hatte mit der Tochter auch über Sexuelles gesprochen. Er entsann sich sehr wohl seiner heimlichen Besuche im BOUDOIR und schämte sich ihrer bis heute. Vor sich selbst, nicht vor anderen. Diese entsetzlichen alten Frauen. Ihm wurde übel, dachte er dran. Aber er wußte von daher genau, wie es einen trotz der Moral von Zeit zu Zeit überkommt. So daß er der Tochter wie seiner Frau gegens Heißsein die Spritze empfahl. Einer solchen hatte Michaela Gabriela sich aber nie bedient. Sie war zu eigensinnig dazu, wollte ihren Körper ganz aus dem Geist bestimmen. Also aß sie nicht mehr oder nur wenig. Ihre Mutter, die das besorgt, aber tumb registrierte, mischte ihr heimlich Fette in den Magerjoghurt, was Michaela selbstverständlich bemerkte; sie wich fortan auf Nahrungspillen aus, das ließ sich so dosieren, daß man nicht in die Gefahr kam, den Körper insgesamt kollabieren zu lassen. Ihr Geist wurde ausgesprochen rein davon. Sehr klar. Sehr gerichtet. Und der Sexualdrang verschwand. Nein, sie brauchte keine Spritzen. Zwar waren ihre Arme wie ein Bambus, doch spielten elegant modulierte Muskeln daran. Das kam vom Training. Ebenso waren die Beine. Kein Gramm Fett. Das machte sie stolz. Ihr Gesäß war wie das eines jungen Mannes, mit Buchtung in den Backen. Nur ihre Brüste ärgerten sie, weil die hingen seit der Diät, Krafttraining wehrte dem nicht. Die kleine Ungefugger nahm ihre Brüste nicht als Organe sondern wie Accesoirs wahr, über die man verfügt, also als einen bloßen Schmuck. Man muß den nicht betonen, nicht einmal haben wollen; wenn aber etwas ihn einem wegnimmt, dann ist das schwer zu ertragen. Nicht zu azeptieren, dachte Michaela Ungefugger und zog Erkundigungen nach holomorfen Prothesen ein, wie ihr Vater eine, als Ohr, trug. Jedenfalls ließ sie sich nicht erpressen, auch nicht von ihrem Körper. Freilich hatte sie nicht genug Geld, um etwas solches in Auftrag zu geben; ihre Mutter wäre, das wußte sie, dagegen. „Ernähr dich richtig, Kind, du hast einen sehr schönen Körper, den darfst du nicht vernachlässigen.“ Aber mit der sprach sie ja sowieso nicht. Und den Vater, dem erotisches Aussehen völlig egal war, belästigte sie mit solchen Kleinigkeiten nicht. Am unangenehmsten war, daß die Brüste, als sie so schlaff geworden, aus ihren Knospen Sekrete abzusondern begannen, und zwar in solcher Menge, daß die junge Frau Stilleinlagen in die BHs heften muße. Sie ahnte, daß dieser Widerstand ihr Muttererbteil war, der sich durchsetzen wollte. Sie nannte das selbst den Saft: „Jetzt hab ich diesen Saft schon w i e d e r!“
>>>> ARGO 139
ARGO 137 <<<< albannikolaiherbst - Freitag, 2. September 2005, 20:03- Rubrik: ARGO-ANDERSWELT
Wir begegnen, wenn wir im Cyberraum miteinander sprechen, den eigenen Inneren Geschöpfen, die sich nun im Netz objektivieren und zu deren einem wir selber werden: - unser selbstidentisches Bild wird dazu.
(CCCXXX).
50 <<<< albannikolaiherbst - Freitag, 2. September 2005, 16:57- Rubrik: Litblog-THEORIE
Ein Rufen, das Liebe und Vergessenmüssen zugleich ist, das aber dem persönlichen Vergessen, dem nahen, den Klang von Bleibendem verleiht, l a n g e Bleibendem: eine öffentliche, Schönheit gewordene Erinnerung, die hier, wie selten ein anderes Stück, das ganz-Persönliche in dem ganz-Allgemeinen, dem Übertragbaren, das jeder Hörer kennt und jeden Hörer meint, bewahrt. Die dennoch komponiert, ja experimentiert, sogar ausprobiert. Meisterhaft und persönlich, man kann das nur bewundern. Da es zugleich das Politische nicht verrät. Und muß es lieben. „Für Luciano Cruz, um zu leben“, schrieb Nono über die Partitur. Jetzt - für die knapp dreißig Minuten, in denen sie’s hört - stehe für eb darüber. Man darf so etwas, vorsichtig, tun. Denn Kunst gehört allen. Dem Leser, wenn er sie liest, und dem Hörer, wenn er sie hört.
>>>> Luigo Nono, Como una ola di fuerza y luz. Musik für Sopran, Klavier und Tonband aus den Jahren 1971/1972.
come una, Luciano!, ola
de fuerza
joven como la revolucíon
siempre vivo
y seguirás flameando
luz
para vivir
(Julio Huasi)
albannikolaiherbst - Freitag, 2. September 2005, 14:09- Rubrik: MusikDesTagesFuerEB
Prosa schreiben wollen, die zwar ausgedehnte Erzählung, zugleich aber dicht ist wie Lyrik. Und sich dann über die schlechten Verkaufszahlen ärgern.
albannikolaiherbst - Freitag, 2. September 2005, 12:06- Rubrik: Arbeitsjournal
Es handelt sich um eine symbolische Verschiebung, die die Mutter-Imago auf den Öffentlichen Raum projeziert und Anerkennung d o r t sucht; doch kann sie da ebenso wenig erfolgen wie in der weil vergangenen Nicht-Realität der vermißten mütterlichen Zuwendung. Das unbewußt begonnene Unternehmen ist selbstverständlich ein irres, andererseits ist es an zunehmende Leistung gekoppelt: Man möchte sich die Zuwendung also verdienen. Das ist indessen dem Wesen der Zuneigung fremd. Deshalb bleibt sie aus. Gleichwohl führt das Verlangen nach ihr zu einer ständigen Verfeinerung, Verschönerung und Perfektionierung der künstlerischen Mittel und schließlich des Werkes. Da Perfektion wiederum ihres Characters nach gerade n i c h t s ist, das Liebe hervorruft, sondern im Gegenteil anderes hermetisch von sich abweist (allerdings kann sie bewundert oder respektiert werden; es hängt ihr aber immer etwas Unheimliches an), dreht sich der für den Künstler- persönliche Teufelskreis weiter, für das Werk aber ist genau das fruchtbar: weil die nach jedem neuen Buch Bild Musikstück sich aufgetane Lücke - diese schmerzhafte Differenz von dem, was geschaffen wurde, zu dem, was man an Zuneigung dafür erhält) - abermals und nun erst recht geschlossen werden will. So beginnt dann also immer eine neue Arbeit.
Der Prozeß läßt sich auch anders betrachten. Der Künstler (Die Dschungel spricht hier von einer Character-Disposition, nicht etwa emphatisch) realisiert seine Identität im P r o z e ß der Arbeit. Ist sie abgeschlossen, ist diese Form der Realisierung sozusagen zugeklappt worden, denn das Buch Bild Musikstück steht ja als Geschaffenes wie etwas Fremdes dem Künstler gegenüber. Und wie bei dem Streben nach Zuneigung ist auch hier dann zwar ein Werk entstanden, aber es erfüllt nicht mehr, was es sollte; und es kann das auch gar nicht erfüllen, da die Identität rein durch den Prozeß zustandekam, in dem man sich fühlte. Und ebenfalls wieder tut sich die Differenz auf, und ebenfalls wieder will sie vermittels einer neuen Arbeit geschlossen werden. Ad infinitum aut mortem.
[Deshalb, nebenbei bemerkt, ist autobiographisches Schreiben, das nackt dokumentieren will, letztlich gar nicht möglich, und zwar auch nicht im Tagebuch Der Dschungel. Vielmehr entsteht immer etwas Fremdes, das etwas Eigenes, fast Autonomes ist - oder aber als Geschriebenes schlecht. Als „Gutes“ wird es in jedem Fall Literatur und unterliegt damit denselben Entfernungsgesetzen: Die Werke streben auseinander wie die Galaxien, und der Künstler steht nicht einmal in ihrer Mitte, da sich auch die Leser gravitativ zu den Werken verhalten.]
(Es gibt - wenige - Ausnahmen. Zum Beispiel Verdi. Zum Beispiel Rossini. Die konnten sagen: Es ist genug.)
[Produktivitätsästhetik.]
albannikolaiherbst - Freitag, 2. September 2005, 09:40- Rubrik: Arbeitsjournal
[Gesehen am 2. September 2004, CINEMAXX Colosseo Berlin.]
Ästhetisierter Trash, manierierte harte Brutalitäten in Lack; die Sentimentalität ist gewienert wie ein Parkett. Groß dabei die selten genuin-mythischen (Amazone), meist trivialmythischen Charactere (Detektiv). Einmal wird in zwei voneinander unabhängigen Szenen mit verschiedenem Personal ein Erzählmotiv wiederholt (daß ein Kämpfer gegen die Attacken einer Herzinsuffizienz Tabletten nehmen muß und es vergißt, bzw. es nicht kann), und das ist genau eine Wiederholung zu viel, so daß das Motiv retardiert; allerdings ist das ein Umstand, die auf einen Ideenmangel verweist, nicht auf das ästhetische Handwerk und seine Umsetzung im Film. Die Brutalität ist eine Art Schmuck, der sich höchstwahrscheinlich als ein objektivierter psychischer Reflex auf den Schmutz von Gewalt verstehen läßt, ihn „veredeln“ und dadurch aushaltbar machen will. Hierin liegen Recht und Kraft eines filmischen Manierismus, die gegenwärtig und jedenfalls der deutschsprachigen Literatur nicht zugestanden werden. Wie in beinahe allen derjenigen gesellschaftlichen (das heißt eben besonders: technologischen) Umbruchzeiten, die ich überschaue, tritt im Film ein fast schneidend kalter Ästhetizismus ans Licht und wird auf durchaus moralische Weise ausgestellt: „Ein alter Mann stirbt, ein junges Mädchen bleibt am Leben; das ist gerecht“, sagt zweimal Bruce Willis, bevor er zum ersten, so glaubt man, erschossen wird und zum zweiten sich selber erschießt; und durch ihn sagt das Frank Miller, der Mitregisseur und Autor der gleichnamigen Comic-Serie. Erschossen werden heißt hier immer: zerlöchert werden, und das Blut spritzt wie Lack aus einer Tube, auf die jemand tritt. Den Geist dieses Lacks hat die Verfilmung auf harte, aber ungerechte Weise und sich daran erhebend in Bewegung gesetzt. Viele Szenen wirken wie nachkoloriertes Schwarzweiß und sollen so wirken: die roten Lippen der Frauen, das Rot des Chevrolets. Da ist ein bißchen Wenders’ Hammett, da ist sehr viel film noir, da ist ein bißchen Pakt der Wölfe, und auch an Warhol läßt es sich manchmal denken. Die Literarisierung zur Kunst aber scheitert. Dennoch ist es ein Film für Minderheiten, für eine bestimmte Sozialität von freaks, die man auch ‚Kenner’ nennen kann: Das Kino ist kaum zu einem Achtel gefüllt, in der zweiten Woche, freitags am Abend um acht. Auch Tarantino hat bei der Inszenierung mitgewirkt; man merkt’s. Da er nicht alleine war, bleiben Fragen von Interesse. Die insgesamt sehr kurze Trash-Bewegung ist deutlich verpufft und versucht sich nun an ihrer präziosen Kanonisierung. In einigen Momenten gelingt sie ihr auch. Bei diesen Szenen merke ich auf; diese Szenen wirken nach. Etwa dort, wo die ansonsten allein von dieser Ästhetik einer grell lackierten Brutalität zusammengehaltenen Episoden unversehens zusammengeführt sind und klar wird: Das ist eine einzige, als Allegorie gemeinte Stadt, die freilich in Gotham City ihr Vorbild hat. In den Stripschuppen von Old Town sitzen Menschen wie e i n geschundenes Volk, dem nur die wehrhaften Prostituierten-Amazonen, freilich gegen Bares, ein wenig Freiheit und Sehnsucht garantieren. Man erkennt einander aber nicht, jeder ist Monade. Geschieht ein liebevolles Erkennen allerdings doch, sind die Folgen immer der Schmerz und der Tod. Die Anti-Helden der drei erzählten Geschichten wissen das, sie wissen aber auch: Wir kommen ohnedies nicht hinaus. Und beginnen, den schlechten Zustand ihrer Welt als eine Form des Widerstands zu affirmieren. Das hat ein sowohl psychologisch als auch emphatisch wahres Moment.
albannikolaiherbst - Samstag, 3. September 2005, 15:01- Rubrik: Filme

Europa, Oststadt bei Prag. Hinterm Mauerpark, Berlin.
>>>> ARGO 141
ARGO 139 <<<< albannikolaiherbst - Sonntag, 4. September 2005, 23:18- Rubrik: ARGO-ANDERSWELT
Samtnacht später November
glimmende Elfenbeintassen
in einer Luft aus Kristall
oben verrottet das Kaufhaus
da hineingestellt: zusammen-
–geschoben Abbruch Kunstgewerbe
reinlich an Kitsch unten
die Taille synagogengeschnürt
wo Polizisten patrouillieren
aus ihrer vergangenen Zeit
und sich vor dem Techno ducken
der ihnen auf die Gaumen schlägt
albannikolaiherbst - Sonntag, 4. September 2005, 22:45- Rubrik: Gedichte
„Gleißnerin, unerforschte, dem Meer gleich...“, rezitierte brüchig, weil mit und in ziemlich s e h r gehobener Stimme & Stimmung eine ältere Dame in Schottenrock und blaßroten Nylons darunter, die den Umstand nicht eigentlich verbargen, wieviel Wasser sie in Unter- und Oberschenkeln hatte. Sie hatte es dummerweise, trotz des deklamierten Goethes, auch im Kopf; vielleicht schüttete jener sogar Wasser, nämlich um den Gehalt seiner Verse, n a c h, die, gewissermaßen wie Luftblasen, über die Stampfer durch Bauch Brust Hals torkelnd hinaufstiegen, und an der nur leicht bewegten Oberfläche des Gehirntümpels zerploppten. Dabei hatte die Frau wie zum Gesang den rechten Arm ausgestreckt. Noch war da oben Platz zwischen dem Wasser und der Schädeldecke, sonst hätte sie Kopfschmerzen gekriegt. Aber nicht mehr für lange. Insofern konnte die Rezitatorin Michaela Ungefugger eigentlich nur dankbar sein, also weil die den Vortrag unterbrach. Dazu genügte es allerdings völlig, daß sie erschien; sie mußte gar nichts tun. Sie sprach auch nichts. War im Wortsinn sprachlos. Selbst der Gedanke an Jason und an ihre zickige Rache war, als sie die schranzige Gesellschaft erblickte, momentlang völlig verschwunden; man kann sagen, ihr Mund habe offengestanden. Tatsächlich sah sie zuerst die wasserrot verdickten Beine in den halbhoch klobigen Gesundheitsschuhen. Was daran lag, daß die Präsidentengattin vor den gläsernen Türflügeln zum terrassenartigen Balkon ein so hohes Podest hatte in den Saal zimmern lassen, daß man nur über ein kleines herangeschobenes Treppchen daraufkam. Davor, also recht eigentlich darunter, waren die Stühle gereiht, auf denen die lyrisch Begeisterten saßen und die Köpfe in die Nacken legen mußten, wollten sie der jeweiligen Bardin, dem jeweiligen Barden auf die in beiderlei Hinsicht bewegten Lippen schaun. Nun hatte Frau Ungefugger ein gutes, wenn auch simples Gefühl für repräsentative Architektur; deshalb war, ganz dem innenarchitektonischen Gedanken einer Konjunktur von Türflügeln und Terrassentürflügeln folgend, zwischen jenen und diesen ein Gang freigelassen, der genau mittig auf das Podest zuführte, hinter wiederum dem, jedenfalls tags, die neoklassizistische Sicht auf den weiten Balkon und dahinter die Berge des Juras zum dekorativen Rahmen wurde; jetzt, weil abends und hinter den Scheiben alles dunkel, formten bloß die oberen und seitlichen puttig verzierten Leisten der Fenstertürflügel diesen Rahmen; gewissermaßen wurde gespielt ohne gemalten Kulissenprospekt. Dennoch hatte, wer immer den Saal betrat, den Eindruck, er schaue auf eine Bühne; zumal wenn links und rechts auf den Stuhlreihen Hörer saßen. Aber der Blick ging eben, legte man den Kopf nicht zurück, zuerst auf die Beine. Also wenn man eine Bühne nicht eigentlich erwartete.
>>>> ARGO 140
ARGO 138 <<<< albannikolaiherbst - Sonntag, 4. September 2005, 15:02- Rubrik: ARGO-ANDERSWELT
[Allan Petersson, Neunte Sinfonie.]
Da der Roman seit THETIS >>>> streckenweise in Tableaux erzählt wird, lag der Gedanke nahe, ein Triptychon zu erschaffen, das aber im Grundaufbau genau g e g e n das Triptychon steht: Sind dort die Seitenbilder je halb so schmal wie der Mittelprospekt, so daß das Triptychon sich zuklappen läßt, so wollte ich bislang erreichen, daß, klappt man - bildlich gesprochen - die ANDERSWELT zu, ein gleichseitiges sehr spitzes Dreieck entsteht; also betrachtet man es dann von oben oder unten. Die Zahl 3 spielt deshalb im Romanaufbau eine vorherrschende Rolle, nämlich zwar eben auch metaphorisch: verweist auf Sexuelles und Erotisches und zugleich auf das, sagen wir, Dunkel des Matriarchats (>>>> Paglia). Dieses Motiv ist vom >>>> WOLPERTINGER hergenommen und wird aus der den WOLPERTINGER leitenden Volksmythologie auf die kybernetische Mythologie der ANDERSWELT übertragen. Deshalb personifizieren und leiten seit THETIS ausschließlich F r a u e n den bei allen Kampfhandlungen letztlich doch konstruktiven Widerstand; ihm angeschlossene Männer hingegen, derer es im Roman ja einige gibt, sind fast durchweg destruktiv, und zwar auch dann, wenn sie das gar nicht wollen.
In jedem Fall sind durch die trilogische Form Inhalte und Struktur wechselweise miteinander verbunden. Nun allerdings deutet die, symbolisch gesprochen, matriarchale Struktur darauf hin, daß ich sie - darin vielleicht typisch patriarchal - viel zu starr gedacht habe.
>>>> ARGO 142
ARGO 140 <<<<
albannikolaiherbst - Montag, 5. September 2005, 18:35- Rubrik: ARGO-ANDERSWELT
Für einen langen Flug eine lange Musik:
>>>> Allan Pettersson, Zweites Konzert für Violine und Orchester (1977). Leider gibt es das Konzert, das mit des hierzulande fast ebenso unbekannten Szymanowskis Erstem Violonkonzert zu den ergreifendsten seiner Gattung gehört, derzeit offenbar nicht mehr im Handel. Deshalb kann ich hier nur einen Link auf einige seiner Sinfonien legen. Es ist im übrigen kein Zufall, daß ich ausgerechnet dieses Stück direkt im Abschluß an Nono nenne: seelisch - nicht kompositionstechnisch - haben beide den gleichen Geist:: Pathos & Mit/Leid.
*)
Der 1980 nach langer schwerer Krankheit gestorbene Pettersson war ein Außenseiter der Neuen Musik, ein besessener, kaum umgänglicher Querkopf dazu, der nahezu alles über Bord warf, was die Neue Musik, die er unmenschlich nannte, an Entwicklung gebracht hat. Stur schloß er nach seiner Ersten Sinfonie, die bis heute unzugänglich, also nicht nachzuhören ist, an der spätromantischen Sinfonik wieder an: als einen höchst streitbar bewußten Rückgriff, fast als Revision, die durch die ganze Moderne einen dicken schrägen Strichs zu machen schien. Entsprechend eckte er bei der Musikszene an, in Schweden sowieso, aber auch im Ausland. Weitgehend wurde und wird er ignoriert. Dennoch ist diese Musik hochgradig modern in ihrer rückhaltlosen Zerrissenheit. Sie ist ein derartiger, oft wütender Gesang, daß ich fast immer, wenn ich einen Pettersson höre, mit Sucht darauf reagiere. Verklingt eines seiner wie unendlich ausgedehnten, hochgradig vorwärtstreibenden, bisweilen, aber nur kurz, in seligen melodischen Violinhöhen schwelgende, dann wieder brutal zerrissene Musik, ist mir, als bliebe jetzt nichts als Leere. Und ich fülle sie mit einem nächsten Pettersson-Stück. Man kann das, ohne den Komponisten zu wechseln, bald sechzehn Stunden hintereinander tun, nur mit seiner Sinfonik. In einem sehr bestimmten Sinn ist Pettersson wahrscheinlich der eigentliche Erbe Gustav Mahlers. Seine Sinfonien, ab der Nummer 2, schließen je nahtlos aneinander an, abgesehen von der letzten vielleicht, der 16., die eigentlich ein Altsaxophon-Konzert ist. Es ist eine unausgesetzte, sich immer wieder in Lustmomente erhebende Klage-Musik, ein Lamento. So hat er selbst sie auch beschrieben. Dieses Kalenderblatt über ihn hängt bei mir rechts neben dem Schreibtisch an der Wand:  In dem Milieu, in dem ich aufgewachsen bin, habe ich den Schmerz der Menschen verinnerlicht. Es waren arme, zerlumpte, kranke und vor allem restlos unterdrückte Menschen. Aus dieser Situation entstand in mir ein tiefes Empfinden, zunächst unbewußt, dann bewußt, und schließlich ein sich nach außen dränkendes starkes Gefühl, das sich nach und nach in ein tiefes Ausdrucksbedürfnis verwandelte. Ich habe nie in den Kreisen gelebt, in denen man vom veritablen „Schaffen“ sprach. Ich kannte all die „brennenden“ Probleme nicht und lebte „von meinem eigenen Ausgangspunkt“ aus. Ich war das, was ich einen Unschuldigen nennen möchte. In dem Milieu, in dem ich aufgewachsen bin, habe ich den Schmerz der Menschen verinnerlicht. Es waren arme, zerlumpte, kranke und vor allem restlos unterdrückte Menschen. Aus dieser Situation entstand in mir ein tiefes Empfinden, zunächst unbewußt, dann bewußt, und schließlich ein sich nach außen dränkendes starkes Gefühl, das sich nach und nach in ein tiefes Ausdrucksbedürfnis verwandelte. Ich habe nie in den Kreisen gelebt, in denen man vom veritablen „Schaffen“ sprach. Ich kannte all die „brennenden“ Probleme nicht und lebte „von meinem eigenen Ausgangspunkt“ aus. Ich war das, was ich einen Unschuldigen nennen möchte.
*)
Und mal wieder eine Fußnote zum Urheberrecht:
Vielleicht ist das Stück aber auch anderweitig zu bekommen, bei ebay vielleicht oder über eine der Tauschbörsen im Netz. Daß letzteres als illegal angesehen wird, zeigt wieder einmal, wie verhindernd die kapitalistische BesitzstandsWahrung gegenüber kulturellen Errungenschaften ist: indem das Urheberrecht Kunst als Ware definiert und an veräußerbares Eigentum bindet , behindert es zumindest in wesentlichen Einzelsegmenten die Identität einer ganzen Kultur. albannikolaiherbst - Montag, 5. September 2005, 12:50- Rubrik: MusikDesTagesFuerEB
Das Schmerzempfinden als Garant für Autonomie - wenigstens gegenüber dem eigenen Körper. Wenn jede andre schon versagt.
(CCCXXXI).
albannikolaiherbst - Dienstag, 6. September 2005, 14:09- Rubrik: Paralipomena
Eine der größten Schwierigkeiten, vor denen künstlerische Innovationen stehen, findet sich in dem Umstand, daß sie entweder sehr früh - gleichsam sofort - oder eben, wenn überhaupt, dann nur sehr zäh die Achtung erhalten, die ihnen gebührt. Für die sehr frühe Akzeptanz stehen Dichter wie Beckett, in gewissem Maß auch Grass, dessen Ruhm fast ganz von der Blechtrommel herrührt; seine späteren Werke haben sich, völlig unerachtet ihrer oftmals ebenbürtigen Qualtität, von diesem Frühruhm genährt. Es ist gleichsam, als könnte ein einmal errungener Ruhm nicht mehr zurückgenommen werden, und zwar auch dann nicht, wenn eine massive Lobby das versucht. Man denke in Grassens Fall an die ungeheuren Verrisse, die sich nicht wenige seiner nachherigen Bücher eingehandelt haben: ob zu Recht oder Unrecht, spielt da gar keine Rolle. Hätte sich aber der Mann gleich zu Anfang weniger sozialdemokratisch moderat, sondern einem ungesitteten Büchner gleich geriert, in dessen Namen heute gesittetste Juroren allergesittetste Literaturen preisen, die Sache wäre anders ausgegangen.
Die Schwierigkeit für radikale Literatur besteht darin, daß sie einerseits über derart Gesittetes hinweg, ja es attackieren muß, zugleich aber doch,um zu überleben, einen wenigstens ökonomischen Erfolg braucht. Wer nicht wie Beckett von allem Anfang an zum main player wurde, ist ständig zwischen Korruption und - aus Notwehr - hochfahrendem Querulantentum aufgespannt, das diese Korruption verhindern soll und auch tatsächlich verhindert, allerdings um den Preis nicht nur ökonomischer und sozialer Ausgrenzung, sondern vor allem auch privater Schuld und Verschuldung
Dagegen steht eine Literatur, die zur besten gehört und dennoch möglichst wenig bewegen will. Sie ist im tiefsten human und scheut das Radikale; allerdings das Leben auch. Sie steht in der Ecke und beobachtet und notiert und findet die stilvollsten Sätze für ihre Beobachterei. Ihre Grammatik begehrt niemals auf, die Syntax ist immer im feinsten „das tut man nicht“ widerstandsfrei aufnehmbar, sozusagen „vornehm“ und bereits zu Lebzeiten akademisch. Meist feiert sie still ihre Melancholie. Manche, wie Grass, brachten es niemals dahin; nicht einmal ihr Ruhm hat ihnen geholfen. Das muß man an ihnen ehren. Selbst Beckett schaffte es nicht, und es wird auch – was immer man gegen ihn vorbringen mag – Rainald Goetz nicht gelingen. Denn in solchen wirkt etwas provozierend-unruhig Döblinsches, das sich mit Honorarprofessuren schlecht verträgt.
[Altblog-Notat, 5.Juni 2004.] albannikolaiherbst - Dienstag, 6. September 2005, 11:52- Rubrik: Altblog
Kleine Kinder zu drillen, ohne ihnen zu erklären, weshalb das nötig sei, unterfordert sie. Jede Form von Disziplinierung braucht einen ihrer Intelligenz verständlichen Grund. Stattdessen zu sagen „weil es Vorschrift ist“, beugt die kleinen Schüler auf Pisa. Dasselbe gilt für „das tut man nicht“. Dahinter steht immer der Wille, das fremde Eigene zu brechen. Ach, wie vergeblich tun sie recht daran, wenn sie dagegen revoltieren!
albannikolaiherbst - Dienstag, 6. September 2005, 07:52- Rubrik: Schule
Sehr bewußt wähle ich >>>> im direkten Anschluß an Pettersson heute einen anderen Außenseiter, der nicht weniger als jener über lange Zeit vom Musikbetrieb ignoriert und ausgegrenzt wurde, diesmal allerdings nicht wegen eines Rückgriffs auf ‚überkommene’ tonale Strukturen, sondern eher ganz im Gegenteil, weil er versuchte, in Mikrobereiche musikalischen Ausdrucks vorzudringen, weil er damit eingehend experimentierte... was für den Mann ein völlig falsches Wort ist. Vielmehr hat er sich in die Klänge versenkt. So nannte er sich denn eher ein Medium denn einen Komponisten. Und niemals erlaubte er, daß öffentlich ein Bild von ihm gezeigt wurde. Er signierte stets mit einem griechischen Omega. Schlimmer war aber, daß er weitgehend ein Autodidakt war, von dem es bisweilen hieß, er halte sich „Ghostwriter“, um seine obendrein sich fast jeder kompositionstechnischen Analyse entziehenden Partituren zu realisieren. Den begüterten Aristokraten Conte Giacinto Francesco Maria Scelsi d'Ayala Valva mußte die Ablehnung allerdings nicht scheren; sein Vermögen ließ die Baseballschläger-Hiebe so ungetroffen wie ungerührt von ihm abprallen, mit denen der Kunstbetrieb so gerne auf alles losprügelt, was vor seinem dumpfen Stallgeruch die Nase rümpft.
Nach Asien-Reisen und einer offenbaren Beeinflussung durch fernöstliche Philosophie, sowie nach einer schweren Krankheit fand Scelsi seit den Fünfziger Jahren des Zwanzigsten Jahrhunderts zu einem unverwechselbaren, alle Kategorien sprengenden höchst meditativen Stil. Man hört ‚einen Scelsi’ sofort aus Hunderten anderer Musiken heraus, ganz ähnlich wie Allan Pettersson. Beide sind die zwei Seiten derselben Münze Kunstmusik, die die Suche nach tiefer Harmonie mit ins Extremste gesteigertem Ausdruckswillen zu vereinigen sucht.
>>>> Giacinto Scelsi: Anahit. Lyrisches Poem über den Namen der Venus. 1965. Für Violine solo und 18 Instrumente.
Rome is the boundary between East and West. South of Rome, the East starts, north of Rome, the West starts. The borderline runs exactly through the Roman Forum. There is my house: This explains my life and my music.
albannikolaiherbst - Mittwoch, 7. September 2005, 16:16- Rubrik: MusikDesTagesFuerEB
Michael Kleeberg verfaßte im Juli oder August 2000 in „Die Welt“ einen Aufruf des Inhalts, es mögen sich die Schriftsteller Deutschlands, vielleicht in einer Art Manifest, zu den neuen Rechtsradikalen äußern und gegen sie öffentlich zusammenschließen. Nach einem Gespräch mit dem Redakteur Tilman Krause habe ich auf Kleebergs Aufruf reagiert; meine „Antwort auf Michael Kleeberg“ erschien im August oder September 2000, ebenfalls in „Die Welt“. Als ich bei Durchsicht meiner theroetischen und polemischen Arbeiten neulich darauf stieß und ihn noch einmal las, fand ich, er habe von seiner Aktualität auch in poetologischer Hinsicht wenig verloren. Deshalb mache ich den kleinen Brief-Aufsatz nunmehr über >>>> die fiktionäre Website wieder zugänglich.
albannikolaiherbst - Mittwoch, 7. September 2005, 16:04- Rubrik:
Dolly II hatte nun offensichtlich wieder solch einen Trauertag hinter sich, und es stand, kehrte Broglier später heim, eine ähnliche Szene zu erwarten. Die Holomorfin hatte versucht, sich innerlich darauf vorzubereiten, ja dachte sogar, als Willis in die Küche abschob, ein wieviel besserer Mann der für sie wäre. Aber gegen ein so unbedingtes Gefühl wie Liebe kommt der Verstand nicht an: niemandes - es sei denn, er sperrt es in eine gangliose Kammer weg, wo es dann im durch die Schütte herunterfallenden Streulicht zu verkümmern anfängt und schwächlich, doch seinerseits vernünftig wird, man muß so ein fauliges Dasein schließlich aushalten können: überall Kohlen, aber nirgendwo Feuer. So daß die Liebe ganz blaß im Gesicht wird und heimlich die krisseligen Bätzchen ihres hinausgehüstelten Lebensbluts ins Taschentuch spuckt. Dolly II, noch immer ohne Bewegung im Flur, tat das durch die Augen. Bei Willis nahm sie auch kein Taschentuch vor. So daß er, aus der Küche zurückkehrend und von einem Mitleid ergriffen, das er bei bestem Willen nicht länger untätig sein lassen konnte, in seinem Entschluß nur noch bestätigt war. Er wußte, was nun geschähe, wußte, daß Dorata, erst einmal in seinem Arm, von neuen Heulkrämpfen geschüttelt würde und dabei, aus Mund und Augen völlig verspeichelt, das immer- und immergleiche erzählen bejammern – wieso programmierte Broglier sie nicht einfach um, wieso erlöste er sie nicht endlich? Welch ein Sadismus das war! Seinerseits, das wußte Willis natürlich, er wäre sonst nicht mit Broglier befreundet gewesen, aus trauernder Hilflosigkeit; Sadismus aber eben doch.
>>>> ARGO 143
ARGO 141 <<<< albannikolaiherbst - Mittwoch, 7. September 2005, 09:31- Rubrik: ARGO-ANDERSWELT
albannikolaiherbst - Donnerstag, 8. September 2005, 15:08- Rubrik: MusikDesTagesFuerEB
An die gesellschaftliche Bedeutung erzählender Literatur in ihrer komplexen Form als Kunst, obendrein im überkommenen Printmedium Buch, schon lange nicht mehr zu glauben und dennoch Schönheit, Aussagekraft und Vollendung des Romanes leidenschaftlich vorantreiben zu wollen. Gegen jeden Widerstand und das eigene bessere Wissen.
[Poetologie.] albannikolaiherbst - Donnerstag, 8. September 2005, 09:31- Rubrik: NOTATE
Grundschule Gleimstraße. Schulhof. Nachmittags.
Die aufsichtführende Frau ruft die Kinder zusammen, darunter einen kleinen schwarzen Jungen, der ein wenig bummelt. Er hat kurzes krauses Haar. „Nu mach ma zu, Löckchen!“ ruft die Frau. Als der Kleine nicht reagiert: „Ich hab dir gesagt, du sollst dich etwas beeilen..." und wiederholt's: " du Löckchen!“
Daraufhin ich, mein Fahrrad an die Wand schließend und mich zu dem Jungen umwendend: „Also ich an deiner Stelle würde antworten: Ich komm ja schon, Röckchen!“
Erstaunter, leicht angegifteter Blick der Frau auf mich.
Da lachen die Kinder in heller Gerechtigkeit und jubeln immerfort: „Löckchen, Röckchen, Löckchen, Röckchen!“
Schon ist der Trupp im dunklen Eingang die Treppen hinauf verschwunden.
albannikolaiherbst - Freitag, 9. September 2005, 16:18- Rubrik: Schule
Halten Sie sich also vor Augen, daß Sie Teilnehmer eines Versuchsmodells mit offenem Ausgang sind, und zwar einen Wirkzusammenhang betreffend, dessen Daten, soviel wir im speziellen der drei Modelwelten inzwischen auch ansammeln konnten, ausgesprochen reduziert sind. Denn die Realität, was eine potentielle Realität meint, ist ungleich komplexer und in ihrer gesamten Vielheit sehr wahrscheinlich prinzipiell unerfaßbar.
Ja bitte? – Jaja, bringen Sie den Kaffee rein... wenn es denn sein muß.
- Also.
Worauf es ankommt, das ist der Umstand, daß für die sagen wir Figuren unserer Modellwelten ihre Modellwelt so absolut real ist wie für Sie dieses hiesige Stuttgart. Deshalb wiederhole ich meine Meinung, daß die Avatare leben. Ihr Schmerz ist wirklich, ihre Bedürfnisse sind wirkliche, ebenso ihre Ängste und ihre Krankheiten, auch wenn jetzt Sie, weil Sie infoskopische Zeugen einer Simulation wurden, immer noch denken: Kann der sagen, was er will, wir wissen, was real ist. Da macht uns keiner ein U für ein A vor, und sozusagen hätten Sie nichts als einen Film gesehen, für deren Darsteller gilt: ‚Das ist ja nur gespielt.’ Dem genau ist eben – für sämtliche Ihnen vorgeführten Personen – n i c h t so, weder für die Hundsgötter noch die Landshuter Amazonen, noch für den Polizisten Marcus Goltz. Und eben auch nicht für Eckhard Cordes, der vermutlich seinerseits immer noch meint, mit seinem kleinen Sohn und dem Jungen des Freundes im Technikmuseum Berlin zu stehen und den beiden die Nebelkammer als sein Erzähl- und Erkenntnismodell vorgestellt zu haben. Tatsächlich ist es ein sehr gutes Modell, wenn wir es einmal von seiner naturwissenschaftlich-apparativen Primitivität und unseren kybernetischen, bis eben Ihre Imagnationen auslösenden Geräten auf unsere ganze Welt und damit auch uns selbst übertragen. Und wenn man das faktisch - als reales Fakt des Daseins - tut. Wobei mich Cordes’ Erzählwahn nicht so sonderlich oder nur insofern interessiert, als auch er realitätsmodifizierend und realitätsändernd auf die anderen Welten und fortan vielleicht sogar die unsere, von ihnen als einzig wirkliche so hervorgehobene ausstrahlt. Es stehen nämlich w i r an dieser Nebelkammer und blicken hinein. Was wir dabei übersehen und was Sie sich nicht vorstellen können, das ist die gigantische Nebelkammer, in der wir selber uns befinden und in die vielleicht in genau diesem Moment a n d e r e Probanden hineinsehen und ihrerseits u n s für imaginierte Darsteller und also auch u n s e r e n Schmerz und u n s e r e Nöte für simuliert halten. Wir haben, um Ihnen zu verdeutlichen, wie weit unser Experiment unterdessen ins Neuland vorgestoßen ist, sowohl Herrn Deters als auch Herrn Cordes mit der Fähigkeit ausgestattet, uns zu denken: das bedeutet, daß in beide Avatare ohnedies schon die Möglichkeit einprogrammiert worden ist, daß sie sich nicht nur uns vorstellen, sondern annehmen können, wir seien ihre durch ihr Bewußtsein manipulierbare Erfindung. Aus dem Vorherigen folgt: Daran kann etwas sein. Ganz unabhängig von dem Training, das Sie heute und in den folgenden Tagen absolvieren, dürfte sich also längst ein Kontakt und damit die Einflußnahme auf uns alle in Gang gesetzt haben. Wobei wir der Herren Deters und Cordes Gedankengänge vorführen können; insofern sind wir auf etwaige Entwicklungen vorbereitet. Es ist aber, meine Damen und Herren, nicht von der Hand zu weisen daß eine solche Fähigkeit potentiell in s ä m t l i c h e n anderen Personen der drei Modellwelten veranlagt ist oder doch signifikant vielen weiteren. Wir könnten es, falls das stimmt, nur nicht direkt verfolgen, weil keine abbildbaren Zugänge zu deren Psychen bestehen, jedenfalls noch nicht.
>>>> ARGO 144
ARGO 142 <<<< albannikolaiherbst - Freitag, 9. September 2005, 14:48- Rubrik: ARGO-ANDERSWELT
Ich bin mit einer Freundin oder Geliebten, jedenfalls Frau, irgendwo eingeladen. Wir sind nicht intim, aber intensiv miteinander. Zugleich sind wir distanziert. Ich weiß jetzt, während ich schreibe, nicht mehr, wer es ist; ich hatte es bereits vergessen, als ich aufwachte. Der Erzählung halber will ich sie Lan nennen. Ihr Gesicht ist völlig unsichtbar nun: als ich träumte, war es das nicht, sondern wir sahen uns oft, sehr oft, an. Nach der Gesellschaft, einer Art festlichen Abendgesellschaft, von der ich a u c h geträumt habe, aber an die ich mich nicht mehr konkret erinnen kann, will Lan mich nach Hause fahren und erzählt von ihrem neuen Auto, einer Art Oldtimer in High-Tech-Version. „Ein australisches Auto“, sagt sie, ich erinner mich genau. „Oh“, rufe ich aus, „sowas würde ich gerne mal selber fahren.“ „Das kriegen wir hin“, sagt Lan. Die Straße schillert in der Nacht wie von Nässe, es ist aber trocken; das Dunkel ist gleichsam farbig, derart leuchtet es. Manchmal gibt es diese irre Realität von Farben in Spielfilmen, etwa in >>>> Lynchs „Blue Velvet“: völlig, fast überwältigend, da.
Als wir die Fahrertür öffnen (das Gefährt ist trotz seines LimousinenCharacters zweitürig; sehr hochgebaut im übrigen, fast wie ein englisches Taxi; die Sitze haben hohe lederne Sessellehnen), sitzt drinnen ein blasser, hochgewachsener Mann in einem Anzug vom demselben tiefblauen Schwarz, mit dem das ganze Auto lackiert ist. Das schmale Gesicht trägt auf Wangen, Kinn und Hals den Schatten eines rasierten dunklen Bartwuchses.
Noch etwas ist ungewöhnlich: der Mann sitzt nämlich vorne rechts, und links neben ihm gibt es gar keinen Sitz, sondern für die Passagiere hat der Wagen nur noch die sehr breite, von einem poliert schimmernden schwarzen Nappa bezogene Rückbank. Mindestens fünf Leute fänden darauf Platz. Lan stellt mich dem Mann, er heiße John, vor und bittet ihn, doch zur Seite zu rücken, i c h wolle den Wagen steuern. Keine Ahnung, wohin er rücken soll. „He never did it before“, erklärt ihm Lan; alle Dialoge zwischen ihr und ihm und fortan uns werden auf Englisch geführt, John kann gar kein Deutsch. Er rückt auch wirklich zur Seite, ohne daß sich das räumlich erklären ließe. Lan steigt nach hinten ein, ich setze mich links vorne auf den nicht vorhandenen Sitz. John erklärt mir zweidrei Funktionen, ich lasse den Wagen an, wir fahren in die ziemlich leere glitzernde Nacht.
Doch keine zweidrei Kilometer weiter geraten wir in einen Stau. Einer von uns kommt auf den Gedanken, links hinauf auf einen fly over auszuweichen, was ich auch tue. Kaum sind wir auf der Straßenrampe, kommt uns ein Lastwagen entgegen, obwohl dieser fly over ein Autobahnzubringer und also Einbahnstraße ist. Ich kann gerade noch ausweichen, es wird dröhnend gehupt, hinter uns biegen weitere Wagen herauf, aber weitere Fahrzeuge kommen uns auch entgegen der Fahrtrichtung entgegen. Man hat den Eindruck von Leuten, die in ihren Gefährten flüchten. Oben auf dem Highway beruhigt sich die Lage allerdings. Jetzt bin es aber nicht mehr ich, der fährt, sondern John; ich selbst sitze jetzt auf der Rückbank neben Lan. Es gibt auch vorne wieder den Fahrersitz, denn nun wird der Wagen links gesteuert. Er ist insgesamt sehr zusammengeschrumpft; in der Passagierkabine ist es auf Berührung eng. Ich muß meine Knie auseinanderspreizen, wenn ich zwischen der Rücklehne des Fahrersitzes vor mir und der Lederbank, auf der ich sitze, irgendwie Platz für meine Beine finden will. Einmal halten wir, vielleicht um uns zu orientieren, und John dreht sich herum, sein rechter Arm, während er mit Lan spricht, ist, lässig eingewinkelt, oben auf die Rücklehne seines Sitzes gelegt. Einmal rutscht der Arm herunter, da hängt er, ebenso lässig, zwischen meinen Beinen. Mir ist das unangenehm, ich will dem Mann nicht so nah sein. „Something wrong?“ fragt er. „All’s okay“, antworte ich, „but you hand is lying on my cock.“ Anstatt sie zurückzuziehen, fangen Lan und er zu lachen an, und er läßt seine Hand einfach liegen.
Wir fahren weiter. Mit einem Mal wird der Verkehr wieder dicht, wir geraten in eine Straßensperre der Polizei. Ein Beamter in grüner Uniform, den weißen Helm auf dem Kopf, dessen Visier herabgelassen ist, röhrt mit Motorrad die angehaltenen Autos entlang und ruft was. Als er uns passiert, harrscht er durchs von John heruntergelassene Autofenster: „Get out! Immediately! All!“
Verwirrt folgen wir. John, der auf mich vorher so schrecklich unheimlich gewirkt hatte, hat nun deutlich Angst. Lan hält alles für einen Witz. Sie lacht dauernd. Ich bin nur beklommen, fast fühllos. Wir werden von anderen Polizisten mit weiteren AutoInsassen zusammengetrieben und als Menge auf ein Feld gescheucht. Auf diesem Feld sind überall kleine, von hölzernen Zwischenwänden dreigeteilte Unterstände an in den Ackerboden gerammten Pfählen errichtet, dahinter gibt es eine Art Bierzelt: beflaggt leuchtend, voller Masken und anderem Kirmesschmuck. Man hört laute ausgelassene Musik: Tompeten, Tschinellen, Pauken. Wie Zirkusartisten verkleidete Leute rennen herum, enorm viel Polizei rennt herum: wir „Neuen“ werden gemustert und zu jeweils den Unterständen eingeteilt, wo wir warten müssen. Lan wird von John und mir getrennt, ich sehe sie nicht wieder. Eine Art Karnevalszug fährt vorüber: auf den Emporen der Wagen tanzen vor allem Frauen, die mit Federn geschmückt sind und Waffen halten: lange Messer und Degen. Dazwischen sieht man Leichenwagen mit toten, völlig blassen, aber zum ewigen Schlaf schön hergerichteten Personen. Man hat ihnen, das ist deutlich,das Blut ausgesaugt. Sie sehen alle aus und sind auch so drapiert wie >>>> Millais' “Ophelia“. Der Karnevalszug fährt ins Jenseits. John und ich stehen eng beieinander, er zittert, einmal weint er sogar. Ich denke an Flucht, bin hochgradig aktiv, sichere die Gegend usw. An das Feld grenzt ein tiefschwarzer, ich möchte sagen: s c h w e r e r Wald. Da muß man doch irgendwie hinkommen! Wir können entfernt, ihm gegenüber, die Autobahn sehen, hören die Sirenen der Martinshörner, sehen das rotierende Blau der Polizeilichter, immer weitere angehaltene Wagen, weitere Menschen, die in Trauben hergetrieben werden. Ein Schlachtfest, denke ich, „F e s t“ im Wortsinn, una festa, une fête. Die Stimmung bei den Schlächtern ist großartig, die Opfer wimmern, regen sich kaum in ihren Unterständen. Alle sind wie ergeben in ihr Schicksal. Ein neuer Karnevalszug mit Leichen rollt johlend und tanzend und Flaschen schwenkend vorüber. Da verstehe ich, daß man den gefangenen Menschen mit ihrem Blut die Seele nimmt: Sie werden in ein Zwischenreich abtransportiert, nicht Himmel nicht Hölle, sondern ein ewiges, blindes Warte-Reich der Stummheit. Irgendwie muß ich hier weg. Aber es kommt ein Polizist in Uniform und verhört uns, danach lacht er uns aus. Völlig entehrt stehen wir da. Andere Polizisten kommen; ich glaube, wir werden geschlagen. Mich stimmt das aber nur n o c h aktiver, rasend denke ich. John weint wieder. Lan ist so sehr weg, daß man meinen könnte, es habe sie nie gegeben. Ich denke auch gar nicht mehr an sie. (Jetzt, da ich dies protokolliere, habe ich mit einem Mal den Eindruck: es war s i e, die uns den Umweg über den fly over empfahl, sie wußte Bescheid, sie gehörte ‚dazu’. Aber das ist eine rein assoziative Spekulation.)
Horden tanzender Frauen, von Polizisten irgendwie geleitet, kommen in feiernden Grüppchen aus dem riesigen, aber flachen Zirkuszelt heraus und verstreuen sich über das Feld. Sie tragen teilweise Masken, teilweise aber nichts anderes als diese farbigen Straußen- und Pfauenferden. Musiker sind bei ihnen und spielen auf. Bisweilen nähern sich die Grüppchen den bangenden Gefangenen in ihren Unterständen, bisweilen wird jemand erstochen, dann umringen ihn die Feiernden und tragen ihn zur Blutentnahme weg. „Niemals alles trinken!“ höre ich. „Mixt das mit Limonade. Das schmeckt sehr viel besser.“ Eine Frau schüttelt ihre Sprudelflasche wie einen bar shaker John hat sich derweil an sein Handy erinnert, in einen Schatten gebeugt seh ich ihn telefonieren: Er spricht flüsternd rasend, immer wieder wirft er den Kopf herum, um zu schauen, ob’s jemand merkt. Ich weiß, daß er der nächste ist, den man töten wird. Er hat überhaupt keine Chance. Und ich ducke mich und schleiche in Richtung auf eine Schattenspur, die zu dem Wald führt. Sichere mich, schleiche weiter. Dann laß ich mich ganz auf den Boden herunter, wie ein Tier, das, den Bauch eng am Boden, davonhuschen will. Ich komme heil in den Schatten hinein und robbe über den Ackerboden, verharre, seh mich immer wieder um, niemand scheint meine Flucht zu bemerken. Ich robbe, wie ein Späher im Feld weiter. Der trompetendurchstoßene Lärm hinter mir – die Zirkusmusik, das Gegröle, das Feiern, die Schreie der Sterbenden, die Jubelrufe der Frauen, die Martinshörner von der Autobahn, die harrschen Befehle der Polizisten – wird immer leiser. Noch leiser. Fast bin ich schon an den Wald heran – da erwache ich. albannikolaiherbst - Samstag, 10. September 2005, 08:41- Rubrik: Traumprotokolle
Kumani hatte zum ersten Mal in seinem Leben das Bedürfnis, sein Programm auszuschalten. Kein freier Holomorfer hätte das aber jemals getan. Das war schon eine Sache des Stolzes. Mit dem dann auch Dolly II konfrontiert wurde, so daß sie die Widerstandsbewegung schließlich wieder verließ: ihrer bald anbrechenden Liebe zu Willis wegen; es war ihr ein Bedürfnis, in Liebesdingen zu dienen, das war mit einer auf Waffengewalt gestellten Emanzipationsbewegung, der sie so unversehends angeschlossen war, in keiner Weise zu vereinbaren. Denn selbstverständlich programmierte kein Myrmidone sie u m bzw. nur ein wenig, indem man sie von dieser völlig sinnlosen, die Frau derart auszehrenden Fixiertheit auf Broglier befreite. Der Character selbst ward nicht angerührt. Und der wollte lieben, nichts als lieben, er war für Waffen nicht bereit. Darin klang ein Satz nach, den einst eine der Landshuter Harines, Leagore nämlich, ausgesprochen hatte: „Wir sind um die Liebe geschaffen, nicht für den Tod gemacht.“ Auch das war ein Stolz gewesen, war nun Dollys II Stolz. Deidameia entsann sich sehr wohl. Alleine deshalb ließ sie diese Neue trotz des Sicherheitsrisikos schließlich ziehen. Es waren nur die Menschinnen, die ihre Entscheidung verstanden. Für die freien Holomorfen des Widerstands blieb Dolly II fortan geächtet; auch das nahm sie auf sich. Wenn Willis schließlich mit den anderen Argonauten hinausfährt und das ins Chaos zurückgeworfene Europa verlassen wird, trägt er die heimlich Geliebte in ihrem Selbstprojektor bei sich. Doch dessen Batterien sind bald erschöpft. Deshalb löst sich die Frau wie eine andere, eine märchenhafte, die ebenfalls liebend dienen wollte, auf: und metaphorisch in Meerschaum. Aber das gehört schon ins Ende, liegt jenseits des Endes, weshalb es eigentlich nicht erzählt werden muß. Nur sollte uns klarsein, daß alledie Holomorfen, die sonst noch mitgehen werden, auch Kumani, ihr Leben dann nur für eine sehr begrenzte Zeit noch in den Dienst der Sache stellen können. Wer dies weiß, kann ungefähr die Tragik Deidameias begreifen, deren Geschichte, letztlich, eine der Trennungen-ganz-und-gar ist. So daß wir so viele Hunderte Seiten nachher endlich verstehen, weshalb einst eine Mandschu nicht gewollt hat, daß ihre Äbtissin, diese hübsche Frau mit den zarten Fußgelenken, in den aktiven Dienst kam: die eine Führerin hatte die andre vorausgespürt und sie wirklich bewahren wollen.
>>>> ARGO 145
ARGO 143 <<<< albannikolaiherbst - Sonntag, 11. September 2005, 18:05- Rubrik: ARGO-ANDERSWELT
Aus der geöffneten Tür zu Lager und Büro erklingen in Abständen die Haltestellen-melodischen Signale der Yamanote-sen. Verwirrt bleibe ich mitten in Berlin in Tokyo stehen. In einem Billig-Discount. Als hätt ich stundenlang gekifft. Dann setzt überlaut ein Telefon ein: eine unentwegte heftige Schrille, die das Psychotische dieser Situation noch unterstreicht, denn wirklich: es ist das Signal aus Tokyo.
Gewiß zehn Minuten nimmt niemand dieses furchtbare Telefon ab, obwohl drei Angestellte in ihrem gelb beschrifteten Orangerot sehr nahbei sind. Ich stehe da und warte. Bin wie fixiert. Sie lassen sich ebenfalls nicht scheuchen. Aber sie merken nicht, was mich momentan so sehr lähmt: die Anderswelt auf dem Prenzlauer Berg. Sie ist tatsächlich da. Und gleich gegenüber das gestern nacht in ein Wiesbadener Kybernetik-Labor verwandelte Planetarium.
[Notat 12.9., Penny, Ecke Ahlfelder/Prenzlauer.]
>>>> ARGO 146
ARGO 144 <<<< albannikolaiherbst - Montag, 12. September 2005, 20:58- Rubrik: ARGO-ANDERSWELT
Willst du mir drohn? Mir, einem W e i b e, drohn?
In ARGO hineingesungen: [Du wilde Seherin, wie willst du doch/geheimnisvoll den Geist mir neu berücken?] Das sich wehrende Matriarchat. Das lockende. Das mit den Pfeilen. Eine späte, nicht länger offne Penthesilea: Wagners Ortrud im Lohengrin. Politik ist in die Frauen gekrochen und hat die Schwestern intrigant durchsetzt.]
albannikolaiherbst - Montag, 12. September 2005, 15:33- Rubrik: FrauenundMaenner
„Weil die höchste Lust da ist, wo die G e f a h r am größten wird; dort auch wird Liebe am intensivsten. Einer Frau, die ich liebe, verzeihe ich a l l e s: ob sie mich und ich sie gegenseitig in unserer Existenz bedroht haben, gleich ob seelisch oder körperlich, ob sie mich genötigt hat, ob ich sie geschlagen habe oder sie mich oder wir einander, ob wir mit Messern aufeinander logegangen sind, ob wir uns mit Worten häßlichste Wunden beigefügt haben... das ist alles, alles egal und letztlich bloß Brennstoff für die Flammen einer solchen Leidenschaft: N i c h t egal aber ist der Liebe – und das verzeiht sie auch nicht, sondern ahndet es unnachgebig mit Ödnis, Depressionen und Trennung: pragmatische N o r m a l i t ä t, also Distanz und Uneigentlichkeit.“
[*): Titel eines Gedichtbandes von Louis Aragon.] albannikolaiherbst - Montag, 12. September 2005, 12:44- Rubrik: FrauenundMaenner
Unter schallendem Lachen brachte Katia ihr Baby zur Welt; sie lachte und lachte, die Bauchmuskeln preßten. Es war eine überaus schnelle Geburt, wie ein geölter Pfropf kam das Kleine, in den Mantel der Placenta eingeschlagen, herausgeflutscht. Doch als man der jungen Mutter den Säugling zwischen die Brüste legte, wischte sie ihn weg wie einen Flusen. „Dieses Kind ist ein Witz“, sagte sie. Als sie sich später - und auch das eher widerwillig - den ihr von einer Schwester hingehaltenen Säugling kurz betrachtete, brach sie abermals in dieses junonische Gelächter aus. „Schafft mir bloß dieses greise Ding aus den Augen!“Und hielt sich den zuckenden Bauch, weil der schmerzte: so sehr lachte sie weiter. Daran, nicht etwa von der Geburt erschöpft, fiel sie endlich in Schlaf. Da war es bereits halb elf Uhr nachts.
albannikolaiherbst - Dienstag, 13. September 2005, 18:12- Rubrik: PROJEKTE
Es muß also Herbst sein. Wenigstens dort, wo traurige Frauen von uns wissen.
Nicht wenige Musiken, die mich unmittelbar prägten und die ich nie aus mir verlor, deren Klang gewissermaßen unentwegt präsent ist, und sei es nur im stillen – nicht wenige solche Musiken werden durch Zufälle ‚entdeckt’, etwa im Radio gehört, und man weiß einfach nicht, was es war. Also beginnt man zu recherchieren, schaut in die Rundfunk-Programmzeitungen, ruft bei Redakteuren an, wird endlich fündig, besorgt sich eine Aufnahme des Stücks... – und dann ist die ganz falsch und hat keinen Klang mehr, die ganze Seele ist weg, welch ein Schmock! rufst du aus. Und plötzlich wird das Stück wiederholt, und man hört es erneut, und wieder hebt es einem auf der flachen Hand das Herz bis zum Hals:
>>>> Frank Martin, Die Weise von Leben und Tor des Cornets Christoph Rilke nach R.M. Rilke. Aus den Jahren 1942/43. Gesungen von Marjana Lipovsek. Unbedingt.
Und der Mut ist so müde geworden und die Sehnsucht so groß.
albannikolaiherbst - Dienstag, 13. September 2005, 16:53- Rubrik: MusikDesTagesFuerEB
Jedenfalls zischte Jason in fast demselben Ton ein „Scheiße!“ wie im SANGUE sein Dietrich von Bern, also Kalle. Dann rannte Jason in sein Zimmer, schrieb sogar einen Entschuldigungsbrief, sandte ihn übers Netz, aber erhielt keine Antwort. Und verließ nun das Zimmer nicht mehr. Man hätte ihn anderthalb Wochen später für eine jugendliche Versuchs- und Frühausgabe Kignčrs’ halten können, weil er sich irgendwann nicht mehr wusch und auch nicht mehr rasierte. Nicht einmal ein entferntes Zeichen war aus Pontarlier gekommen. Jasons Instinkt war von dieser Stille ganz aufgescheucht. Zu recht. Allerdings konnte der junge Hertzfeld nichts von der Unterredung Michaela Gabriela Annas mit ihrem Vater wissen und ebenso wenig von der Unterredung davor mit ihrer Mutter und nicht, wie eifersüchtig diese, wie angewidert jener gewesen war: Seine Tochter v e r l i e b t! In einen sterblichen Spinner! Er, der Reine, konnte sich nur schütteln. Natürlich hatte ihm die Tochter das so nicht gestanden, sie hatten überhaupt wenig über Jason gesprochen, mehr stattdessen über die Mutter. Und über ihre, Michaelas, Ausfälligkeit Schulze gegenüber. Der Vater verlangte sogar, daß sie sich entschuldigte; das war dem armen Faktotum zum Niedersinken peinlich, Michaela aber so eklig wie dem Vater ihr, Michaelas, libidinöser Zustand. Indessen sagte er gar nichts darüber, obwohl ihm die Spritze schon ganz vorne auf der Zungenspitze lag und beide schrecklich spitz in Tochterrichtung zeigten. Doch zog er, die Lippen zusammenkneifend, erst einmal nichts als seine Schlüsse, vor allem nachdem er etwas später mit seiner Frau gesprochen und sich über ihrerseits d e r e n Mutter-Tochter-Gespräch informiert hatte. „Es dürfte dir klar sein“, sagte er ohne größeren seelischen Aufwand, „daß ich diesen unruhestiftenden Maler nicht mehr in der Villa Hammerschmidt und insgesamt nicht wieder in Pontarlier sehen will. Ich werde entsprechend verfügen. Sollte man ihn hier noch einmal aufgabeln, laß ich ihn in die große Brache deportieren. Sag ihm das bitte, damit er sich dran halten kann. Wenn dir allerdings die Anwesenheit dieses Menschen für deine Veranstaltungen unabdingbar zu sein scheint, dann verlege diese bitte nach Kehl oder nach irgendwohin sonst, jedenfalls in die Zentralstadt. Das wäre mir sowieso lieber. Jedenfalls werde ich nicht zulassen, daß der Weg dieses Menschen auch nur noch ein einziges Mal den meiner Tochter kreuzt. Michaela hat sich auf ihre Prüfungen vorzubereiten; wenn jetzt dein gefühliges Erbteil in ihr durchbrechen sollte, gehe ich aufs entschiedenste dagegen an. Darauf kannst du dich - und könnte ihr beide euch - verlassen.“
>>>> ARGO 147
ARGO 145 <<<< albannikolaiherbst - Mittwoch, 14. September 2005, 19:03- Rubrik: ARGO-ANDERSWELT
|
|
Für Adrian Ranjit Singh v. Ribbentrop,
meinen Sohn.
Herbst & Deters Fiktionäre:
Achtung Archive!
DIE DSCHUNGEL. ANDERSWELT wird im Rahmen eines Projektes der Universität Innsbruck beforscht und über >>>> DILIMAG, sowie durch das >>>> deutsche literatur archiv Marbach archiviert und der Öffentlichkeit auch andernorts zugänglich gemacht. Mitschreiber Der Dschungel erklären, indem sie sie mitschreiben, ihr Einverständnis.
Kontakt ANH:
fiktionaere AT gmx DOT de
E R E I G N I S S E :
# IN DER DINGLICHEN REALITÄT:
Mittwoch, den 5. April 2017
Bremen
Studie in Erdbraun
Mit Artur Becker und ANH
Moderation: Jutta Sauer
>>>> Buchhandlung Leuwer
Am Wall 171
D-28195 Bremen
19 Uhr
Sonnabend, 23. September 2017
Beethovenfest Bonn
Uraufführung
Robert HP Platz
VIERTES STREICHQUARTETT
mit zwei Gedichten von Alban Nikolai Herbst
>>>> Beethovenhaus Bonn
Bonngasse 24-26
D-53111 Bonn
16 Uhr
NEUES
Bruno Lampe - 2017/03/29 19:48
III, 280 - Bei Äskulap
Gegen zwei löste ich mich kurzentschlossen vom Schreibtisch. Es war nichts mehr abzuliefern. Aber die ... Die in einem ...
... Deckenlabyrinth sich mäandernde Inschrift...
Bruno Lampe - 2017/03/28 21:42
Vielhard, Leichtgaard:
albannikolaiherbst - 2017/03/28 07:53
Bruno Lampe - 2017/03/27 20:43
III, 279 - Oder auch nicht
Kühler Nordwind. Die Sicht ging bis zu Sant’Angelo Romano weit unten im Latium. Jedenfalls vermute ich ... Bruno Lampe - 2017/03/24 19:55
III, 278 - Einäugigkeiten und Niemande
Ein Auge fiel heraus, abends beim Zähneputzen. Es machte ‘klack’, und der Zyklop sah nur noch verschwommen. ... Danke, gesondert, an...
bei der sich in diesem Fall von einer "Übersetzerin"...
albannikolaiherbst - 2017/03/24 08:48
albannikolaiherbst - 2017/03/24 08:28
Schönheit. (Gefunden eine Zaubernacht). ...
Es juckt sie unter der Haut. Es juckt bis in die
Knochen. Nur, wie kratzt man seine Knochen?
Sein ... Bruno Lampe - 2017/03/22 19:39
III, 277 - Die Hühner picken
Irgendwas ist schiefgelaufen seit dem 9. März. Man könnte es so formulieren: die Verweigerung der Worte ... ich hör' ein heer...
ich hör’ ein heer anstürmen gegens...
parallalie - 2017/03/21 06:51
Ich höre berittene...
Ich höre berittene Landsknecht sich ballen vorm...
albannikolaiherbst - 2017/03/21 06:18
albannikolaiherbst - 2017/03/21 06:12
James Joyce, Chamber Music. In neuen ...
XXXVI.I hear an army charging upon the land,
And the thunder of horses plunging, foam about their knees: ... den ganzen tag lärmen...
den ganzen tag lärmen die wasser
ächzen schon
trist...
parallalie - 2017/03/18 09:55
Den ganzen Tag hör...
Den ganzen Tag hör ich des brandenden Meeres
Klagenden.. .
albannikolaiherbst - 2017/03/18 08:23
JPC

DIE DSCHUNGEL.ANDERSWELT ist seit 4675 Tagen online.
Zuletzt aktualisiert am 2017/04/01 07:33
IMPRESSUM
Die Dschungel. Anderswelt
Das literarische Weblog
Seit 2003/2004
Redaktion:
Herbst & Deters Fiktionäre
Dunckerstraße 68, Q3
10437 Berlin
ViSdP: Alban Nikolai Herbst
HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Der Autor diese Weblogs erklärt hiermit
ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen
Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle
und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft
der gelinkten/verknüpften Seiten hat der Autor keinerlei Einfluss.
Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten
aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung
verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb
des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für
Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Gästebüchern,
Diskussionsforen und Mailinglisten, insbesondere für Fremdeinträge
innerhalb dieses Weblogs. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen,
haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde,
nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung
lediglich verweist.
|