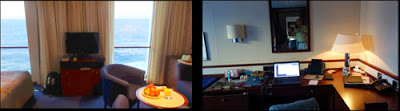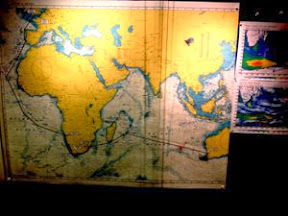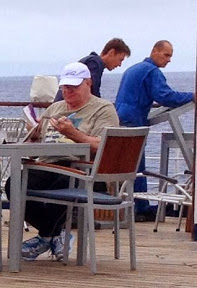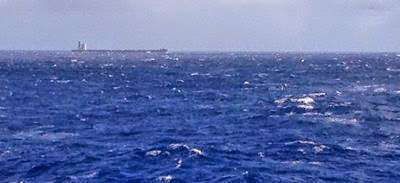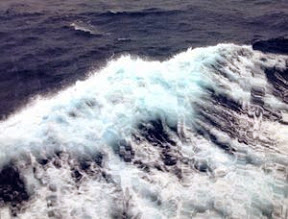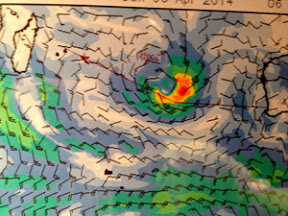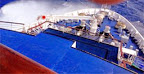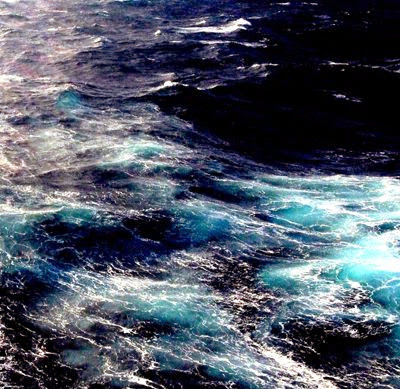|
|
…Du berührst eine meiner
Farben an ihr. Sie ist nicht
ganz da, buchstabiert mit
geschlossenen Lidern, sagt
jeden meiner Namen auf…
read An - Dienstag, 1. April 2014, 21:30- Rubrik: Gedichte
 (Dienstag,
21.52 Uhr.
Ragna Schirmer spielt Johann Sebastian Bach: Goldberg.)Nun bin ich also auf See. Herzliche Verabschiedung im Sundancer, die zehn AUD Schlüsselpfand mochte ich nicht zurücknehmen; man ist ja nicht zum Piefke geboren. Ziemliche Wuchterei des Rucksacks und beider Kleidersäcke, 32 kg, wie ich seit Berlin Tegel weiß, plus all der Technik im zusätzlichen Arbeitsrucksack, ich denk mal: locker 38 kg, insgesamt. Aber meine Achillessehne ließ mich heute morgen sehr zufrieden, freute sich fast, hatt‘ ich den Eindruck, daß sie nicht nurmehr noch mich alleine halten sollte. Wir wachsen mit der Herausforderung.
War auch nicht weit, nur eben die Pakenham St hinein, über die Geleise des kleinen Bahnhofs und noch der allerdings ein wenig dröge Anmarsch seitlich des halben Victoria Quays; schließlich Formularkram in sechs Gruppen, vielleicht auch sieben, ich gehörte zur Sechs. Vorher war das Gepäck abgegeben. Als ich bei meiner Kabine ankam, stand alles schon davor.
Die Tür öffnen - und vor Glück fast vergehen - : 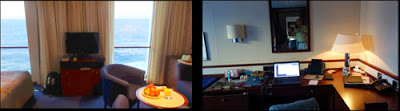 :
Ausgeräumt, als erstes den Arbeitsplatz gerichtet, ich bin da fast zwanghaft penibel, nein, nicht nur „fast“. Dann das übrige aus den Rucksäcken genommen und endlich auch die Anzüge sich aushängen lassen, deren einen ich schließlich anzog: Typenwechsel. (Zum Abendessen selbstverständlich Krawatte, auch wenn ich der einzige Passagier sein sollte, der so etwas trägt.)
Noch war ich mit der Packerei nicht ganz fertig, erklang über Bordlautsprecher die Ansage zur Notfallübung. Jeder nehme sich seine Schwimmweste aus der Kabine, Zuordnung der Decks nach soundso; ich mußte mich mit vier anderen Gruppen in der Astor-Lounge einfinden. Zuordnung wiederum der Gruppen, man muß ja wissen, welches Boot. Meine Schwimmweste, schon mal gleich selber angelegt, saß selbstverständlich nicht korrekt. Ausziehen, entzwirbeln, anziehen. So geht das. Hatte ich echt vergessen. - Peinlich, aber grinsen.
Tja.
Strammstehen in drei Reihen vor den Rettungsbooten, deren Buge in Stirnhöhe hängen und da auch hängenblieben. Immerhin hab ich die gesamte Übung auf Band. Hat vor mir bestimmt noch keiner gemacht. *******(Das Schiff rollt. Ich werde in den Armen aller meiner Musen schlafen, so tief. Übergang zur Regenzeit, ich schrieb‘s >>>> heut morgen schon. Spucktüten bereits sind hinter sämtliche Handläufe geklemmt:  „Müssen wir leider so machen“, erwidert ein Steward auf meine spottende Bemerkung und zuckt die Achseln.
Wir rollen weiter. „Rollen“ bedeutet, daß sich die Astor nicht nur nach vorne in die Wellen legt, die sie dann gleich wieder heben, momentan jeweils zweidrei Meter, sondern es gibt zugleich eine Art Drehbewegung um die vertikale Mittelachse; genau das ist es, was so wenige vertragen. „Holla!“ dachte ich anfangs, „solltest wohl diesmal auch d u ..?“ - groovte aber schon mit, groovte gen Bar und holte mir den ersten Campari-Soda, den ich draußen vor der Bar anstelle meines Abendmalts trank („Abendma hlts“):  (Es lohnt sich und sei jeder und jedem empfohlen, die und der mir auf dieses Schiff folgen möchte, das Getränkepaket zu 25AUD pro Tag zu buchen; schon jetzt, dabei bin ich erst seit nachmittags an Bord, hab ich diesen Betrag locker erreicht; witzigerweise wird neben „prime spirits“ auch der Espresso extra berechnet, ist also nicht unkludiert; das entspricht der Eigenwilligkeit, daß es zum Salat kein Olivenöl gibt. Andere Kultur, Europa hin, Europa her; englische Reederei; dafür ein auffallend leckeres Kürbiskernöl. Geht das, es aus gerösteten Kernen zu pressen? So schmeckt es nämlich.)
Und an Deck.
Musi is‘.
Aberr nicht meine. Also flieh ich schlendernd zum Bootsdeck hinunter und weiß, kaum daß ich angekommen, sofort: Hier wird Gregor Lanmeister sitzen. Da ist es still. Da wird er immer hinkommen, wenn er für sich sein möchte. Ich muß dort eigentlich nur auf ihn warten, er wird mir in den Blick spazieren.
Für den Roman ist die Passagier-Zusammensetzung ohnedies ideal; fast alles alte Leute. Ich falle, nicht nur wegen meiner Krawatte, sofort auf, vor allem, weil ich ja nun ziemlich zerrupft als Backpacker an Bord kam. So entdeckt mich auch Christian, der, stellt er sich vor, Hotelchef. „You‘re German?“ Ob ich wohl dieser Journalist sei? Woher soll er auch wissen, daß ich das als Beleidigung empfinde? Brav schluck ich meine Entgegnung - „A journalist? Never! But a poet...“ - hinunter und lächle und erkläre, derweil ich weiter meine Abendcigarre rauche, was ich eigentlich vorhab. - „Ah, die Aufnahmen!“ ruft er vorbehaltlos aus. „Wir sollten uns treffen, müssen uns treffen.“ Lacht. So do I. Sofort ein Einvernehmen, wie mit dem Keeper an der Bar: „Your name‘s?“ „Alban.“ „Alban?“ „Alban. - An‘ your‘s?“ „Sugar.“ „Oh that‘s not difficult.“ Woraufhin diesmal e r, dieser also, etwas hinunterschluckt, nämlich sein „Indeed“, das ihm aus den schönen Augen leuchtet. Schon klar, daß wir fortan befreundet sind, der dunkle leuchtende Mann und ich. Meinen Abendwhisky bekomme ich included.
Dann alleine, mit einem weiteren Whisky, nach vorne an den Bug und in die wahnsinnig glänzenden Sterne, weißglühende Nadelmassenpracht, geschaut. Ich bin da! Abermals Glückswallung.
Aber vorher noch haben uns fast die gesamten drei Semeilen, die zur nationalen Zone gehören, australische Soldaten... tja, verfolgt, so sah es aus, in sprichtwörtlich rasenden Manövern: Wie entre ich ein Schiff? Auf Bordberührung, immer wieder. Wahrscheinlich haben die Steuerleute gewechselt, jeder sollte mal. - „What are they doing?!“ frag ich einen Steward. „It‘s a training?“ „Yes, it‘s training.“
So warn denn die Stunt-Einlagen auch schon gegeben, jedenfalls für alle, die aufmerksam schauten. Das waren nicht sehr viele. Allein indes die Fotos sind, geben Sie‘s zu, atemberaubend:     *******
*********[Mittwoch,
7.25 Uhr.
Britten, Cello Symphony (Truls Mørk).]
Als ich die Augen aufschlug, gleich neben meinem Bett:  Sport oder nicht Sport? Nicht Sport, sondern etwas arbeiten, erst einmal, dachte ich – nach dem Kaffee allerdings, der für „Early Birds“ ab sieben bereitsteht, was nun nicht wirklich früh ist; zumal gibt es „normales“ Frühstück sowieso ab halb acht.
Vorher geduscht, rasiert, für ein Schiff extrem luxuriös, jedenfalls so, wie ich hier nun lebe. Dann hinauf, den Kaffee in den Kumb, aufs Achterdeck, wo sich das Wetter unterdessen schon anders präsentierte:  Die letzte Zigarette aus Hong Kong geraucht; an sich Unsinn; mit meinen eCigarillos bin ich doch völlig zufrieden.
Gesonnen, über die Reling gebeugt. Ich war gewiegt
Gewiegt asleepSo mag er‘s denken, Gregor Lanmeister, sowie, daß wir schon heute über die erste Zeitgrenze schwimmen werden („fährt“ ein Schiff? tatsächlich? ja, aber, denn es ist auf Fahrt...); er hat schon, der Herr Lanmeister, v i e l e solche Grenzen überfahren, die Zeiten sind für ihn, anders als noch für mich, keine festen Größen mehr. Er aber hat auch nicht vor, noch irgend etwas festzuhalten; er fotografiert weder noch nimmt er Töne auf, sondern er fließt, so mag sein Empfinden ihn rühren, mit den Strömungen dahin.
Ich habe ihn freilich „wirklich“ noch gar nicht gesehen. - Soll ich suchen? (Jemanden anderes statt dessen, älter noch als er, vorgebeugt, aber kantig, das schüttere, dennoch sehr lange graue Haar, dessen nur Spitzen weiß sind, wild vom Wind hinaufgeweht, fast punkig in diesen Momenten, doch eine lange Geschichte in seinen scharfen Antlitzfalten. Er wandte die Augen dem Meer zu, ich sah ihn nur erst von der Seite, dann nur von hinten. - Achtgeben, Herbst. Die Sonne steigt höher, und die See färbt sich blau. Erste Sätze sind, nach dem Frühstück, in den Roman zu schreiben; einiges aus diesen Berichten, das dürfen Sie mir nicht übelnehmen, wird sich „an Formulierungen“ sowohl im Roman als auch bereits im Hörstück wiederfinden. Seltsam: „Ich war gewiegt/gewiegt asleep“/ein Schlaf sein, so gewiegt/ein Schlaf geworden selbst. Sieben Tage „reiner“ See liegen vor mir. Das ruft nach einer Strukturierung, die Gregor Lanmeister schon lange verlor; sollten wir miteinander ins Gespräch kommen, werden wir reden, als riefen wir einander aus verschiedenen Welten, wenn auch leise, zu: selbst nah aneinander wie mit zu Trichtern geformten Händen vor den Lippen. Hingegen ich fürs Hörstück schauen werde, mit wem ich später sprechen möchte: Es eilt hier nichts, die Wellen bauen sich ruhig auf und fallen ruhig wieder. In diesem langen Rhythmus hebt sich zu Seiten und fällt es mit ihnen, das Schiff.
Frühstücken gehen. Dann dieses in Die Dschungel stellen. Und den Roman beginnen.
Sowie das Meer aufnehmen, für das Hörstück: nachmittags.
Der Morgen liegt immer im Osten.
Das Wort Durchlaufsinn für „Richtung“.
Auf dieser, der unseren, Welt. *******(9.15 Uhr.)
Tiefes sanftes unentwegtes Wiegen.
Nur See. So weit die Augen sehen. Wer wir sind, und was.
******* albannikolaiherbst - Dienstag, 1. April 2014, 16:59- Rubrik: Arbeitsjournal

[18.08 Uhr australischer Zeit.
Die Erzählung dazu morgen (morgens nach europäischer Zeit).]
albannikolaiherbst - Dienstag, 1. April 2014, 16:59- Rubrik: Arbeitsjournal

(Sundancer Backpacker‘s Resort,
Terrasse zur High St.
9.37 Uhr australischer Zeit.)
Es ist kühler geworden, unter den Wolken empfiehlt sich ein leichter Schawl, den wir aber sofort wieder ablegen müssen, wenn die Sonne hindurchkommt. Schwere Bedeckung aber über der See; der Umbruch in die Regenzeit könnte das Meer unruhig machen. Der Termin für diese Kreuzfahrt ist gut gewählt, gilt sie doch vor allem der Rückholung des Schiffs in europäische, namentlich erst einmal deutsche Gefilde. Es ist nicht nur eine Freizeit fahrt – für mich ja ohnedies nicht. Ich kann mich gar nicht erinnern, wann in meinem Leben „Freizeit“ überhaupt einmal eine Rolle gespielt hat. Alles ist Teil meines Berufs, dessen Name in altem Sinn von Berufung kommt. Wozu mir allerdings meine Mutter einfällt: „Einige sind berufen, doch wenige sind auserwählt.“ Selbstverständlich setzt Auserwähltheit eine bestimmende Instanz voraus; es gehört zu meinem und meiner Art Character, solche Instanzen zu leugnen, bzw. sie zu unterlaufen, seien sie sakraler, seien sie säkularer „Natur“.
Ich kam gut früh zu Bett, etwas nach Mitternacht, und lag in meinem Vierbettzimmer noch lange allein, konnte aber fast ebenso lange nicht einschlafen. Stickig stand die Luft in dem Raum, und von direkt unter mir, wohin nach 22.30 Uhr, in einen Spalt zwischen zwei Häusern, die Raucher sich verdrücken müssen, quollen dickes Reden und Lachen herauf, ausgelassen, nicht bereit, schon dem nächsten Tag in die Augen zu sehen, die hier im Sundancers sofort auf drei Fernsehbildschirme schauen, zwei riesige und einen kleineren für jeden Einblock des Saals, und die Ohren hören eingeblendetes, sehr lautes Lachen der TV-Programmierer, das heißt, derer, an deren Strippen sie ziehen. Wenn Johnny Cash beginnt, ist das immer eine Erholung, der Rock ‘n Folk, der darauf folgt – geradezu niemals hör ich hier Pop, das ist auffällig, ist interessant, und angenehm -, bekommt da etwas Utopisches: Flower Power, die sich mit jugendlicher Sinnlichkeit paart, und mit Offenheit. Klassik oder „was man so nennt“ wäre hier völlig fehl am Platz, ich selbst wollt‘ sie nicht hören. Sie würde objektiv nicht passen, wäre geradezu ein, wenn das Wort hier stehn darf, Stilbruch und täte darum auch mir weh. (Vielleicht aber, gäbe es hier ein Klavier, daß nachts sich jemand daransetzte und spielt Skrjabin? - das freilich wäre etwas anderes).
Unruhe erfaßte mich gestern: Was, wenn ich mich im Abfahrtdatum getäuscht hätte, und die Astor führe bereits heute? Vorn an der Südmole stehend, musterte ich mein Schiff, weil Rauch aus den Schornsteinen aufstieg, mit leichter Unruhe. Da war es halb sechs am Abend, 5.30 pm. Sollte ich bis sechs Uhr stehen bleiben, um sicher zu sein? Aberglaube! Unfug! - Als die Damen noch um Viertel vor sechs an ihrem Kai lag und an seine Seite geschmiegt liegenzubleiben schien, noch etwas ruhen zu wollen, machte ich mich drum auf zurück in den Ort. Aber ich versprach Ihnen >>>> gestern das Bild. Voilà:  (Links im Hintergrund die MS Astor (Links im Hintergrund die MS AstorMan, n‘est-ce que pas?, erkennt meine Unruhe nicht. Sie gehört ja sowieso zu meinen üblichen Aufbruchsnervositäten. Aber auch die Unruhe des Schiffes scheint mit nicht kenntlich zu sein. Auf dem Bild wirkt sie, die schöne Dame, ruhend. *Sehr angenehm am >>>> Sundancer‘s ist nicht nur die Freundlichkeit des Teams, die eine eigene Erwähnung verdient, sondern vor allem die Vertraulichkeit, die es erlaubt, jedes Gerät offen herumliegen zu lassen; man muß einfach keine Angst haben, daß etwas wegkommt, auch nicht bei Laptops, iPads und dergleichen; vielmehr ist‘s, als legte jede/r das Auge darauf, daß es auch bleibe, wo‘s grad ist. Nur hier auf der Terrasse, bat mich Jay, möge ich auf den Tischen nichts herumliegen lassen – ein Griff von der Straße sei zu schnell getan. Dabei habe ich von Fremantle immer wieder einen Eindruck, den die folgende Anekdote aus der Londoner Zentrale der Bank of England illustriert: Irgendwie sei am Schalter, vor dem sich bis auf die Straße eine lange Menschenschlange aufgebaut hatte, ein Goldbarren liegengeblieben. Der ganz vorne Stehende habe ihn genommen und sich angeschaut, und der oder hinter ihm habe aber auch mal gewollt, und wiederum die noch dahinter. So sei der Barren von Hand zu Hand vor Auge und Auge bis auf die Straße gewandert, habe eine kleine Kurve zur Nebenschlange gemacht und sei nun die wieder bis nach vorne gewandert. Der/Die Letzte habe den Barren dort an den Schalter zurückgelegt. **Abends las ich, las lange, einhundert Seiten an einem Stück und möchte Ihnen das Buch gerne empfehlen. Ich lese es auf dem iPad, was angenehm ist, aber Sie können es selbstverständlich auch gebunden bekommen. Der Autor selbst, Lars Popp, hat mich um die Lektüre gebeten, nicht aber, ohne beizufügen, ich würde möglicherweise etwas verwundert über Ähnlichkeiten zum >>>> Wolpertinger sein; doch habe er mein Buch wirklich nicht gekannt, als er das seine schrieb. Das ist mehr als glaubhaft; in einem ungewissen Sinn könnte man von „Variationen über Themen des Wolpertingers“ sprechen, hätte Popps Roman nicht eine völlig eigene Sprache, die vor allem in der Behandlung von Dialogen geradezu meisterlich ist - frühmeisterlich, denn dieser Romancier ist noch recht jung. Mich begeistert an dem Text, unter einigem anderen, wie doch totgesagte Themen sich immer weitererhalten, wenn es denn welche tatsächlich sind, und wie ähnlich sie in ihrem Ausdruck werden, gerade auch in der Unähnlichkeit. Das reicht bis bestimmte Macken, die die Characteere haben, sagen wir: Eigenheiten. Sie müssen sie haben. Es ist ein bißchen, als führten ganz andre uns die Hand; zwar, es bleibt bei je unserer eigenen Handschrift, bei Popp wioe mir ganz unbedingt, aber was sie jeweils niederschreibt, das stammt von jemandem andres.
Lars Popps Roman heißt >>>> „Haus der Halluzinationen“  und ist bei >>>> Hablizel erschienen; kein Geringerer als Dietmar Dath hat es lektoriert, was ich deshalb petzen darf, weil auch das Impressum es angibt. Popps Sprache ist frisch, aber nicht jugendlich im Sinne von Jargon, verzichtet freilich, anders, als ich es tat und tue, auf Parataxen; vielleicht liegen die ihm einfach nicht. Allerdings ist die Struktur des Romans, also seine Konstruktion, parataktisch – etwas, das die vermeintlich locker dahinfließende Erzählung ausgesprochen pfiffig macht. Und besonders für einen wie mich extrem vergnüglich. Wobei es meiner Eitelkeit selbstverständlich gefällt, auf welch elegant indirekte Weise sich im Abspann des Buches eine Art Danksagung nicht an mich, nein, sondern an den Wolpertinger findet.
Ich denke, ich werde >>>> Volltext fragen, ob ich auch diesen Roman rezensieren darf. Meine Besprechung könnte ich gut auf dem Schiff schreiben und täte es dort gerne, in Absehung von Gregor Lanmeister, dem ich doch auch noch gar nicht begegnet bin. Wie es sein wird, aber wenn er leibhaftig vor mir steht, – nun, Leserin, wir werden sehen. Ob ich mich trauen werde, ihn anzusprechen? Oder wird es besser sein, ebenso diskret zu bleiben wie er? ****Wir legen hier ab, wenn es bei Ihnen genau Mittag sein wird, Leser. O-der-Sie jetzt noch schlafen! An Ihre, Leserin, Bettstatt denk ich mal besser nicht.
(10.33 Uhr.)*****Sundancer‘s Morgenstimmung:  (Bereits am Kai gewesen, nach meinem Schiff geschaut. Es wartet.)
Die Sonne ist hervorgekommen. Warm ist‘s. Etwas geschlendert. Den LS 11 und die geliebten OKMs, meine In-Ear-Mikros, bereitgelegt, um bereits beim Einschiffen Atmos für das Hörstück aufzunehmen. So und so, und so ebenfalls, beginnt nun meine „eigentliche“ Arbeit. Ich denke, daß ich tagsüber lauschen, beobachten, bisweilen auch Gespräche führen, aber abends, wenn die anderen beim Entertainment sitzen, schreiben und auch schon die jeweiligen Aufnahmen auf die Sicherungsplatte übertragen, vielleicht sogar schon die Tonprotokolle erstellen werde.
(12.39 Uhr.
Noch anderthalb Stunden bis zum Aufbruch.)****** albannikolaiherbst - Dienstag, 1. April 2014, 06:44- Rubrik: Arbeitsjournal
Erzählt mir grad ein Officer. Ich war nach dem formidablen Abendessen hinaus aufs Achterdeck und hatte sofort gedacht: Meine Güte, was ist das w a r m geworden. Die Erklärung kam dann gleich im Gespräch. Als es nämlich zu regnen anfing... nun ja, zu nieseln. Direkt auf unserem eigentlichen Kurs liege ein sehr heftiger Sturm, den wir nördlich zu umsegeln versuchen; wir werden, wenn des Kapitäns Rechnung aufgeht, nur die Ausläufer streifen.
Noch ist alles ruhig; man spürt nur unter den Füßen ein etwas aufgefrischtes Rollen. Doch für den Fall, daß Sie morgen nichts von mir lesen, vielleicht auch noch übermorgen nicht: dann hat dieser Sturm die so weit auf dem Ozean ohnedies problematische Internetverbindung restlos gekappt, und es kann mir so gut gehen, wie es nur will, sie würden es erst einmal nicht erfahren.
Seien Sie also so ruhig, wie ich es bin (und wie der Kapitän es ist, der mit uns im Restaurant zu Abend aß, und der junge Offizier, mit dem ich sprach, lachte nur), auch so in meiner perversen Vorfreude-Art: Es wird dann zu erzählen geben, wenn sich Ruhe und Kontemplation über die MS Astor zurückgelegt haben werden. Meine Leser:innen vergangener Jahre haben vom Stürmen auf See ohnedies schon berichtet bekommen, auch wenn es damals nur in der Biskaya war, und sie wissen, daß dieses Schiff mehr aushält als jedenfalls die meisten seiner Passagiere.
Seien Sie mir mit einem leisen inneren Jubel gegrüßt:
Ihr ANH albannikolaiherbst - Donnerstag, 3. April 2014, 15:43- Rubrik: Arbeitsjournal
 (Mittwoch,
18.32 Uhr.)
Die ersten vierundzwanzig Stunden reiner See. Ich habe imgrunde nichts anderes getan, als den Wellen zuzusehen und so, wie wahrscheinlich Maler die Farben, Bewegungen, Gestalten in sich aufzunehmen versuchen, dies mit den Klängen des Meeres getan: wuchtige, feine, sirrende, auch klatschende, gegen den Bug, zuweilen, oder, um genau zu sein, er in sie. Ab dem späten Vormittag konnte ich nur noch mit einer kurzen Hose bekleidet liegen, stand bisweilen auf, um etwas zu trinken zu holen, aber die Zeit floß schon zu ihren – oder meinen – unsren? – Seiten aus sich und uns heraus, den vielen halb bis ganz alten Menschen und mir. Nur die Besatzung hatte laufend zu tun, Kleinigkeiten, scheint‘s, die auf See indes Notwendigkeiten sind: Nachbesserung der Farben an Reling und Bordwand, um Rost zu verhüten; Kabelrollen am Vorderdeck, Wartung des Außernborders eines Beiboots, um davon noch nicht zu erzählen, was unter Deck nötig ist, und was das Servicepersonal anlangt, so hat es ohnedies alle Hände und Füße voll zu tun.
Indessen ich meditierte.  Dabei bin ich Herrn Lanmeister immer noch nicht begegnet, vielleicht, weil er sich abseits seine ganz eigenen Gedanken über das Meer gemacht hat, damit wiederum ich sie niederschreibe und jetzt für Sie – und für mich als einje Erinnerungsstütze – aus der Löwin schönem Notatbuch in diese Datei übertrage:  (Selbstverständlich, Tonaufnahmen habe ich ebenfalls gemacht, mehrmals des Meeres, um das Sirren der Gischt einzufangen und um dei Verscvhmelzung von Motor und Woge im Hörstück wiedererzählen zu können; schließlich fand ich - gemäßigte, ich sage einmal: „Zigan-Klassik“ im Captain‘s Club: vorgetragen von zwei jungen diamantenen Duo-Damen – sogar ein Stück Schubert, das auch dem Hörstück die Stimmung von Gregor Lanmeisters Roman geben könnte --- also zur Gänze tatenlos war ich nicht. Dennoch so erfüllt von Herrn Lanmeisters, der dem Rauschen zuhört, Verspüren, wie sich Wogen und Motor vereinen, nur daß „vereinen“ noch ein „o“ haben müßte, um die Wirklichkeit wenigstens einigermaßen „treu“, alliterierend nämlich, wiederzugeben. Zumal sich, was ich eigentlich vorgehabt hatte – auf dem Achterdeck am iPad zu schreiben – , einfach nicht umsetzen ließ, weil der Bildschirm zu stark spiegelt; ich hätte mich für die Arbeit denn in meine Suite begeben müssen. Dort wollte ich aber nicht sein. Immerhin, die alte papierene Weise, etwas zu notieren, funktioniert ja nach wie vor: Essentialitäten (zu denen auch der freie Oberkörper gehört: „don‘t do it!“ riefen mir von ihren Liegestühlen drei alte Damen zu, als ich das Hemd übern Kopf zog – und amüsierten sich dabei).
So also Lanmeisters Platz eingenommen. Nein, denn wie andere ältere Leute hütet auch er sich vor der Sonne. Er sitzt mir also am Bootsdeck im Rücken, dort etwa, wo die drei alten Damen immer noch kichern:  Über der See hängen die Wolken wie eine Flotte dunkler, aneinandergerückter Zeppeline; sie lassen sie, die Sonne, nur manchmal zu uns herunterblicken und immer nur kurz: eine Seeblockade zur Luft. Und Gischtstaub.  In die Strukturen der Wogen versinken. Es gibt Rutschen, die gleich gestraffter Seide glatt sind, hochpolierte wie Metall. Dazu über Strecken sich erhebende Bergzüge, nicht eine einzige krisslige Unruh auf auf den Pässen. Dann wieder Wogen aus einem mit Silber bedampften Blei, über dem der Gischtschnee wirbelt. Auf Hunderte Seemeilen Krönchen dahinter. Und wenn wir uns, denkt Lanmeister, gehoben von einem Wogenpflug, wieder hinabsenken, schäumt es unweit vom Berg weg: dann hebt ein ungeheures Sirren an, wieder und wieder, das sich aufs Gleichmaß des Brandungsrauschens senkt - oder sich aus ihm erhebt, es ist nicht zu sagen -, das wiederum Ton in Ton geht mit dem Grollen des Motors. ***(Der Roman beginnt mit 42 und zählt dann rückwärts auf Null, setzt ein, als hätte es davor eine 43 und davor eine 44, eine 89, 356 gegeben – de facto nie geschriebene Kapitel, auf die sich aber Lanmeister bezieht. Als kennten wir sie alle: „Wer aber zählt?“ - dies wird als Motto vor dem Roman stehen.) (Wir müssen von 13.30 Uhr auf 7.30 Uhr zurück. Die Tage werden kürzer.) ***Schweigen, ständig
in schweigendem Deutsch.***Wenn man dem Meer und dem Motor lange genug lauscht, dann fährt Georg Lanmeister mit einem gewaltigen Tosen in seinen stillen zufriedenen Tod. ***Ich liebe dieses sanfte hohe Wiegen; gewiegt, nicht gewogen werden, was, sic!, das Gegenteil wäre. ***Die ganze Meeresoberfläche, möge sie auch konvulsieren, ist eine Haut.
Wellenformen ff: manche sind Vulkane, andre Hügelketten, auf deren Rücken der flüssige Sand zurückrutscht. Genau dabei entstehen diese glasglatten Flächen.
Die Buggischt durchleuchtet mitunter ein helles Türkis. Und in der Ferne, so Lanmeisters Eindruck, begleitet uns ein andres, sehr viel kleinres Schiff, vielleicht nur ein Boot. Vielleicht stimmt das auch, nur nehmen es nicht alle wahr, die an Bord sind. Aber w i r sehen es, die dazugehören. (Das Wasser, in all seiner salzigen Ungenießbarkeit, ist ein Element des Lebens. In der Ferne scheint sich das Meer, genau von Nord nach Ost, wie eine Mauer zu erheben, die der englischen Südküste ähnelt, nur sehr viel länger ist. Andren Wellenbuckeln sieht man die Wale an, deren Rücken sie kopieren. ***(17.32 Uhr.)
Wir fahren in eine Haube aus Dunst, die die Sonne über das Meer warf... nein, sie zieht es seitlich grauschräg - und von hinter sich - aus ihm heraus und himmelan, mit einzelnen verwischten, weiter noch hinauflangenden Schlieren: leise drohendes Portal, durch das wir, derweil sich der Feuerall nicht entfernt, sondern flammend auflöst, in die Nacht gleiten werden. Noch liegt die sich sammelnde Ballung wie ein Kissen unter der Sonne, darauf sie ungefähr ruht, beginnt da, sich zu bedecken, und der Seewind frischt auf und kühlt aus.
Mich umkleiden. Rituale geben Struktur, sind Klammern aus Form. Wir begannen, die Welt uns gewogen zu machen, als wir sie teilten. Denkt Gregor Lanmeister, der jede Teilung davongibt. Wahrscheinlich findet er meine Krawatte ein bißchen, nein, nicht gleich lächerlich, aber doch banal. Dabei tu ich was, im Gegensatz zu ihm. Er findet wohl auch das banal. *****
All die jungen Menschen, die das Entertainment der vielen vielen Alten besorgen. Diese schauen, wenn sie wach sind, zurück, jene aber, wenn sie sich trauen, voraus. Und das Meer ist die Zeit. *******
*********(Donnerstag,
7.43 Uhr.
Alban Berg, Erstes Streichquartett.)
Gestern nacht endete das kleine Duo, in der Captain‘s Bar, mit Bachs Air. Die Haltung der jungen Musikerinnen ward plötzlich anders nach all den bis dahin Evergreenigkeiten, und sie mochten danach nicht mehr weiterspielen, bzw. hatten das Stück sowieso an das Ende ihres Teilzeit-Programmes gestellt. Wenn auch im Hintergrund ge„werkelt!“, also tresenjenseits die Espressomaschine bedient und aber auch diesseits der Theke von einigen Gästen weitergeplappert wurde, war es, als hörten andere mit einem Mal wirklich Musik. Sie erhob sich durch den Raum, mitten im Promenadendeck, erhob sich und, wie ein Air wohl soll, schwebte und stand dann wie Luft im, >>>> so schrieb neulich tom, „Standpunkt der Erlösung“.  Es ist dies der zweite „ganze“ Tag auf See, e r s t, stellen Sie sich vor! Wie soll ich erst am fünften sie, die Zeit, empfinden? Das ist gewiß das spannendste: was diese Reise mit mir macht. Es gibt nur das Dahingleiten, ein, quasi, täglich Wiedergleiches und Widrigkeiten keine, die Akzente setzen könnten. Das wird sich erst mit der Ankunft auf Mauritius ändern. Deswegen scheint mir dieser Reiseabschnitt jetzt, dieser achteinhalbtägig erste, vielleicht der wichtigste zu sein: für den Roman (also für mich, schließlich will man wachsen) und vielleicht auch für das Hörstück. Für dieses interessieren aber noch andere Belange, etwa, fragte ich mich vorhin beim ersten Rundgang zum ersten Kaffee und nachdem ich ein süßes Stückchen... „vom Blech“ hätt ich jetzt fast geschrieben, aber nein: … aus dem Korb genommen hatte: -- etwa:: Hat solch ein Schiff auch eine Bäckerei? Wie halten sich die Dinge? Gibt es spezielle Techniken, Eingefrornes aufzutauen, ohne daß man den frühren Frost noch schmeckt? Es müßte, anders, doch sonst d u f t e n morgens um halb fünf. Oder um vier Ganz Dörfer duften dann in die Morgen, ganze Straßenzüge! (Oder: Nur die Teige sind gefroren? wie daheim ja auch? also fast nur noch: - „Bäck-Shops“ statt des süßen harten Handwerks. Uns die Geschmäcker zu normieren: modules Zungen/Geschmackswärzchenswerk ---)
Darüber sann ich, als ich das Sonnendeck entlang zum Bug spazierte, um Richtung Kurs zu kieken: dem Süden Afrikas entgegen: Ich werde heute, was ich gestern versäumt, mein Treffen mit dem Hotelchef terminieren, vielleicht für abends beim Whisky, wenn er mag.
Unsere Position: 160º östl. L/30º südl. B::  Wie wenig Strecke wir erst zurückgelegt haben! Dabei kommt es mir so vor, als wär ich bereits seit drei oder vier Tagen auf See; wie wird da erst Lanmeister fühlen, der vielleicht schon seit Jahren auf diesem Schiff lebt? Was ein Jahr sei, kann es denn davon dann überhaupt noch eine Vorstellung geben?
Das Zeitempfinden verschiebt sich aber auch deshalb, weil wir Zonen der Zeitnorm überfahren: Heute nacht war die Uhr um eine Stunde zurückzustellen, was bedeutet, daß sich meine Zeit der Ihren ruckartig angenähert hat. Dies ist nun n i c h t nur eine Folge der im weiten Sinn kulturellen Norm, bzw. zivilen Übereinkünfte, sondern entspricht natürlichen Vorgängen: Entwicklungen geschehen viel mehr in Sprüngen, als daß sie stetig sind. So auch altern wir, es ist kein ununterbrochen fließender Prozeß, sondern zehn Jahre lang sehen wir wie die muntersten Vierziger aus, dann klatscht wer in die Hände, erschrocken blicken wir hoch und sehen in den Spiegel. Schlagartig sind wir fünfzig geworden, sechzig, achtzig. Die aus unserm Empfinden von Ununterbrochenheit erstandene Idee- selbst, des Stetigen, ist kulturell; in Wahrheit gibt es zwischen den Sternen das Nichts wie zwischen den Atomen, und wie zwischen Gestern und Heute.
Vielleicht, daß Gregor Lanmeister eben dies beobachtet? Er ist dem näher? *(9.15 Uhr Ozeanzeit.)
Die ersten Gespräch haben begonnen, mit einigen der Crew, Bekanntschaften aber auch, gestern abend bereits, mit anderen Gästen. Ich teilte zum Dinner den Tisch mit einem schottisch/australischen Ehepaar, das die Hälfte des Jahres, jeweils die Sommer, im jeweils anderen Land verbringt; sie sind nun auf dem Weg in ihr schottisches Cottage. Beide haben Kinder je aus auch vorherigen Ehen, sie vier, er drei, das jüngste ist vierundzwanzig, das älteste wird schon sechzig werden... - Normalerweise flögen sie ja, aber diesmal habe sich die Seereise derart angeboten, da hätten sie nicht widerstehen können. Er spricht ein australisches Englisch, von dem ich fast kein Wort verstehe, muß mich erst einfuchsen auf diesen, tja, ist es das?, Dialekt? - sie hingegen ein distinguiertes fast schon „Oxford“, also seh ich dauernd sie an, auch wenn e r spricht, weil ich ihn dann tatsächlich ein bißchen verstehe; es ist, als übersetzten mir ihn ihre Augen: als spräche er durch die geliebte Frau hindurch – eine Wahrnehmung, die mich bis heute früh beschäftigt, ja, deren Character ich eigentlich jetzt erst begreife.
Sie erzählen mir von Australien, unterstreichen meine Absicht zurückzukehren mit „tun Sie das, tun Sie das unbedingt!“, um die Dschungel zu sehen, den Norden, der für Australien, was für Europa der Süden, und mehr sogar noch: weil eben tropisch. Man muß ja nur Krokodile erwähnen, und ich springe an. Es ließen sich die Flüsse des Nordens auf hausbootartigen Kleinschiffen durchkreuzen; sie, die beiden Eheleute, hätte das einmal gemacht: Kabinen von der Größe unseres Abendbrottischs. Sie lachen.
Später plaudr‘ ich mit Sugar in der Hansebar und mit seinem burmesischen Kollegen; es sei ruhig, s e h r ruhig auf dieser Rückfahrt; die vorherige Tour, um Australien herum, habe sie oft bis vier oder fünf in der Frühe arbeiten lassen; die älteren Herrschaften jetzt aber gäben bereits um halb zwölf auf. Milan, der serbische Keeper, vorhin in der kleinen Bar auf dem Achterdeck, langweilt das indes; überhaupt sei er lieber auf Flußfahren engagiert, da sei mehr los. Und er liebe die langen Joggingpfade längs der Wasserwege.
Ich sammle. Sammle für das Hörstück. Mit wem ich sprechen werde dann auch bei laufendem Rekorder. Erst einmal brauche ich das Vertrauen, nicht nur, nein: Zuneigung. Die wird einem nur gegeben, wenn man sie ebenfalls hat. Weder in dem Hörstück noch gar dem Roman werde ich David Foster Wallace‘s Abfälligkeiten wiederholen. Es ist leicht, sich zu erheben, und mir zu billig. Das betrifft sogar die schlechte Musik, die viele so lieben; sie lieben sie mit Gründen und aus diesen Gründen heraus. Das zu wissen und zu erfahren, macht sie, die Musik, nicht besser, aber es behandelt die Menschen fair, die ihre Anhänger sind. Schon Rührung ist arrogant, indem sie nämlich hierarchisiert: den, der gerührt ist, über die, die rühren, stellt. *Bedeckt heute morgen, aber ruhige See. Das Mittagessen werde ich ausfallen lassen; ich setze zu, merk es an der Gürtelschnalle. Statt dessen an das Rudergerät und an die Kraftmaschinen ein bißchen. Aber erst mal nun dieses für Sie ******* albannikolaiherbst - Donnerstag, 3. April 2014, 06:03- Rubrik: Arbeitsjournal
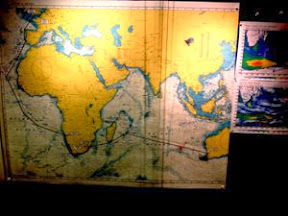 sub>(Freitag,
8.50 Uhr.)
Die Abläufe sind immer gleich, das läßt die Zeit n o c h mehr verschwimmen. Wir genießen dies oder setzen etwas dagegen, das strukturiert. Zum Beispiel „den“ Kalender („an sich“), indes die Sicherheit der Uhrzeiten bereits abermals torpediert wird: erneutes Zurückstellen heute nacht, um die nächste Stunde. So daß meine Zeit zu der Ihren ab morgen nur noch vier Stunden differieren wird. * Nach >>>> der kleinen Sturmmeldung gestern abend, die sich zu den meisten Passagieren aber gar nicht, sinnvollerweise, herumsprach, empfing uns heute früh nur Regen – ein leichtes, warmes Nieseln bei sehr verhangenem Himmel, aber ausgesprochen ruhiger See. Nicht mal die Dünung muß man erwähnen. Auch nachts, als ich dann lag, war kein Seegang zu spüren, abgesehen selbstverständlich von dem durchgehenden leichten Schaukeln, das uns täglich wiegt. Sie ist kein Abenteuer, diese Fahrt, und so auch nicht gedacht. Was aber auch bedeutet, daß ich schon deshalb die für unsere Häfen angebotenen Exkursionen, in Südafrika darunter zweidrei Safaris, nicht mitmachen werde; sie sind für die älteren Menschen ausgelegt, also komplett abgefedert. Für mich selbst würd ich mich da ärgern. Was nicht sein muß. Ich werd dann auf eigenen Füßen und mit dem mir eigenen Trotzkopf alleine losziehn.
Noch aber haben wir sechs volle Seetage vor uns, nicht ein Drittel der Überfahrt liegt hinter uns.
Schön auf dieser Fahrt die sehr persönlichen Gespräche , die auch ganz „einfache“ Besatzungsmitglieder mit den Passagieren führen, nicht nur Servicemitarbeiter, sondern auch Matrosen, ja die Schiffsarbeiter, quer durch die Ethnien, stehen bisweilen mit Gästen beisammen. Und allerweil und -wo ist auf solch einem Schiff jemand am Werkeln, sei‘s, daß gewischt, sei‘s, daß neu gestrichen wird; hier und dort, und da drüben auch, steht jemand mit Farbeimer und an langer Stange dem Pinsel; anderwärts wird das Holz der breiten Handläufe an den Außentreppen nachlasiert; es wird ständig ausgebessert, zumindest gewartet, oft verschönert – und ich spüre bei fast allen einen tiefen Stolz; das Schiff gehört zu einem und man selbst zu dem Schiff: gegenseitig Teil sein: über „pur“ entfremdetes Arbeiten geht das hinaus. Auch wenn, wie mir gestern eine Ukrainerin sagte, nach zwei Jahren unentwegter Fahrt sie sich denn auch nach Zuhause sehne, „auf dem Land sein“, sagte sie; eine andere hat ihr fünfjähriges Kind seit fast einem Jahr nicht gesehen, aber „man muß leben, so ist die Welt“. Johan wiederum, aus Rumänien, hat seit Kindheit vom Reisen geträumt, und nun reist er, „ich habe alles gesehen, Arktis, Antarktis, Australien, Afrika, Canada, alles. Warum auch nicht? Ich habe keine Frau und zur Zeit nicht einmal eine Freundin, niemanden, dem ich verpflichtet bin. Nur meinen Eltern. Sie leben bei Stuttgart, Böblingen, kennen Sie das? Aber mein Deutsch habe ich trotzdem vergessen“, so daß er in einer an Bord nicht ungewöhnlichen Mischsprache spricht, mit englischem Akzent - „Akzent“ in beiderlei Wortsinn.  Momentan ist mein Eindruck, es sei die Crew letztlich interessanter, als es die Passagiere sind. Aber das kann täuschen, jedenfalls in dieser Aussage-Generalität. Denn da ist Patrick, z.B., der Ire, der eine Zeit lang ebenfalls in Deutschland gearbeitet hat, als Holzfäller, im Schwarzwald, „ich habe vieles gemacht in meinem Leben“. Er sieht, mir dem eleganten Sporthut, verwegen aus, ist um die Fünfzig, kantiges Gesicht, schmal, fast hager; Abenteuerlust und Spott in den Augen gehört er zu den bei weitem jüngsten Passagieren. Das gehört hier ebenfalls dazu: Man findet sich. Ja, auch auf der Astor sei er selbst einmal beschäftigt gewesen, vor Jahren, wirklich, als Krankenpfleger drunten im Schiffsbauchshospital. Und nun habe er Verwandte in Australien besucht, habe dort einen Job finden wollen, but all doors are locked, like, ergänzt er, all over the world: mit Argusaugen werden die Arbeitsplätze bewacht, und man begreift, weshalb es sinnvoll ist, nicht staatenlos zu sein (- was ich selbst immer gern gewesen wäre: ein Traum von der Weltbürgerschaft).
Jedenfalls.
Schon gehen die Blicke hinüber und her, es wird morgens ohnedies immer gegrüßt, fremde Mitgäste wie Personal, aber manche schauen sich eine Spur länger an; die Ganglien entscheiden bereits. Und dann steht man „plötzlich“ nebeneinander und fängt an zu erzählen -  Der Stolz von dem ich sprach, kann aber auch mißverstanden werden. Es hätten sich, erzählte das schottisch/australische Ehepaar, von dem ich gestern schon sprach, nach der vorigen Kreuzfahrt einige Passagiere beschwert, daß die Besatzung so arrogant sei. Dies eben ist eine Verwechslung: namentlich dann den Stolz für Arroganz zu halten, wenn jemand ihn hat, der vermeintlich unter einem steht, in der gesellschaftlichen wie der Hierarchie an Bord. Es sind aber Menschen nicht minder als die Gäste; sie haben, mögen sie auch über sehr viel weniger Geld verfügen, dasselbe Anerkennungsrecht. Zu bedienen bedeutet eben nicht: unter den Bedienten zu stehen; vielleicht steht man sogar ein bißchen darüber. Wer sich diesem Gedanken öffnet, wird eine Schönheit der menschlichen Gleichberechtigungen spüren – durchaus eine auch ästhetische, nicht „nur“ moralische Kategorie. Aber hiervon abgesehen, dreht sich das hierarchische Feld spätestens in Notfällen herum: Wem dann, nämlich, wären wir alle hier auf See anempfohlen? 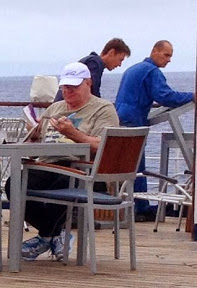 (Ich spüre, wie ich zum Philosophieren neige; gestern, fast scharf, bereits einmal, als ich nur ins Wasser starrte; das ist Lanmeister, der mir Gedanken schickt, die seinen, damit sie sich in einem Organismus, der nicht fiktiv ist, realisieren. Er ist mir, Herr Lanmeister, nach wie vor nicht begegnet. Statt dessen fielen mir bereits mehrfach dreivier Männer auf, die wie Patrick Geschichte verbürgen, und eine kraftvolle Eigenwilligkeit. Einer erinnert an deutlich an Melville, ein anderer an Hemingway, den späten, einer sogar an Tolstoj, des weißen riesigen Bartes wegen; der übrigens, Tolstoj, hängt als nicht sehr gutes Ölgemälde, doch immerhin, steuerbords am Promenadendeck, Puschkin ihm im Rücken. Und eine Druckgrafik, deren Signatur ich nicht entziffern konnte, stellt mehr und gleichzeitig minder abstrakt einen „Poet(en) auf Reisen“ vor. Ich hab mich aber nicht wiedererkannt. Außerdem müsse er, Patrick, nun wieder hinein zu seinen Freundin; die habe er nur dieser Zigarette wegen verlassen, aber „wir sehn uns“. *Es gibt auch Absurditäten. Zu denen gehört, nicht seiner selbst wegen, sondern des Procederes halber, die Captain‘s Welcome Reception. Die sieht so aus:
Man trifft sich in Abendgarderobe in der Captain‘s Bar. Ich erwartete, daß auch er kommen würde, quasi logischerweise. Smoking, geschweige Frack wäre selbst mir overdressed vorgekommen; also den Leinenanzug und zum hellen Hemd die allerdings hochedle, trotz ihres Rotes dezente Krawatte, die mir die Löwin einmal geschenkt hat, das war in Paris. Dennoch: Einige der „Overdressten“ machten plötzlich Figur, wurden scharfer Vertreter einer bestimmten, neugierig machenden Typologie; es war auch ein bißchen, wie überhaupt schon oft auf dieser Fahrt, als wär ich um ein Jahrhundert zurückversetzt worden. So war denn einiges zu erwarten.
Aber der Captain kam nicht. Sondern das, tja, „Ritual“ (?) begann damit, daß die Leute die Bar wieder verließen und sich in eine lange Schlange stellten, die bei einem Fotografen endete. Dort ließ man sich fotografieren, Paar für Paar. Ich beobachtete und konnte eine gewisse Rührung nicht wirklich wegschlucken, auch wenn ich weiß, daß auch sie schon arrogant ist und also ohne Gerechtigkeit. Immerhin kam ich mit einer der hübschen Hostessen ins Gespräch, oder sagt man Stewardess?, die dem Vorgang allein durch Dasein assistierte.
Nun müssen Sie mal rechnen, daß bei 313 Passagieren, wenn sich von denen nur die Hälfte ablichten läßt, in Abendgarderobe wohlgemerkt vor der großen Astor Lounge, die dem allabendlichen Schowbusiness die Heimstatt, das immerhin 151 1/2 Fotos ergibt, die aber noch nicht genug sind, denn nach der draußigen Ablichtung folgt drinnen, in der Lounge, eine zweite, und zwar zusammen mit dem Kapitän. Die Prozedur dauert lange. Ist sie vorüber, bittet er zum Abendessen und nimmt am großen runden hinteren Tisch in Begleitung einiger Honoratioren Platz; ihm schräg gegenüber, dennoch zur Seite, der Hotelchef, Christian, mit dem ich mich gleich um elf Uhr treffen werde: (Normalerweise müßten, bevor sie selbst einen Bissen nehmen, wir anderen Gäste darauf warten, denke ich mir, daß als erster er das Glas erhebt; aber so förmlich ging es nicht zu, vielmehr von nun an zwanglos.)
Nun aber dieses hier einstellen, bevor ich zu meinem Termin gehen werde.
Guten Morgen. *******albannikolaiherbst - Freitag, 4. April 2014, 06:05- Rubrik: Arbeitsjournal
 [Sonnabend,
9.06 Uhr.]
Noch immer fünf Tage Meer vor uns, bis wir Mauritius erreichen werden. Das Gleichmaß der Abläufe bringe es mit sich, daß ich mich zunehmend wie daheim fühle – als wäre man schon immer hiergewesen. Erster Kaffee um sieben (deshalb hat es wenig Sinn, früher zum Arbeiten aufzustehen, weil eben noch gar kein Kaffee da ist, auch kein Tee), dazu der Gang erst an Achtern, dann über die Treppe zum Brücken- und noch eins weiter aufs Sonnendeck, dort den schmalen Joggingpfad, der um die Schornsteine führt, entlang bis vorn an den Bug und in Richtung Westen geschaut, einige Minuten, bis ich auf backbards zurückgeh, vielleicht noch ein Schwätzchen mit einem der Passagiere halte, der mir erzählt hat gestern nach, er sei einst selbst zur See gefahren – Fischerflotte, solche Dorsche!, die dann gesalzen auf Gestänge bordquer gehängt und getrocknet, Stockfisch... und damals... das waren T a u s e n d e Delphine! - als das Meer noch nicht überfischt war... oh, ob ich mir einen Bart stehen ließe, „you got the permission?“: scherzhafte Anspielung auf einige complaints, die bei der Rezeption eingegangen, meiner eCigarillos wegen, „der raucht! der raucht!“, so ward gepetzt – doch dazu später etwas mehr, oder auch nicht: ‘s sind halt alte Leute, ich ergab mich drein und dampfe nun nur noch draußen oder in meinem Raum. (Und oben vielleicht, wenn niemand sonst da ist, in der kleinen Hansebar, Sugar, mein Barkeeper, schüttelte nur den Kopf, und mein Seebärenfreund von heute morgen, mit dem ich gestern nach den Stern des Südens gesehen, bemerkte dahin: „Some people always have to complain, it‘s the purpose of their life.“) - Dann, um halb neun, frühstücken. Auch hier schon schränke ich mich jetzt ein: paar Früchte, Haferflocken, Joghurt. Denn kaum hat man danach etwas getan oder auch nur gelesen, ist bereits Lunchtime. Die ich nicht mehr wahrnehme, sondern statt dessen geh ich in den Fitnessraum und trainiere. Ich kann das nur jeder und jedem empfehlen, wer immer solch eine Kreuzfahrt mitmachen möchte: Sparen Sie mindestens eine Mahlzeit aus, Sie werden sonst fett. Weil aber das Essen so gut ist, muß man etwas finden, das den Appetit reduziert. Also an der Grenze der Leistungsfähigkeit trainieren, dann ist an Hunger nicht zu denken, nicht-Trainierte bitte aerob, Trainierte leicht darüber. Man will danach allenfalls schlafen, jedenfalls ruhen. Und hat man das getan, tja, gibt es bereits Kaffee, bzw. Tee und Kuchen. Auch darum mach ich einen Bogen, aber erlaube mir gegen fünf den ersten Martini (shaked, ye know?, not stirred) und einen „echten“ Cigarillo. Und ab sieben gibt es Dinner, entweder als Buffett im Übersee-Club oder à la carte im Waldorf-Restaurant, wobei man auch, allerdings nur bei Vorbuchung, im „Romantic Dinner“ oder „Ristorante Toscana“ speisen kann. Das „Romantic“ bietet heuer ein fernöstliches Menü an; ich habe für heute abend reserviert.
Ja, und dann ist‘s bereits neun, und entweder Sie gehen in die Astor Lounge, um sich entertainen zu lassen, oder Sie sitzen draußen, wenn‘s nicht zu arg regnet, und süffeln wie ich Ihren Whisky. Wenn ich unterdessen - nach nur, ich bitte Sie!, vier Tagen - in der Hansebar aufkreuze, hat Sugar bereits die Flasche in der Hand und schenkt mir nach Maß seiner Augen ein, das dem seines Herzens entspricht. So lange unten, am Kopf des Promenadendecks, die Bespaßung, ist es bei Sugar nahezu leer. Klart das Wetter auf, wird Tanzmusik gespielt, draußen vor der Bar, und gestern nacht tanzten auch vier Paare. Wer seine Ruhe möchte, geht sanft gen Bootsdeck ab und schaut nach, ob dort Herr Lanmeister sitzt.
Noch sah ich ihn nicht, aber ich bin mir sicher, in irgend einer Kabine, da lebt er. Will nur noch nicht in den Text. Statt dessen sammle ich Typen – das ist nicht abfällig gemeint, sondern meint Repräsentanten bestimmter Typologien. Und da nun wird man fündig.
Ich vergaß zu erzählen, daß nach 22.30 Uhr immer noch ein Abendsnack gereicht wird. Jetzt werden Sie die absolute Notwendigkeit begriffen haben, hier den Körper heftig zu fordern. - Nach 22 Uhr sind die Laufbänder im Fittnessbereich auch dauernd in Benutzung – durch die Crew, nicht uns, die wir dann ja trinken. 
Auch die Offiziere essen:
Stilleben nachts auf Achterdeck.Notate im Notizbücherl:Zwei Herren, die allabendlich ihren Brandy trinken, der in weiten Cognacschwenkern serviert wird. Der eine Herr weißhaarig und weißkurzbärtig; sein dazwischen leuchtendes Gesicht wird immer röter und röter, glüht fast schon, nun, am fünften Tag der Reise.  Wie der Himmel wechselt Bootseck, 1805 Uhr. Über die Wolken etwas schreiben.  Tatiana Bespalova, die Geigerin, jeden Tag mehrere Stunden üben, zusammen mit ihrer Partnerin am Klavier, Kateryna Rodina; sie spielen sogenannte Klassik, auch davon, freilich, nur die Evergreens. Tun sie‘s im Captain‘s Club, Mitte Promenadendeck, ist das bisweilen herzrührend, weil oft kaum dreivier Leute zuhören, wenn es hochkommt, zehn. Ein Schicksal erzählt sich hier, eines von vielen Schicksalen, denen wir an Bord begegnen – bei der Besatzung, die Passagiere sind so und so privilegiert. Als Charlie gestern nacht Ray Charles sang und, klar, grauslich wie immer, Elvis, aber auch das Lied eines schwarzen Sängers, dessen Name ich vergessen habe, egal, nein, nicht egal...  ... wie auch immer: es war ein Sehnsuchtslied für alle fern der Heimat, da stand neben mir eine der ukrainischen Serviererinnen und sang leise mit. Und plötzlich liefen ihr die Tränen – wie hatte sie erzählt? bereits zwei Jahre fort von daheim? und einen fünfjährigen Jungen... - So sei das - sagte sie‘s nicht so? - Leben? Immerhin d i e Kraft hat er, der Kitsch, den Pragmatismus auszuhebeln. Und täuschen wir uns nicht! Das funktioniert nicht nur bei „einfachen“ Menschen.  Wie der Bespalova die Sehnen hervortreten, rechts am Hals über die Schlagader dort hinweg, fast ein Wellenstrang, selbst, wenn sie zur Seite gewendet mit besonderem Kraftstrich spielt.  Und andere rührende Bilder:
Das alte, sehr alte Ehepaar, im bereits Dunklen am Bootsdeck, Hand in Hand, beide können gar nicht mehr recht gehen, aber er, so Kavalier!, hält ihr die schwere Tür auf: ein Ritus, der wirklich Zeit braucht. Diese Reise hier gibt den alten Menschen, was Sie vielleicht nicht mehr haben, gibt ihnen davon eine gefühlte Unendlichkeit: eben Zeit. (Sehen Sie? Wieder hat mir Herrn Lanmeister auf die Schulter getippt: zu sanft allerdings, um mich erschauern zu lassen.)  „Manchmal“, notiert Herr Lanmeister in seinem Kopf, „springt eine sehr kleine Reiterin auf eine der Wogen und läßt sich hinauftragen oder gibt ihr die Sporen, um sich hinauftragen zu l a s s e n. Dabei winkt sie uns zu, vielleicht auch nur mir, vielleicht kann alleine ich sie sehen. In den letzten Tagen, oder waren es Wochen, scheint sie mir sich immer häufiger zu zeigen.“  Heute ist das Gesicht des Kurzbartmannes n o c h etwas röter geworden. Es glüht nicht nur mehr, sondern strahlt. BILD WELLEDie bisweiligen Ungewißheiten, wenn das Schiff schlingert: surreal. Man weiß nicht, ob Einbildung oder Realität – besonders übrigens beim Sport, weil sich da nicht mehr sicher entscheiden läßt, ob nicht nur der eigene Kreislauf etwas überfordert wurde.  Und wieder die Bespalova, gestern nacht, „klassisches“ Konzert in der Astor Lounge, diesmal nun endlich vor vielen Leuten. Wie wunderschön, wenn sie die Waden streckt bei einer Bogenführung, die der gesamte Körper mittut: aus der Wade sich drehend hinauf ins dreifach gestrichene c oder d. Beide Damen, übrigens, auch die Pianistin, tragen ausnehmend schönen hohe Pumps unter ihren schmalen Fesseln. Der Rotgesichtige – unterdessen gleißt er - hat dazu sein linkes Bein über die hölzerne Sessellehne gelegt. (Wie halten wir, als Musikerinnen, die ständige Wiederholung aus? und aus, was wir spielen? Welch eine Wohltat war unser Bach, vorgestern, das Air, und füllt nun heute das Ave Maria den Raum! Wir spielen darüber, Zigan!, hinweg, lösen all die Wehmut auf in unser Temperament: zu küssen, als ränge man um Luft.)  Es wiegt sich das Schiff zu Straussens Blauer Donau. Und die Conferencière spricht „Massenet“ „Me‘sse-nett“ aus und „Fauré“ wie die englische Vier: „Gay(!)briel Four“. Besonders hübsch war auch, daß das Programm aus „Après un rêve“ ein „Apres Unreve“ (Ey‘press A‘nreyve {Unrave}) gemacht hat.  Meine erste Sternschnuppe. Unter dem Kreuz des Südens. Nachdem das Konzert vorbei war.
Und wieder auf dem Bootsdeck, allein, der Nachtsog des Meeres. Darüber werde ich eigens schreiben: gesondert.Vielleicht ein Gedicht. Die Reiterin, die Gregor Lanmeister sieht, hat auch ein d u n k l e s Gesicht. Wie schrieben mir einige Leser? „Kommen Sie wieder zurück!“  albannikolaiherbst - Samstag, 5. April 2014, 06:29- Rubrik: Arbeitsjournal
 [Sonntag,
8.50 Uhr.]Etwa die Hälfte, vielleicht etwas mehr, liegt für die Überquerung des Indischen Ozeans hinter uns; wir fahren noch immer durch Regengebiet, heute früh sind auch die Wellen etwas höher, mir durchaus angenehm, aber nicht allen; und erstmal hat sich, es gibt sie also noch, die Sonne sehen lassen: pünktlich zum Frühstück:  Aber wer hätte das für möglich gehalten? ich doch am allerwenigsten: daß ich eines Tages beginnen würde, demn Luxus einer Suite zu schätzen? Doch es war so. Den ganzen Tag über Grau und Grau, wenngleich das Meer in diesen Breiten selbst bei Meilen über Meilen schwarzverhangenem Wolkenschild mitunter ein nicht faßbares Blau annimmt, das gleichzeitig tief und dunkel und aber eben auch hell ist... - jedenfalls war ich draußen über die Decks gestreift, hatte mich immer wieder vollregnen lassen, es ist ja nicht kalt, und in meiner Kabine, das war die erste konkrete Lockung, waren dumpf und laut die Schläge des Schiffsbugs in die Wogen zu hören; es geht von meinen Fenstern, die bis zu meinen Füßen hinabreichen, vielleicht vier Meter bis an den Meeresspiegel hinunter, nicht mehr; da bekommt man auch die fliegende Gischt mit, die aufgeschossen kommt. Und statt mittagzuessen hatte ich einen ziemlich harten Workout absolviert, Kraft u n d Kondition und obendrein zwei Saunegänge angefügt, tiefunten im Spa-Bereich des Schiffs, einen Aufguß inklusive, der mich schaffte, geb ich zu, und statt nun kalt zu duschen, schlang ich mir das Handtuch um die Hüften und hing den Bademantel lose über die Schultern und eilte die sechs Treppen zum Bootsdeck hinauf, wo außer mir, weil es so goß, niemand war, und zog mir einen der Liegestühle an die Reling, breitete den Bademantel darauf aus und ließ mich hineinfallen und bestürmen und beregnen. Grandios, dies so mitten auf einem Ozean, und man pfeift nicht nur aufs schlechte Wetter, sondern dreht es sich zur Wohltat herum.
Doch halt nicht lange. Irgendwann geht die Fröstelei los, da sollte man heiß duschen. Was man sowieso tun sollte von Zeit zu Zeit. Und dann überkam‘s mich: Ich hab doch eine Couch, kann mich auf sie legen und von ihr aus hinaussehn, die Wellen ansehen, die Brecher ansehen, die Gischt ansehen, und eigentlich könnte ich hier lesen und/oder dösen und/oder nachdenkend träumen. Und so, nachdem ich mir noch eine Bloody Mary besorgt hatte, t a t ich:  >div align=justify>In dieser Vefraßtheit, freilich, komme ich mit dem Roman nicht voran, oder allenfalls kaum. Außerdem merke ich, wie meine Schreibdynamik von ihm, dem Roman, durch diese Berichte abgesogen wird; was ich eigentlich vorhatte, nämlich das ganze Buch hier an Bord zu schreiben, wird sich nicht mehr realisieren. Ich zerteile mich zu sehr: zum einen in den „Mich“, der Ihnen diese Erzählungen schreibt, zum anderen, was aber wichtig und richtig ist, in das „Mich“, das hört, für das Hörstück, und dafür auch Gespräche führt und recherchiert und beobachtet, und schließlich noch in das „Mich“, das einfach nur diese Reise genießt und auch jede Unbill – sie ist immer nur scheinbar – in ein Erlebnis herumdreht, das ich nicht missen wollte. Es ist wirklich grandios, den Ozean bei Regenwetter, immer hart an der Kante des Sturms, zu überqueren, und berauschend, minutenlang nichts zu tun, als Wellen zu beobachten, ja Welle im Inneren selbst zu werden. Da ist dann für Gregor Lanmeister aber kein Platz mehr, oder der war es noch nie, und deshalb sehe ich ihn auch nirgends.
Aber andere. Ich habe begonnen, Namen zu vergeben, Charakternamen wie den der „zwei Abenteurer“, für Patrick und John, dort sitzen sie am Achterdeck und, ja, Abenteurer tun das, rauchen:  Ich bin mir sicher, in dem Roman werden sie eine Rolle bekommen. -
(Wenn ich hier aus dem Fenster sehe, ich muß nur den Kopf nach „starboard“ wenden, habe ich gerade den Eindruck, wie flögen dahin!

Außerdem hat‘s wieder aufgeklart, in den wenigen Zehnminuten, die ich hier nun sitze und tippe)
- Und so auch der Mann mit der Pudelmütze, der den ganzen Tag über auf dem Achterdeck in der überdachten Raucherecke sitzt und Kreuzworträtsel löst, eines nach dem anderen; dazu trinkt er vom frühen Morgen an Bier, leise, aber entschieden. Er aber auch, wie alle die anderen Passagiere, sind auf die Sonnenseite des Lebens gekommen, der Alters, verglichen mit jenen alten Menschen, die in Berlin लक्ष्मी betreut. Hier wie dort lagert das Sterben am Weg bereits, aber für meine Mitreisenden und, ja, auch für mich, hat es ein Lächeln aufgelegt. Wohin wir geraten, ob aus eigener Befähigung, eigenem Kampfgeist oder ob aus Mangel und angeblicher Selbstverschuldung, letztlich, sieht man den Gründen bis auf den Boden, ist es allein eine Frage des – Glücks. Ob man Glück gehabt hat, so oder so, oder nicht. Daß dieses, Glück gehabt zu haben, eine ontologische Kategorie ist, wird mir gerade erst bewußt. Es könnte einer der entscheidendsten Gedanken Gregor Lanmeisters sein. (Zum Beispiel, daß sich die Leute, die hierher gekommen sind doch wohl, um auf dem Meer die Zeit zu spüren und wie sie eben stillesteht, sich dann zusammenfinden, um sie zu – vertreiben; so geht das Wort: zum„Zeitvertreib“ ... das Kostbarste vertreiben, das wir haben: unsere Zeit:  „Ich glaube eher, es lebte sich hier.“ Glaubte oder „meinte“? Jedenfalls Rilke, Malte.)  Abends setzte ich mich zu Christian, dem Hoteldirektor – das wäre wohl auf Schiffen, die keine Passagiere befördern, der Quartiermeister, oder wär es gewesen -, und dem Chef des Servicepersonals und fragte und ließ mir erzählen: etwa, wie man es hinbekommt, daß das Gemüse ständig frisch ist, eben nicht gefroren und wieder aufgetaut, das müssen riesige gekühlte Lagerräume sein, und sind es; erfuhr von der bisweilen diffizilen Versorgungs-Logistik sowohl von hier auf der Astor als der von anderen, meist sehr viel größeren Schiffen mit eintausend und mehr Leuten allein an Personal, wo deshalb eng an eng die Passagierkabinen, „das rechnet sich nur über Masse“, so daß für die Lagerräume kaum mehr ein angemessener Platz bleibt, „zumal“, so Christian, „wissen Sie, als die Astor gebaut wurde, war sie von vornherein für Weltreisen angelegt; nicht so die riesigen Kreuzfahrtschiffe; die waren erst einmal nur für Wochentouren in Europa gedacht. Dann begann der Markt zu boomen, alles änderte sich, und diese Riesendampfer sind mit Bedürfnissen konfroniert, zu deren Erfüllung sie nie entwickelt wurden.“ Ich werde in den nächsten Tage gucken gehen dürfen, werde auch mit der Mannschaft essen, die Seiten, sozusagen, wechseln; vielleicht ziehe ich auch einen Blaumann an.  Nachtsog NachtsogDann steh ich an der Reling, Bootsdeck wieder, bin allein, denn es regnet luv, in scharfen dichten Spitzen. Unter mir formen sich die Wogen, zerfallen wieder, klatschen, rauschen, um die beiden Schornsteine und sämtliche Verstreben sing der Wind. Ich beuge mich weiter vor. Besser, ich steck mein Ifönchen in die Hosentasche, stecke alles hinein, was ich in Händen halte, denn der Sog ist so groß, es fallen zu lassen. Es würde fallen und sinken, immer weiter sinken, Hunderte, ja Tausende Meter hier. Ich weiß das genau, bin mir bewußt, aber es ist solch ein Reiz da, solch eine Lockung, die ihn halb zog, halb sank er nicht hin, sondern riß sich noch beizeiten los, schritt das Deck bugwärts weiter, öffnete die Tür und ging hinein und zur Bar, um seinen Whisky zu holen. Und hat nicht bemerkt, wie jemand ihn beobachtet hat. Mir wird das erst klar, als ich, in meiner Kabine zurück, vom Nachtsog ins Notizbuch skizzier und mir dafür die Szene noch einmal vergegenwärtige. Er ist also d o ch da. *****Noch vier Tage der reinen See. Dann werden wir Mauritius erreichen, „L‘Île Maurice“. 
Sugar sinniert in den Regen.
MS Astor, nachts.
Oberes Achterdeck vor der Sonnenterrasse.*******[12.20 Uhr (6.4.).
27 51‘02‘‘ S/ 79 55‘14‘‘ O
Launisches Windwetter, aber immer wieder kommt kräftig die Sonne jetzt durch. Übern Bug gehen bisweilen Gischtnebel, wenn sich drunten eine Welle direkt am Schiff gebrochen hat. Die Gischt anderer Wellenkämme, die sich weiter fort auf See, aber gegen den Wind brechen, wehen gleich fatamorganen Fahnen, stehen sekundenlang über dem Meer, zerstäuben. Es ist, als näh,men manche Wogen Anlauf, die Astor hebt sich und senkt sich, aber versucht, die Dünung zu schneiden. Wir „machen“ 17 Knoten.
Ich steh lange draußen, erst oben am Achterdeck, dann vorn am Bug, um den nicht nur singenden, nein, in den gespannten Drähten und Haltungen jaulenden, lauthals jaulenden, wimmernden, heulenden Wind aufzunehmen. In der Ferne begegnet uns ein Riesentanker, zu weit weg indes, um zu grüßen; die Kapitäne werden über Funk miteinander gesprochen haben: 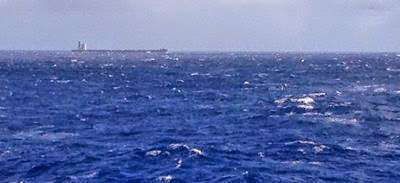 Auf den Sonnenterrassen werden bereits die Cocktails serviert, allerdings die Gäste auch wieder vertrieben, weil uns eine Wolkenmasse, so sieht es aus: verfolgt. Ich warte auf sie, an die obere Relign gelehnt. Schon sind wir eingeholt, und sofort beginnt es zu sprühen, aber nicht nur von, wie zu erwarten, achtern, sondern auch vom Vorne her, das un sim Rücken liegt: Wir sind von den Wolken in die Zange genommen.
Die Wellen schaukeln sich auf, werden länger, immer länger, auch höher, so daß das Traumschiff mitschwingen muß über seine ganze Länge, ganze Höhe. Aus den Fenstern meiner Suite, in der ich das nunmehr schreibe und die aufgenommenen Töne als Dateien sichere, sieht es wieder aus, als ob wir flögen, und Schaum ist - weißer, als wenn er Schnee wäre, Feim: selbst hier herein hört man das dumpfe schlagende Klatschen, und sogar das Sirren, wenn die Milliarden Bläschen platzen, meine ich, vernehmen zu können. Mit einem Mal ist es nachtschwarz, hat sich in Bruchteilen von Sekunden eingedunkelt, klart aber schon wieder auf, und im ganzen Rund der Horizonte gleißen Lichtinseln her.
(Meine Haut schmeckt nach Salz, meine Handflächen fühlten sich taub an, zugleich schmierig; auch dies kam vom Salz, das auf den Decks wie Staub auf jedem Holz liegt; es bleibt haften an den Fingern, ist leicht klebrig. Das Meer ist hoch in die Luft gestiegen. 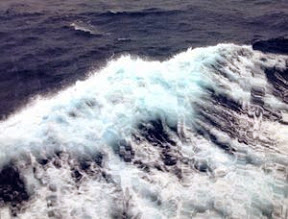 albannikolaiherbst - Sonntag, 6. April 2014, 08:52- Rubrik: Arbeitsjournal
 [Montag,
8.25 Uhr.]Als ich erwachte, gleißte die Sonne bereits, vom Meer reflektiert, zu mir herein: eine weitere Stunde haben wir gestern nach die Uhr zurückstellen müssen:: Ich irrte mich::: wir gewinnen an Zeit, indem wir in Ihren Morgen reisen; der Unterschied zu dem Ihren beträgt nunmehr nur noch vier statt der Hongkonger und Fremantler sieben Stunden. Dafür (seltsame Logik-Verbindung) scheinen wir die Regenzone durchfahren zu haben, schauen Sie sich‘s selber an: BILD 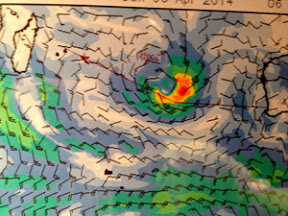 . Dies bedeutet nun aber, daß die Verwendung von Sonnenschutzmitteln obligatorisch wird; schon gestern, da die Sonne immer wieder durch die Wolken kam, besaß sie enorme Kraft; abends spannte die Glatze. Insgesamt war der Tag sehr angenehm, die warmen Zwischenschauer erfrischten, und nachts stand ich unterm Kreuz des Südens und sag nicht nur dieses, sondern in die Milliarden Sterne empor.
Neben mir Johan, am Bug, die Augen ferne vorausgerichtet, ich stellte mich mit dem Whisky zu ihm, leise sprachen wir. Dann erzählte ich von dem Cellofreund >>>> und seinem Angebot. Johan, sich zu mir wendend, „Das kann doch nicht wahr sein!“ Er lachte kurz, lachte wieder. „Wir sind hier im tiefsten Niemandsland, es gibt nicht einmal einen Schiffsverkehr, der der Rede wert wär... und da erzählen S i e mir.... Das ist hier W ü s t e!“ „Doch doch“, bestätige ich abermals, „ich brauche nur die Adresse... und den Namen, selbstverständlich.“ Er lacht ein drittes Mal, seufzt dann: „Nicht mal das Internet funktioniert doch richtig...“ „Stimmt, das ist nervig. Ich brauche fast zwei Stunden morgens, mitunter geht allein eine Viertelstunde dafür drauf, daß man eingeloggt wird... wobei das aber schon als zu bezahlende Zeit zählt...“ Er: „Das habe ich längst aufgegeben. Aber nun, Ihr Leser.... es ist wirklich nicht zu fassen.“
Übersprunghaft möchte er wissen, ob es in Deutschland jetzt kalt ist. „Nicht mehr“, sage ich, „glaube ich. Als ich fortfuhr, hatte schon der Frühling begonnen.“ „Oh, und dann sitzen, nicht wahr?, alle draußen vor den Cafés, auch wenn sie Wintermäntel tragen müssen...“ „Und Handschuhe, ja.“
Unten am Achterdeck erzählt John, der Abenteuer 2, vom Gambling: Hunderennen in Hong Kong, Pferderennen in Australien, er gamble aber nur noch, unterdessen, Roulette. Und vorhin, Einsatz 5 AUD, beim Bingo in der Astor Lounge, „I made eightyfour...“ Wiederum zuvor das Ehepaar im Waldorf beim Dinner; er mit zwölf nach Australien gekommen, sie stammt in gerade Linie von den ersten britischen Siedlern ab, nein, nicht von den Gefangenen... Jetzt wollen sie, angekommen in London, hinüber in seine alte Heimat, die Niederlande, und Verwandte besuchen, „in Holland“, sagt er. Ich taste mich vor, erzähle, weshalb ich hier bin, muß immer wieder erklären, was ein „broadcast play“ ist, ein treffenderes Wort für „Hörspiel“, geschweige „Hörstück“ fällt mir nicht ein. Umschreiben: „It‘s a combination of feature and spectacle für radio, composed from stories, interviews, original sounds“ und so weiter. Vielleicht werde ich demnächst von einem Roman zum Anhören sprechen, „a novel to be listened to“, irgend sowas.
„Look“, sagt John, er Brandy, ich Whisky, „I know, you like it... so take one.“ Er hat, wo auch immer, ein gänzes Päckchen Cigarillos aufgetrieben, schmale Stifte, „try!“ Patrick, der zweite Abenteurer, ist heute abend nicht zu sehen; ich fantasiere, daß er Geschäften nachgeht, seltsamen, für die er an Bord acquiriert. Das ist selbstverständlich schon der Roman. Selbst hier ist die Wirklichkeit nur pragmatisch, nüchtern, nicht selten banal; sie braucht Aufladung. Die Sehnsucht, immer, ist stärker als die Realität. Sowohl erfüllter wie erfüllender.  Ich wachte also im Gleißen auf, schob mir die Kissen in den Rücken, sah mich um:  Dann etwas übergezogen und zum ersten Kaffee ans Achterdeck. Drunter, auf dem Rundgang außerhalb des Waldorfs achtern, ist Ruheplatz für die Servicekräfte; eine junge Dame ruht sich dort dem gleich beginnenden Dienst entgegen, der nicht selten bis spät in die Nacht geht. Einer der sehr wenigen Orte auf dem Schiff, der nur für sie ist: Finden das nicht auch Sie schön, es zu betrachten? Ich tat das fast eine Viertelstunde lang.
Noch zehn Minuten, bis das Morgenbuffet eröffnet wird. Paar Schritte nach Backbord, dort an die Reling, und plötzlich... das gibt‘s doch nicht! silbern, fein die zu Segelschwirrern ausentwicklenten Flößchen... ein knapp unterarmlanger fliegender Fisch, der gar nicht mehr eintauchen will, nicht zu fassen, wie weit ihn die Luftströmung trägt. Dann ist er wieder weg. (Ich bin nicht gut im Fotografieren, merke es immer auf neue; schon gar nicht mag ich mich mit der Kamera in irgend einen Anstand legen; irgend eine Übertretung, eine Blasphemie, wär immer dabei, anders, als wenn ich beschreibe... Auffällig, daß ich diese Scheu nie verloren habe, ich, der ich in Übertretungen lebe. Ich spüre etwas Heiliges, das ich durch Fixierung nicht zerstören möchte. Andererseits fotografie ich ja oft, aber immer aus dem Handgelenk, immer etwas provisorisch, zufällig, skizzenhaft... Zum Beispiel mein Frühstück: BR>  ). ).Aber auch die Tiefe ist nicht selten nüchtern. Wohin, zum Beispiel, mit dem Abfall? Denken Sie an die Fäkalien täglich. 300 Passagiere, ebenso viel Personal, macht 600 mal, niedrig übern Daumen gepeilt, ein halbes Kilo, sind 300 Kilo Scheiße täglich, in der Woche 2100, auf der gesamten Tour 12.600. Und ich spreche nur von einem kleinen Kreuzfahrer; rechnen Sie das mal auf die Aida hoch, mit an die 2000 Passagieren...
Also dieses. Dann die Essensabfälle. Die übrigen Abfälle.
Ich frage nach.
Organischer Müll wird gepreßt, dann wird ihm das Wasser entzogen. Hochtechnisierter Standard. Die zerpulverte Trockenmasse wird ins Meer gegeben, „Dünger“, sagte Christian, „ein besseres Fischfutter gibt‘s nicht“. Ebenso wird mit Glasabfall verfahren: bis zur Konsistenz von Sand zermahlen, dann gepreßt. Und verklappt. Kein Plastik aber. „Aber die Wirklichkeit“, so Christian weiter, „die sieht leider anders aus, oft. Zum Beispiel dort, wo sie gerade das abgestürzte Flugzeugs vermutet wurden, aufgrund von Messungen, die das indizierten... Nichts als ein riesiger wandernder Abfallteppich.“ *Bläue.
Bläue.
Der blaue Planet.
(Von den Pythons gehört, die in Florida eingeschleppt wurden, da gar nicht hingehören – aber was gehört schon wo hin? Kartoffeln nach Europa, Palmen in die Karibik? – und die sich nun derart vermehrt hätten, daß Jagdlizenzen auf sie ausgestellt würden, sozusagen Kopfprämien. Ebenso, erzählt das Ehepaar von gestern abend, die australischen Krokodile, die unter Artenschutz stehen, bzw. standen. Sie hätten sich derart vermehrt! - Aber wissen wir, was wir aus Reden erfahren? Der silbern blinkende, ja blitzende Fliegende Fisch. Ich dachte erst, wo einer sei, seien auch andre. Wartete. Doch keiner kam mehr nach.)  Bläue, so weit das Auge reicht. So weit die Wünsche tragen: Silber. Ein paar Quellwolken. So jetzt der Blick aus dem Fenster (daher die Streifen: Salzstreifen, außen auf dem Glas der Scheibe). (9.50 Uhr.) (17.55 Uhr.
Sir Granville Bantock, Sapphic Poems.)
Die Abläufe an Bord eines solchen Kreuzfahrers ist quasi immer gleich: Frühstück zwischen 7.30 und 10 Uhr, entweder am Buffet des Überseeclubs oder gedeckt und bedient im Waldorf; Mittagessen zwischen 12 und 14 Uhr, dito; Tea Time mit enorm vielen Torten und Gebäck von 15.30 bis 16.30 Uhr; Dinner von 18 bis 21 Uhr, wobei Sie neben Buffet und Waldorf nun auch die Möglichkeit haben, die Separées zu buchen, sei es des Ristorante Toscana, sei der des Asian Chili Restaurants; und zwischen 22 und 22.30 Uhr werden noch einmal Snacks gereicht, die von Abend zu Abend variieren.
Dies ist das Skelett solcher Fahrten; die Sehnen sind die Bars, und an ihnen hängt die Muskulatur des Entertainments, das bereits morgens mit Glücks- und Gesellschaftsspielen und dem einen und/oder anderen Kurs beginnt, sei es Yoga, sei es Handarbeiten; überdies wurde ein „Poetry Corner“ eingerichtet, eine Art Kreatives Schreiben, halbstündig täglich: hier schreiben die Passagiere, die das mögen, Gedichte über die Fahrt.
Hinzu kommen Tanzkurse, auch ein Kurs in basaler Harmonielehre wird angeboten, auch ein bißchen Klavierunterricht, und nachmittags gibt es kurze Tanzkurse, deren Lernerfolge gleich nachts ausprobiert werden können – nach den großen Shows in der Astor Lounge, aber auch hinter der Hansebar am oberen Deck, wo nach 22 Uhr immer noch mal aufgespielt wird.
Das alles ist, zugegeben, nicht ohne eine allerdings liebenswerte Banalität; niemand ist ja gezwungen teilzunehmen; es gibt die stillen Räume nach wie vor, nicht nur seitlich am Promenadendeck, wo alte Damen sticken, nicht nur im Kartenspielraum, der auch oft gut gefüllt ist, nicht nur in der Bibliothekl, wo riesige Puzzles gelegt werden, sondern eben die Außenränge der Bootsdecks sind ohne jede Bespaßung; dort schaut man einfach, wie Gregor Lanmeister, auf das Meer, oder schläft, oder liest, oder unterhält sich leise; und vorne, am oberen Bugsdeck ist ohnedies so gut wie niemand jemals.... nur nachts treffen sich dort stille Schauer, um ob der Weite zu erschauern, die wir durchmessen. Vor allem aber derjenigen, die wir überfahren: Was unter uns ist, Tausende Meter, wer weiß es, wer spürt es?
Ich kam vom Training und legte mich zur Ruhe. Das Bootsdeck leerte sich zur Tea Time. So war ich alleine, als der, für mich nur, zweite Fliegende Fisch sprang. Er sprang Richtung Norden, also auf den Äquator zu. Ich sah ihm nach, vielleicht daß noch ein nächster käme... und da?? was war d a? Scharf erhob sich das Dreieck der Rückenflosse und ließ darunter den graubuckligen, glänzenden Rücken sehen, zu langsam aber, und zu flach, für einen Delphin, und für einen Hai, oder nicht), zu flachgestreckt. Fast eine ganze Minute lang ließ dieser Botschafter der Tiefe sich unaufgeregt dahintreiben, es war keine Täuschung. Dann tauchte er ab, auch dies ohne eigentlich Wille und Absicht, sondern, als ließe er sich gleiten wie große segelnde Vögel.
Ich habe keinen Zeugen, hatte auch die Kamera nicht mit, die ich ohnedies fast immer auf dem Zimmer lasse; und vom Sport noch war dort auch mein Ifönchen verblieben. Andererseits, ich wollte den Moment trinken und nicht in die Distanz des Dokumentes gehen. So werden Sie mir glauben müssen, und glauben Sie mir nicht, was tut‘s? ***Ob ich den Seegang nachts auch so sehr gespürt hätte, fragte mich auf der Treppe ein älterer Herr; vielen bin ich vom Ansehen bekannt, ich falle auf, nicht nur des Alters wegen, sondern auch wegen meiner Kleidungswechsel zum Abendbrot, und weil ich diese Dinger rauche. Nein, ich hätte nichts gemerkt. - Es sei aber, so wieder er, doch ziemlich heftig gewesen. So hab ich das wohl überschlafen.
Dafür, vor einer knappen Stunde, geradezu aufregende Wolkenformationen voraus, sowie zu den Seiten: hell und lichtblau gen Norden, dunkler gegen Süden, und voraus Schlösser, Welten, Luftschiffe, die Phantasten konstruiert haben und von denen bisweilen dunklere Lifts, und transparent vibrierende, bis auf die teils ultramarine, teils grausilberne Meeresoberfläche hinabgehn, teils leuchtet sie türkis – vielleicht, daß diese Wolkenschiffe Trinkwasser aufnehmen müssen, in den Lifts wird es entsalzt... oder es gibt einen regen diplomatischen Austausch, wer weiß das? Man spürt bisweilen Verstimmungen zwischen den Himmels- und den Meeressphären, dann schiebt sich eine Ballung vor die Sonne, als Drohgebärde vielleicht oder um wirklich nur die Verärgerung auszudrücken, die so ein Engel oben hat oder unten ein mächtiger Neck, wer weiß, wer weiß... doch schnell klärt sich das wieder, und abermals wirft die Sonne Millionen silberner Pailletten über das Wasser bis ganz zu uns dahin...
So stehe ich hier bei meinem abendlichen Glas Campari-Soda, das auf dem gut breiten Holz der Reling steht, und sinne der kommenden Nacht entgegen und daß ich dann abermals die Lustbarkeiten fliehen werde, zwar, immer schau ich mal kurz hinein, lasse mich sehen und grüße und flirte ein bißchen mit dem Personal, aber möchte doch immer schnell in meine gute Fremdheit zurück. Sie beinah alle glauben an den Pop, „Abba“ gab es gestern, warum ich denn nicht käme? Ich mag nicht erklären, mag nicht sagen, daß ich Abba nicht mag, auch Elvis nicht, daß ich nicht dazugehöre und die Beatles seit jeher zum Davonlaufen fand. Niemanden muß das etwas angehn, es ist alleine meins. Nur wünschte ich mir, daß die beiden Damen, die Geigerin, die Pianistin, wieder ein bißchen Bach spielen, wieder ein bißchen Schubert spielen, aber ohne, daß man das Klavier künstlich verstärkt. Auch das hört niemand hier, daß es dann nach einem dumpfen Pappkarton klingt, einem hallenden Klangsarg. Dennoch dringt, was sein könnte, heraus. Die Utopie ist gegen schlechte Umstände niemals empfindlich; sie beharrt in ihnen auch - -
Es bleibt, daß wir eines der Sieben Weltmeere durchmessen. Da ist es egal, ob das Wetter freundlich ist oder nicht. Denn über den Tag wechselte es wieder, es regnete auch noch mal, dann schien wieder die Sonne. Immerhin wurde in den kleinen Swimmingpool des Achterdecks das Wasser wieder eingelassen; gestern war er abends geleert worden. „Wissen Sie, das kann gefährlich sein, wenn die See so dünt: dann bauern sich Wellen in dem Pool auf, und wer dann nicht völlig sicher ist beim Schwimmen, kann erfaßt und gegen die Wände geschlagen werden. Solche Unfälle möchten wir wirklich gerne vermeiden.“ Für geübte Schwimmer ist der Pool ohnedies zu klein: zwei Stöße reichen, und man kommt gegenüber schon an. Außerdem, ich bitte Sie!: 31 Grad Celsius Wassertemperatur.
Unversehen ist es nachtschwarz draußen. Ich stehe kurz vom Schreibtisch auf und trete an eines meiner beiden großen Fenster und hebe den Kopf: Dort scheint der Mond, genau eine Trabantenhälfte, und Venus ist zu ihm in seinen und meinen Abend getreten: 
******* albannikolaiherbst - Montag, 7. April 2014, 16:05- Rubrik: Arbeitsjournal
 [Dienstag,
7-25 Uhr.
]Das Schlechtwettergebiet ist durchsegelt („a ship is sailing sagt die englische Sprache nach wie vor, auch dann, wenn es sich um ein Motorschiff handelt), bereits zum Frühstück war es ausgesprochen warm. So saß ich in der Sonne und sann der gestrigen Nacht nach, die ein kleines Opfer von mir wollte.
Ich war von den beiden Konzerten hochgekommen, erst einem mit Jazz-Standards, die, freilich, selbst schon Schlager sind, aber bisweilen rief aus dem Publikum jemand „... and Stan Getz, too!“, und Nicolae Petrovici ist mit an Bord und spielte das Klavier, der seinerzeit, bei meiner ersten, dieser sehr viel kürzeren Kreuzfahrt, dem Freund und mir zur Seite gestanden, als wir Asche einer Freundin in die See versenkten... er also improvisierte so fein über ein „Summertime“, das sich alleine dafür das kurze Hineinschaun gelohnt hat:  Technik in der Astor-Lounge. Technik in der Astor-Lounge.Danach wieder zu den beiden Damen, der Geigerin, der Pianistin, in den Captain‘s Club, eine halbe Stunde ebenfalls zu Schlagern gewordene Klassik (ich werd die beiden wirklich bitten, einmal etwas anderes zu spielen, vielleicht Skrjabin wirklich; es wird ihnen so oft nicht geschehen), dann mit meinem Drink in meine Kabine, um die Töne zu überspielen und ein paar Notizen zu machen, und als ich schließlich im Dunkeln auf das mit Background Evergreens moderat beschallte Achterdeck hinaustrat, wo noch einige Paare beim Cocktail beisammen, saß nun auch Johan wieder dort, ein bißchen steif vor Zurückhaltung seines diskreten und herzenswarmen Begehrens, doch in seiner, hätte meine Omi gesagt, „schmucken“ weißen Uniform, und bei ihm saß die Geigerin. Beide lachten, er blieb zurückgelehnt, auf Abstand, aber alles an ihm hätte sich vorbeigen, ihr zubeugen mögen, vielleicht nur einmal kurz eine ihrer gesegneten Hände berühren... - Ich sah mir das von „meinem“ Pult aus an, wo ich oft zu stehen pflege, gleich neben den Starboardsteps zum Sonnendeck, nicht überdacht; wiewohl außerhalb des für mein Empfinden immer zu dunklen Raucherbereichs, darf ich dort meine Cigarillos rauchen, niemand bisher hatte etwas dagegen.
Brillant glühten die Sterne aus dem Universum auf uns herab, aber ein scharfer, dennoch handwarmer Wind ging, eine durchaus steife Brise, die die breite Persenning knallen ließ, mit der zwei Drittel des Achterdecks überzogen sind, und auch bisweilen Wolken schob, weit oben über uns nach Osten zurück. Ich trage abends lange Schals, und der jetzt umflatterte mich, als ich nach Achtern weiter schritt, um hinten an der Reling auf das Meer zu sehen und dort nun einen der eCigarillos zu rauchen. Mit einem Mal schoß mir der Wind unter die Achseln, schoß mir zugleich den Nacken und vorne über die Brust herauf, erfaßte den Schal und hob ihn, entschlang ihn mir, trug ihn ---- Wie eine elfenbeinfarbne und blaßrote Fahne wehte er in seiner gesamten Länge, langgezogen, ja, auch wie zum Mangeln auseinandergenommen, winkend hoch überm schäumenden Fahrwasser, dem nachtglitzernden, wehte und wehte und senkte sich und legte sich wie ein schmales Blatt, das sich vereinigen möchte, dem Wasser auf, mit dem er verschmolz. Und dann war er weg.  Ich war nicht betrübt, ich wußte, daß ich etwas hierlassen müsse, nicht aber, was. So hat das Meer nun selber gewählt. Und ich muß sagen, die See hat Geschmack. Seide, handgearbeitet, der tuchfeine Schal war meiner seit meinem ersten Aufenthalt in Indien; das ist 1997 gewesen, fünfzehn Jahre also her. ***Das Leben auf See, auf solch einem Schiff, ist vor allem jenseits von uns Passagieren ein ganz eigenes System, Sozialsystem;: zwar sind die Verträge besonders für die Servicekräfte nahezu immer fest terminiert, vier Monate, manchmal sechs, seltener anderthalb Jahre, und danach weiß man erst mal nicht weiter, reist nach Hause, verbringt dort ein paar Monate, vielleicht auch nur Wochen – bis der nächste Anruf kommt: ob man von dann bis dann Zeit habe, ob man sofort einspringen könne für jemanden Erkranktes und so weiter. So sind viele bereits auf vielen Schiffen gewesen, bisweilen miteinander, bisweilen mit ganz anderen Menschen, und die Schiffe werden untereinander erzählt, er gibt Hierarchien des Respekts, etwa, wenn, wie hierzuschiffs der Manager des Küstenexkursionen, Glenn Wallis, jemand auf der Queen Mary gefahren ist, in seinem Fall der Queen Mary 2; es ist ausgesprochen deutlich, welch eine Autorität er davon genießt. Und auch die Musikerinnen und Musiker sind oft auf Keuzfahrtschiffe, man kann das wirklich sagen, spezialisiert, kennen die Bedürfnisse der Passagiere, wissen, sie zu erfüllen, auch wenn das zuweilen, gewiß, mit einer aufgegebenen Sehnsucht einhergeht, etwa der nach internationalen Podien und vielleicht auch einem Publikum, das, wie man selbst war, der Kunst verfallen ist, und: - wie man selbst, stell ich mir vor, es im geheimen immer noch ist. Ganz wie ich selbst weiß, der ich begonnen habe, Ian Macdonalds international bejubeltes „Cyberabad“ zu lesen, daß sich meine Anderswelt-Bücher mit großem Selbstbewußtsein könnten danebenstellen, sogar um einiges drüber, aber ins öffentliche Bewußtsein gerät das nicht mehr; verschwiegen ist verschwiegen, ignoriert ignoriert, und Musiker an Bord zu sein, bedeutet, es zu bleiben. So stellen sich, wie Weichen, unsre Leben. Zeit ist irreversibel, jeder Rückwärtsgang sinnlos.  Hansebar, oberes Achterdeck, Blick hinaus. Hansebar, oberes Achterdeck, Blick hinaus.Aber das Vorne lockt auch und entschädigt nicht selten mit etwas, das wir nicht erwartet haben und nicht erwarten konnten. So sind wir dann doch überrascht und, gegen allen Schmerz der ergebenen Einsicht, beglückt. („Cyberabad“ ist übrigens wirklich spannend und genießt auch sonst, hab ich auf Seite 90 schon den Eindruck, ganz zu recht seinen Ruhm. Über Lars Popps furioses „Haus der Halluzinationen“, auf das ich >>>> dort schon hinwies, will ich gesondert schreiben. Und werde das auch tun. Jetzt aber dieses hier für Sie einstellen, dann ein wenig in die Sonne, mit dem Notizbuch und mit dem Roman, und nicht die Sonnecreme vergessen, und gegen halb eins zum Training. Können Sie sich – als diesen? – einen grandioseren Workout-Anblick vorstelln?:  ) Noch knapp zwei Tage, dann werden wir den Indischen Ozean einmal fast ganz durchmessen und in Mauritius angelegt haben. Meiner Reise erste Phase, die der, fühl ich, Zeit galt, wird dann vorüber sein, die des Niemalsneuen, des scheinbar Immergleichen, sich Wiederholenden, das eins, im Wortsinn, der Oberfläche ist, einer bewegten und bewellten. „... doch in der Tiefe wimmelndes Getier.“  albannikolaiherbst - Dienstag, 8. April 2014, 08:52- Rubrik: Arbeitsjournal
 So endete gestern der Tag, und auch der Abend und die erste Nacht blieben warm und unbedeckt, indessen während ich schlief, neue Wolken aufgezogen sein müssen, es ging gegen Mitternacht auch ein aufgeböter Wind, doch nun, innerhalb weniger Minuten, riß der Himmel schon wieder auf. Das Blau strahlt hindurch, und darüber, über dem Schwarz, werden wir einen gloriosen Sonnenaufgang erleben. Da bin ich mir sicher - - und tatsächlich:  („Es ist kurz nach sechs“, hatte ich zu Anfang dieser Erzählung geschrieben, „wobei sich das so nicht sagen läßt, eigentlich wäre es schon sieben, doch abermals waren unsere Uhren um eine Stunde zurückzustellen; quasi jeden oder jeden zweiten Tag eine Zeitverschiebung.“ Dann wurde ich mir unsicher: Sollten wir die Uhren nun heute zurückstellen oder lag das Zettelchen dem Veranstaltungsprogramm bei, das je abends auf die Kabinen verteilt wird?  Ich war mir also unsicher und dachte, na gut, dann siehst du mal nach.
Nicht nur mir scheint es so gegangen zu sein; denn zwar war in der Tat auch für die „Early Bird“s der Kaffee im Überseeclub noch nicht aufgestellte und noch kein Tisch auch nur „ange“eingedeckt, aber auf dem Achterdeck war völlig unüblicherweise bereits ein reger Passagierbetrieb:  Der offenbar erwartet worden war, denn draußen s t a n d Kaffee, und um die Schornsteine, die aus der Mitte des Achterdecks aufragen, eilten nicht joggend, aber walkend die Leute. Wiederum sah ich Bestzungsmitglieder, deren Unterlider unterhalb der Wangen hingen, was mit der Crew-Party zu tun hat, die gestern nacht stattfand, von 23, hier es, bis 2 Uhr. Es hatte mich gejuckt, dran teilzunehmen, aber dann war das wirklich nicht meine Musik, auch keine, mit der ich mich befrieden kann, einfach nur laut und rummsend. Also hatte ich mich zurückgezogen. Rückzug ist ohnedies eines meiner, hier, ständigen inneren Themen. Dazu gleich etwas später noch.
Aber erst einmal.
„Wissen Sie, für unsere Leute, Personal wie die technische und seemännische Besatzung, sind die Angebote sehr eingeschränkt. Auf den großen Kreuzfahrtschiffen haben sie eigene Räume, eine eigene Bar, eigene Videothek, eigene Sport- und sonstige Freizeitbereiche, ja oft sogar einen eigenen Friseur. Hier, auf solch einem kleinen Schiff gibt es davon quasi nichts. Das ist schon, auf Monate währenden Fahrten, nicht ohne Schwierigkeiten. Da sollen sie jetzt tüchtig alle feiern, finde ich.“ So der Chef der Service-Belegschaft. Und nach 23 Uhr - über dem Sonnenbereich der Hansebar, quasi direkt vor den Schornsteinen, waren lange Holzbänke aufgestellt und ein paar Tisches fürs BBQ, sowie die großen Boxen, aus denen es dann auf die Brustkästen hieb – war es nett anzusehen, wie die Leute, vor allem die Jungen, aus ihren Unterschlüpfen kamen, teils aufgedonnert, nämlich die Damen, teils bewußt lässig in Jeans und TShirt oder im Hawaiihemd; und sie duften alle nach bekannten Parfums. Allein die Führungsoffiziere, die aber teilnahmen, waren in ihren Uniformen geblieben. Was sonst stolz und dezent und bisweilen ein wenig steif die Passagiere bediente, wippte in den Knien.
Ich trank noch meinen letzten Abendwhisky aus, bestellte, ums auf die Kajüte mitzunehmen, noch ein Bier und ging. Zuvor freilich hatte ich dies noch bewundert: 
(Es geht nicht ohne Sinnlichkeit.)Wieder hörte ich der Geigerin und „ihrer“ Pianistin zu, diesmal der Pianistin mehr, die ein berückendes Kleid trug, unterhalb der Knie aus transparentem Chiffon bis zu den schmalen langgestreckten Waden. Ein Rätsel, aber auch ein Wunder, daß man auf solchen Absätzen gehen kann. Und sie kann‘s. Sogar, wenn das Schiff rollt. ***Aber zurück aufs Deck, zurück in diesen Morgen! Wir nähern uns Mauritius, der Isle Maurice, morgen früh um sieben wird der Lotse an Bord kommen; ich habe es über den Hotelchef hinbekommen, dann auf der Brücke sein zu dürfen, um dort die Töne mitzuschneiden. „Melden Sie sich bitte kurz vorher an der Rezeption, man wird Sie dann abholen.“ „Oh, ich kenne den Weg aber, kann ihn auch allein gegen. Es ist ja nicht das erste Mal...“ „Der Kapitän möchte das nicht.“
Er ist ohnehin sehr auf Distanz, Kapitän Zhukov, anders als der Kapitän meiner ersten Kreuzfahrt, der sehr offen war. Etwa wird es mich einigen Charme kosten, d o c h in den Maschinenraum zu dürfen; erst einmal wurde mir die Mitteilung: Nein, auf gar keinen Fall. Man habe einen Elektroniker an Bord, der könne ja mein Aufnahmegerät nehmen und für mich die Töne sammeln; nur: was soll ich mit denen, wenn ich die Bilder nicht beschreiben kann? Mein Eindruck ist allerdings, daß Charme nicht verfängt; der Mann, ich sah ihn bisher nur zwei Male, wirkt wie ein zur Person gewordener Katechismus, durchaus militärisch-strikt; quasi der Gegenentwurf zu einem Anarchisten wie mir. Aber wir werden sehen. Die erste wirkliche Begegnung wird ja erst morgen früh stattfinden. Und ich hab Stoff genug, nicht zuletzt den inneren des Imaginierens, um auch ohne Maschinenraum erzählen zu können.
Zum Beispiel davon, daß der Kreuzworträtsellöser jede Nacht im Freien verbringt; morgens gegen fünf, wenn der erste Service sich vorbereitet, findet man ihn unter der Überdachung für die Raucher; geht der Betrieb los, verzieht er sich ans Bootsdeck, und wenn auch das die ersten Leute fluten, gegen halb zehn oder zehn, erst dann, verzieht er sich für zweidrei Stunden in seine Kabine, um erfrischt wieder zum Mittagessen zu erscheinen, das er ebenfalls draußen einnimmt, bevor er sein erstes Bier bestellt und das erste Kreuzworträtsel löst. Er muß eine Bibliothek aus Kreizworträtselheften mitgenommen haben. Vielleicht ist das sein einziges Gepäck, denn er trägt – oder scheint zu tragen – immer die gleiche Kleidung.
Man kennt ihn schon an Bord; es ist nicht seine erste Tour.
Oder der bis zur Panik Flugängstler, der eben seiner Flugangst wegen lieber 42 Tage heimwärts zur See fährt, als nur 12 Stunden des Luftwegs auf sich zu nehmen; ein noch junger Mann, um die 35 mag er sein, kräftig, gut trainiert, humorvoll; die Abendzeit verbringt er meist mit Sugar, er dies-, dieser jenseits des Thresen, zwischen ihnen die Karten. „Er hatte die Befürchtung, auf die Astor nicht zu passen, nicht zu diesen Passagieren. Normalerweise versucht er, eine Passage auf einem Containerschiff zu bekommen. Aber nun sagt er, es seien doch viele verschiedene Typen hier, vor allem Typen, und er passe ganz gut.“ In der Tat habe ich gestern begonnen, immerhin, für den Roman eine Personenliste zu skizzieren, in die
- der Norweger gehört, der bis Skavanger weiterfahren wird, also noch über Bremerhaven hinaus; ein Seebär, der lange Zeit an den Maschinen gearbeitet habe, ein Mann mit sehr breitem Mund, wenn er lacht, und dabei flachem zwischen dem Wikingerbart; helle, witzige, schnelle Äuglein;
- Patrick selbstverständlich, der globesegelnde Ire, gut aussehend, markant, hager bis schmal, auf der Suche, ich werd noch erfinden, nach was;
- John, der Gambler; jeden Tag gewinnt er beim Bingo zwischen fünfzig und achtzig australischen Dollars; er hat ein einziges Problem auf der Reise: daß nie die Suppe wirklich heiß ist;
- der alte hagere Dichter, vollbärtig auch er, ein wenig in der Bechterew-Haltung, die Peter Kurzeck immer war, aber er kann nicht mehr ohne rollbare Gehhilfe gehen, bewegt sich sehr sehr langsam deshalb, kritischen Blicks, begleitet von einer schmalen hochgewachsenen Frau, die einmal, man sieht das noch immer, eine Schönheit gewesen, deren wie Schatten lange Untergänge sie allabendlich festlich kleidet, und sehr stilvoll, dabei sehr „plietsch“ geblieben, um ein altes Wort der Umgangssprache wiederzuverwenden; flirtende Blicke, ständig, wirft sie um sich und läßt doch keinen Zweifel daran, zu wem sie gehört;
- die abenteuerlustige Dickmadame, gepflegt, locker, offen, deutlich auf Abenteuer aus und vermeinend, sie habe Patrick am Haken; es steht aber zu fürchten, er hat mehr sie;
- Sugar selbstverständlich; (er übrigens mochte zur Crew-Party nicht mitgehen, „I don‘t like the music“, sagte er, um eine Viertelminute danach beizufügen: „I want to go home“, womit er Mumbai meinte, in dessen Nähe seine Familie und er leben – mit der wiederum, namentlich seiner Mutter, er ein Problem zu lösen habe; nämlich habe er in Australien eine Frau kennengelernt, „die müssen meine Leute akzeptieren; wenn man heiraten möchte, heiratet man eine Familie, immer, nicht nur eine Frau...“;
und dann noch
- eine geheimnisvolle Asiatin, die zum Servicepersonal gehört, von der ich aber meine, daß das nur Tarnung ist; links hat sie eine Lücke zwischen ihren ansonsten sehr schönen Zähnen, die ganz ebenso nach einer Geschichte verlangt. Ich treffe auf sie, diese Frau, jeden Abend im Captain‘s Club, wenn ich den Diamonds lausche.  [Nach dem Frühstück.
8.40 Uhr.]
Ich nutze nicht mehr die Speiseräume, wenn das Wetter ist, wie es ist, sondern esse im Freien; abends bin ich dabei in aller Regel allein, aber auch morgens sind nur wenige mit mir. Und die, wovon ich oben sprach, Typen treffen sich, sind immer häufiger beisammen; manchmal sitze auch ich dabei. Da ich aber nicht wirklich sicher im Englischen bin, und immer nur ein Drittel verstehe, vom australischen Englisch nich erheblich weniger, und oft verstehen auch die anderen mich nur sehr schlecht, ist das letztlich wenig gedeihlich, gibt mir aber zwischendurch Nähe. Davon reichen mir fünf bis zehn Minuten täglich vollkommen; allein von den Damen hätte ich bisweilen etwas mehr, nicht von den Passagierinnen, nein, nun wirklich nicht, aber an diese Pianistin zu denken, und an die Asiatin... - Kommt nicht infrage. Wäre auch ein arbeitsvertragliches Problem für sie. Und wirkliche, eine ebenso sinnliche wie Nähe des Geistes ist nur über dieselbe Sprache zu erlangen, ihre tiefe Ausgehorchtheit, die Eleganz des Ausdrucks und der Idiome; alles jenseits davon bleibt oberflächlich Fick. Das gilt nicht nur unter einander fremden Sprachen, es gilt auch im eigenen Mutterland, nur daß wir‘s daheim nicht sogleich merken. Aber sind erst einige Wochen vergangen, um von Monaten zu schweigen... -
(Dennoch erwachte ich vor, glaub ich, zwei Tagen, mit einer Erektion, auf die die Sonne schien, ein geradezu klassisches und ausgesprochen schönes Bild. Doch ebenso vergebens. Der sinnlich drängende Ausdruck des Körpers wird zu einem Phänomen der Ästhetik.) *Um aber zu uns Typen zurückzukehren, die einander treffen – heute früh hatten sich sich erweitert, typischerweise sind wir, also die Typen, alle Raucher, und unter der Ägide - ich bin versucht, „dem Dirigat“ zu schreiben - des Kreuzwortätslers fingen sie plötzlich zu, ja, sie lesen richtig, singen an, mehrfach angesetzt im Chor, in ihrer Raucherecke, d a:  An Bord sein.
Wir sehen, was wir sind.
Und wenig anders hören wir auch. *****(17.44 Uhr.) *****(17.44 Uhr.)
Heute, den gesamten Tag über, schaukeln wir, sowohl in gerade Linie voran sticht das Schiff in die Wellen hinab und hebt das breite Hinterteil, senkt es dann wieder, in gleichmäßigem Rhythmus, wenn der Bug sich gegen den Himmel richtet, als auch besonders nach starboards hin, bisweilen gleiten wir schräg. Dazu hatte der Morgen mit einem geteilten Regenbogen begonnen, den nur sah, wer vorn am Bug gestanden: Dann hob sich im Norden der Fuß des Bogens aus dem Meer, verschwand in den Wolken völlig, tauchte aber im Süden aus ihnen wieder auf; jeder Fuß, mitsamt dem Unterschenkel, vielleicht zehn, vielleicht fünfzehn Meter hinauf, bzw. hinab. Und nun am Nachmittag, ebenfalls Steuerbords, wandernde Regenbögen, direkt über die Meeresoberfläche gleitende, wenn der Wind die Gischt noch weiter zerstäubt und zu uns weht und sich die Sonnenstrahlen darin brechen; die Erscheinungen währen immer nur kurz, die Dauer eines dreimal springenden Steines vielleicht, der flach über Teiche geworfen und dann versinkt. Ich hab versucht, es einzufangen; wenn Sie genau hinsehen, können Sie es erkennen:  Die Wellen selbst wiederum laufen heute weit und gehen hoch, deshalb unser Schaukeln. Und zwischen den Bergen bilden sich nicht Täler, sondern Kessel, tief, fast mathematisch rund, ein wenig wie vulkanische Calderae. Tief auch das Blau einer gespannten Seide, die von Krönchen aus Scheinschnee geschmückt ist. Also diesen Abend noch und diese Nacht, und wir werden den Ozean überquert haben und andere und ich erstmals wieder Land betreten. Ich kenne das von anderen Seefahrten, daß man in der ersten Stunde gar nicht glaubt, sicher dort stehen zu können, weil der Körper gelernt hat, die Dünung auszugleichen, wenn er geht; dann ist aber nichts auszugleichen, und er tut‘s trotzdem – weshalb sich das Gefühl einstellt, daß sich der Boden bewege.  Doch wovon ich schreiben wollte. Geschrieben hatte mir Chromò, mich werde diese Reise verändern; sie sei sich da sicher. Und in der Tat denke ich ständig nach, darin Lanmeister wohl wirklich nahe: nicht zielgerichtet, geschweige zweckorientiert, sondern schweifend, fast meditierend manchmal und vor allem direkt aus den Beobachtungen heraus, die mir werden, ich möchte sagen: aus gewollten, vielleicht, nein sicher sogar: menschlichen Akzeptanzen, und alles dieses hat mit der Fremdheit zu tun, über die ich nun schon seit Monaten nachdenke, indem ich sie zugelassen habe: es zu s e i n, nämlich im Sinn einer personal-ontologischen Kategorie.
Den Anlaß gab wieder einmal die Musik, Unterhaltungsmusik, Pop, Schlager, auch einfacher, in seinen Harmonien unmittelbar populärer Jazz; und ich sah die Menschen dabei beglückt, teils wippten sie mit, teils tanzten sie, teils sangen sie mit, manche leise, andere summten nur, aber sie waren daheim. Und dann dachte ich: Wenn dem so ist, und es ist dem so, und es läßt sich dagegen doch gar nichts sagen, weshalb den Menschen etwas nehmen, das ihnen Glück bedeutet? - wenn dem so ist, wie kann ich denn erwarten, daß meine Romane ebenso geliebt werden, die doch für etwas ganz anderes stehen und für etwas anderes kämpfen? Das geht doch gar nicht, daß ein Kritiker, der, sagen wir, gerne Michael Jackson hört, mit einer Erzählung von ANH etwas anfangen kann. Weshalb wundere ich mich? ja, verlange geradezu, daß er‘s tut? Es betrifft ja auch nicht nur die Musik, sondern vieles anderes. Ich teile die Begeisterung für die USA nicht, ich teile die Moralisierung nicht, ich teile das Bedürfnis nach Freizeit nicht... was teile ich also denn? was an mir ist denn gemeinschaftsfähig? Wie soll da meine Literatur es sein? Völlig undenkbar.
So einfach ist das.
Und dann ist es deutlich, worum es geht, nämlich das Grundgefühl zu erlangen, einverstanden zu sein: eine Art Weisheit, vielleicht, die den Schmerz, den Verlust, die Getrenntheit, aber auch das immer unerreichte Wollen in eine in sich selbst ruhende Zuversicht auflöst, ohne Schmerz, Verlust usw. aber zu leugnen, so wenig wie die Erfüllung, die uns zuteil wurden und nach wie vor werden, nicht ständig, aber zuweilen – und dann mit großer Macht. Es mag aber sein, daß solch ein Zustand sich tatsächlich nur in der Fremde erreichen läßt oder besonders im transitorischen Zustand, der mir zunehmend der eigentliche des Schriftstellers zu sein scheint und nicht die Zugehörigkeit; das Wandern vielmehr, im weiten Sinn des Wortes, das Fremde, für das ich bestimmt bin, ohne daß es jemanden anderes gäbe außer mir selbst, der ein Bestimmender wäre. Kann es sein, daß der Name - nicht etwa sein Begriff - „Selbstbestimmheit“ genau dieses meint?
Aber unterm Strich: Wie habe ich erwarten können, daß Menschen, die den Pop lieben (und der, offenbar, liebt auch sie; so ist das völlig in Ordnung), in meine Bücher finden? Diese Erwartung kommt mir hier auf See, entfernt von allem Direkten, nun geradezu komisch vor, bizarr. Denn wenn i c h von Musik spreche, meine ich etwas phänotypisch anderes, als wenn andere das tun. So ist doch imgrunde alles in Harmonie, ich selbst bin‘s mit mir, andere sind es mit sich, und was man auch sagen wird in Zukunft: die Bücher sind ja geschrieben, und wer das immer mag, kann sie sich nehmen und zu den seinen/ihren machen.  albannikolaiherbst - Mittwoch, 9. April 2014, 07:13- Rubrik: Arbeitsjournal
albannikolaiherbst - Donnerstag, 10. April 2014, 06:28- Rubrik: Arbeitsjournal
<div align=justify.
Wie bin ich traurig gewesen, als wir Port Louis gestern abend wieder verließen! Kaum war ich ins Dickicht der maritischen Stadt eingedrungen, spürte ich es mir in die Adern und aus den Venen strömen: daß ich hier gerne bleiben möchte, zumindest, und ich wußte es wirklich bereits nach zehn Minuten, wiederkehren würde. Und ich schreibe Ihnen das noch heute, fast einen Tag danach, zumal zu Schostkovitschs Cellokonzert, dessen Solopart Sol Gabetta spielt. Seltsames Wort, „spielen“, wenn man von der Durchdringung eines Instrumentes spricht -
Wie also traurig bin ich gewesen, als wir uns von der Insel entfernten, und stand lange noch am Achterdeck und schaute: 
 Und dachte, ich würde den Abend anders verbringen, als es mir hier Gewohnheit wurde, und statt dessen gleich schreiben, Ihnen niederschreiben, was so in mich ging. Aber auf dem Weg hinab kam mir dieses dazwischen und hielt mich fest:  Und es stärkte meiner Melancholie noch den Rücken, zumal die allerdings nur wenigen Leute, die noch im Captain‘s Club zugegen waren, einfach nicht zuhören konnten, auch nicht, als ich, der Pianistin im Rücken stehend, ihr leise zusprach: „Please, be so kind to playing a piece of Bach.“ Erstaunt wandte sie sich um, ein bißchen scheu, „Johann Sebastian“ fragend mit ihrem ukrainischen Dialekt. Man kann auch nicht wirklich, stellte sich später heraus, miteinander sprechen, ihr Englisch ist n o c h dürftiger als meines. Wir können direkte Willen mitteilen, Hunger ausdrücken und Durst und uns Gute Morgen wünschen, aber die Tiefen bleiben immer ganz bedeckt. Doch ihre Antwort war Musik. So ging es denn noch bis fast 23 Uhr, da mocht‘ ich nicht mehr schreiben. So weit weg Mauritius bereits.
Wenn man einem Inselbewohner glaubt, dann könnte man
die Meinung bekommen, dass Mauritius zuerst geschaffen
wurde, und dann der Himmel; und dieser Himmel ist
eine genaue Kopie von Mauritius.
Mark Twain. 
Allein das Völkergemisch, das hier auf engem Raum beisammenlebt, Kreolen, Inder, Chinesen, nicht sehr viele Weiße, Hindus, Christen, Moslems, alles treibt Handel, permanent, und schläft wohl auch miteinander. Und die Genetik scheint sich ästhetisch zu entscheiden. Aber allein der überdachte Markt hält alle Herrlichkeiten bereit, die uns nur Früchte geben können, von den Gewürzen ganz zu schweigen. Der kleine Kühlschrank meiner Kabine ist nun voll mit Chilis, aus Chilis und Limonen gestampftem Senf, und mit frischem Safran, sowie liegt Curcuma in einer meiner Schubladen mit indischem Knabberwerk zusammen, salzigen Biscuits und dem besten Basmai, den es zu kaufen gibt. Außerdem habe ich für den dem Meer geopferten Schal einen anderen bekommen, der so weich ist, daß meine bloßen Schenkel, denen er jetzt aufliegt, vor gestreichelter Verzückung zucken, weil das, zu zucken in der Wohligkeit, ihre Art der Seufzer ist. Und alle Wohlgerüche salbten mich, die der Orient kennt; ich schwamm in ihnen, tauchte, trank süßen schweren Tee um 20 Cents das Glas, der an Chai erinnert, aber Chai nicht ist, sondern in der Konsistenz von mit warmem Honig angerührtem Lassi. Es ist ein großes Glück, das ich nicht empfindlich bin, also in der Verdauung; selbst in Indien konnte ich mich aus den Straßenküchen bedienen... - wenngleich, gestern, einmal kurz, hupfte mein Magen d och, aber nur für eine Viertelminute. Upps, hatte ich gedacht, warst du vielleicht doch etwas zu unvorsichtig? Ich hatte am Straßenrand einen Saft gekauft, umgerechnet für 19 Cents, 8 Rupien sind das, von einem Straßen-Wallah. Der hob den Deckel seines Kühlkastens an und zog ein prall gefülltes Plastiktütchen hervor, dessen verschlossene Öffnung rosettenhaft einen Strohhalm umküßte, an dem ich nun zog. Zwei Minuten später meldete sich ein drängender Hinausdruck... Nein, nicht nervös machen lassen, das kommt alles, dachte ich, vom Kopf. Also ging ich Buryani essen, etwas Reis, zwei kleingeschnetzelte Fleischsorten, Gemüse, Pickles und die dicken rosa Zucchini, die diese Breiten kennen. Überdachte Garküche, gleich an den großen Markt angeschlossen, quasi nur Einheimische dort; nur bisweilen schaut mißtrauisch ein Tourist herein, der garantiert, wie ich, von der Astor kam, aber sich, klugerweise, vorsah. Ich nahm da Mahl draußen zu mir, weil es drinnen keine Sitzplätze gibt. Ich möge bitte den Teller wieder zurückbringen, was ich selbstverständlich tat. Bevor ich mit der schönen Sennerin, einer indische Variante von Sophia Loren, beim Lassi flirtete:  Ich hatte gar keines gewollt, aber sie derart gelächelt... fordernd, übrigens; etwas , das mir in Port Louis auf Schritt und Tritt begegnete: die Blicke der Frauen, auch sehr junger Mädchen, weichen nie aus, auch nicht die der Muslima, deren man bisweilen als gänzlich verschleierte begegnet, aber ihre Augen, schwarze, aus den schwarzen Kaftanen, blitzen. Es gibt das: schwarzes, allschwarzes Flammen. Unfaßbar schöne Menschen, wohin ich auch blickte. Aber auch viele behinderte Alte, und Menschen, denen es nicht gut geht, erkennt man zuerst an den Zähnen.
Vorher, als ich morgens ankam, ich nahm den allerersten möglichen Bus, hatte ich sofort ein Roti gefuttert, vegetarischer scharfer Gemüsebrei mit Stücken von Kartoffeln im gerollten Fladenbrot. Und auch das süße Lassi hätte es in sich haben können; der bei uns gerade unter Kindern so beliebte „Bubbletea“ ist hierzulande unter die flüssigen Joghurts gelangt, der zusätzlich mit Kofi, einem indischen Vanilleeis, versetzt wird. Indessen im Fleischmarkt, nachmittags, ein Schlachter mit seinen wehen Füßen lag und die Söhne tun ließ, was auch ihr Beruf nun war; er aber schlief, schaute allerdings, ein melancholischer Singh – was auf deutsch „Löwe“ bedeutet -, manchmal nach dem rechten hoch, graunzte ein paar Anweisungen und ließ seinen Kopf zurück in den Traum, auf seiner Schlachtbank, wohlgemerkt:  Und die Avokados sind hierzuland riesig, man muß sie nur anschaun, um auf der Zunge zu spüren, daß sie wie weichstes Mus auf ihr zergehen würden:  Jedenfalls schlug ich mich gastronomisch mit dem Volk durch, und genoß es. Dabei insgesamt fast sieben Stunden auf den Beinen, nicht einmal gesessen, sondern den gesamten Ort abgeschritten bis dort hinauf, wo er in den Berghang übergeht, der schnell steil wird, in der Ferne atemberaubend bizarre Felskulissen:  Ich muß nicht erzählen, daß nichts hier Norm ist, die Straßen voller Schlaglöcher, die Hauswände Bedienstete der Zyklone, und dort, schauen Sie!, geht man zum Zahnarzt: *****(Ah, und wie das Schiff wieder schaukelt! Wir fahren nun das letzte Stück des Ozeans durch, unter Madagaskar entlang Richtung Durban. Die Sonne gleißt auf das Meer. Drei Tage Seefahrt liegen vor uns.
11. April, 14.28 Uhr.
Die Gläser rollen im Schrank.
Der Kurs genau auf Süd, zwischen 174 und 187 schaukelnd.
Wir haben wilden Wind.
Ich muß mal eben an Deck.***Hoch und gleich wieder runter: den LS 11 holen, um am Bug das wirklich irre Heulen des Windes aufzunehmen. Da dürfen wir noch hin, obwohl das Bootsdeck bereits gesperrt worden ist:

Zehn Minuten lang da oben gestanden, erst nur die Atmos aufgenommen, dann versucht, ein Bild der Gischt hinzubekommen, wie sie immer wieder vorn übers Schiff geht: sprühend, man möchte meinen zischend, sich rasend verfliegend; es ist wirklich allerbestes Windsurf-Wetter.
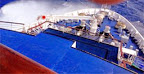
Und am Achterdeck einen Cigarillo rauchen, dazu verfrüht den Campari Soda, frei stehend aber. Meine geliebte Großmutter sprach gerne von „Matrosenbeinen“, die jemand habe: bekommen habe während der lebenszeitlichen Versuche der Gleichgewichtwahrung. Daran über ich einige Zeit, was schließlich fast anstrengungslos geht. Obwohl meine Waden motzen, wegen der nach wie vor wehen Achillessehne; es war nicht sehr klug von mir gestern, für die ganzen sieben Stunden in meinen indischen ledernen Sandalen loszuziehen. Man gewöhnt sich, um die Sehnen zu schonen, eine bestimmte Gangart an, die nun wieder dazu führt, daß sich abends die Waden verkrampfen. Jetzt aber, im „Matrosenstehen“, hab ich den Eindruck, daß sie sich genau davon lockern.
Und noch mal in den Übersseeclub geschaut. Abgesehen von den zahllosen Kuchen und Torten sieht das Verlockendste so aus (hier an Bord wird immer, zu jeder Mahlzeit, so getafelt): *****Aber zurück nach Port Louis:
16.20 Uhr.
Nachmittags Massen von Fliegen auf einem massiven Thunfischstück auf der Fischbank, das rosarote Fleisch fast völlig in wimmelndem Schwarz. Und plötzlich, es ist wie ein süßer Erinnerungsschock, entsinne ich mich, daß ich als Junge von ungefähr fünfzehn Briefmarken zu sammeln begann, was ich allerdings nicht lange durchhielt, und daß damals die „Blaue Maritius“ eine besondere Rolle gespielt; mein Bruder, erinnere ich mich ebenfalls erst jetzt, nach all den Jahren, wieder, hat Münzen gesammelt. Und die Straßenhändler, ganz ebenso plötzlich aufgescheucht, schlagen die Decken um ihre am Boden darauf verteilten Waren zusammen, TShirts, Schuhe, Gürtel, und ziehen die so entstandenen fetten Halbsäcke an die Hauswände und setzen sich drauf, sozusagen tirilierend. Kein zwei Minuten später ertönt von irgend woher Entwarnung, und lässig wird alles wieder ausgebreitet.
Lachend die Blicke und her.
Und neuerlich kommt der alte weißbärtige, weißhaarige hagere Mann heran, ein Verrückter vielleicht, so schimpft er und gleichzeitig singt er und fuchtelt Zeichen vor sich in die Luft, indes ich, als ich, um mich endlich auf den Weg zurück aufzumachen, die Unterführung hinab will, ohne die man da tatsächlich auf Kilometer Länge nicht über die Straße käme, von einem geradezu märchenhaft fetten Schwarzen, der dort auf den Stufen weniger sitzt, als daß er sich in sie hineingegossen hat, ohne jede Lücke, wie ein seit Jahren Vertrauter begrüßt werde. Selbstverständlich grüße ich zurück. Das gegenseitige Lachen auch hier.
Und ich bin in der Moschee gewesen, sogar in beiden, und habe in der ersten, der großen Jummah Mosque, vor dem Bassin, in dem riesige Karpfen und welsartige Fische durcheinanderschwammen, meine Füße gewaschen und mein Gesicht, wie es Islami tun; gegenüber, aber noch in der Moschee, eine offene Koranschule für Acht- bis Zehnjährige, denen der Lehrer, der einen Stock in Händen hält, vorsingt, worauf sie jeweils nachsingen müssen: einen immergleichen, ich sage einmal, Psalm, bis sie ihn noch im Nachtschlaf hören. Einer der Jungen machte dabei einen Fehler und mußte vortreten. Er stand ganz gerade und verzog, nachdem der Stock sausend auf seinen Knabenpopo gepfiffen, nur eine Bruchsekunde lang das Gesicht, gab aber keinen Wehlaut von sich, sondern hing still an seinen Platz zurück, und die Prozedur des Vor- und Nachsingens wurde wieder aufgenommen, wie wenn nichts vorgefallen wäre. Dieser offenen Schule gegenüber, selbstverständlich sitzt man am Boden, ebenfalls am Boden die Korangelehrten, drei oder vier vor den vor ihnen aufgebahrten Büchern. Ein alter Mann, dem ich auffiel, bat mich erst, dann forderte er mich auf, doch bitte ebenfalls zu beten. Ich hätte aber nicht gewußt, zu wem.  Dennoch kam ich mir gereinigt vor und trat in die Sinnlichkeit der wilden Royal Street zurück, um mich auf meinen Rückweg zu machen. Saß dann noch an der – völlig anders als die übrige Stadt – touristisch hergerichteten Hafenfront und trank die Milch aus einer dort, na klar, zu teuren, aber vor meinen Augen geköpften Kokosnuß. *******Mauritius ist mit Port Louis bei weitem nicht erschöpft. Aber ich nutzte die Zeit, die ich hatte, um zu sehen, was irgend ging. Dazu gehört das Amalgam der Architektur aus vierfünf Jahrhunderten, dazu gehört das älteste Theater der südlichen Hemisphäre, dazu gehören die Gänge hinan zu den Bergen und daß mir eine Sehnsucht blieb, die mich ganz sicher wieder einmal hierher ziehen wird, und vielleicht für länger dann. Es ist mein Klima, ist mein Temperament, ist das Chaos, das ich von jeher suche. Da hab ich von den Tauchgründen noch nicht einmal ein Wort verloren. Und davon nicht, daß auf der Insel „nebenan“ einer der aktivsten Vulkane der Welt lebt. Aber von jener, der anderen Insel, erzähl ich Ihnen morgen. Ich brauche etwas Abstand dazu, denn ungerecht will ich nicht werden. Außerdem lockt es mich wieder hinaus.  albannikolaiherbst - Freitag, 11. April 2014, 15:04- Rubrik: Arbeitsjournal
 Auf die Pointe des Galets zu, noch in die Nacht, indessen es achtern schon tagt:  (Auch dieseErzählung wird erst folgen. Nachdem wir Mauritius, das berauschend schöne, gestern erst um 20.30 Uhr verließen und heute bereits um sieben auf La Réunion sein werden, werde ich erst ab dem heutigen Nachmittag/Abend zum Schreiben kommen und bitte Sie, dies nachzusehen. Es ist bereits jetzt vieles zu erzählen, vom Glück der Blicke, vom Glück der Kulturen, zu denen unbedingt das Essen gehört, daß ich einfach ein bißchen Zeit brauche. Ab heute nachmittag werden drei weitere „reine“ Seetage vor uns liegen. Die werd ich dafür nutzen, jetzt mich aber, wie gestern, den Geschehen, Bildern und Tönen überlassen: Die Welt ist Klang hieß der Wahlspruch des Ensembles Modern und heißt er sicher immer noch.
Ihr ANH.)
albannikolaiherbst - Freitag, 11. April 2014, 04:27- Rubrik: Arbeitsjournal
242ºS/SW.
(Wogen-Rhaposodie)
Es sprüht Salz von den Wogen, das ist überall: körnig auf den Relings, auf der Haut, beißt sich in die Sonnengläser – es s c h n e i t das Salz hinauf! verweht es wie sehr langes Haar, das keine Konsistenz mehr hat. So rollen wir durch das Meer, teilen die wütigen Wellen, schneiden sie durch, die uns heben, klatschen hart wieder herunter, zu den Seiten nächstes, endlos vieles Salzhaar und Seehaar und Kessel und Höhen, und ein Wind, der jedes lose Teil in seine Arme nimmt und an der Brust zerdrückt. In den Himmel geht es hinauf, in die Täler wieder hinunter:  Wir kommen auf wie in Kissen, dann wieder schlagen wir auf Beton. Das Innere der Seele ist unser Körper, so spüren wir‘s nun, kraft der Schöpfung gegen den Wind und sein Heulen und das Sprühen angeschrieben.  Nachts schwangen die Sterne: Amplituden von bis zu vier oder fünf Metern. Ich schrieb: Das Universum schaukelt. Wer den Kopf hob, konnte es sehen. Die meisten hatten sich unter Deck geflüchtet. Johan, lachend, auf mich zu: „Du hast es gewollt, nun hast du es.“ Wer immer ging, schlingerte. Die Hartgesottenen saßen in der Raucherecke und vor der Hansebar im überplanten Bereich, streckten die Beine von sich. Ich dachte: „Anschubsen, Papa! Noch mehr anschubsen! N o c h mehr!“ Höher, höher. Und wieder tief.
Abermals hinauf.
Ansage ( mitgeschnitten) über Bordlautsprecher: Bitte lose zerbrechliche Gegenstände aus den Regalen nehmen, bitte jede Tür sorgsam schließen. Die seitlichen Außendecks seien aus Sicherheitsgründen gesperrt. Auf keinen Fall mehr den Swimmingpool benutzen; aber man ließ dort ohnedies das Wasser wieder aus. Hie und da gingen, stoisch mit Eimer und Feudel, Stewards, mancherorts knieten zwei am Boden, um zu wischen, auch zu rubbeln, bei den Treppen, Teppichboden. Eine Dame suchte ihren Gemahl. „Wo ist er nur? Er fühlte sich krank.“ Ich hatte ziemlich einen im Tee, als ich schlafen ging nach der kleinen Nachtserenade. ***
 Heute früh ist die See wieder still, wir schaukeln leicht dahin nach unsrem Indischen Ozeantraum, in den die Nereïden bliesen, weibliche herrliche Sturmdschinns. (Prima Idee für das Hörstück: Das mitgeschnittene Heulen des Windes und ein zwei Stücke aus der Nachtserenade zu einem eigenen Klangraum montieren und unter die Fahrt legen.)
(Sonnabend,
9.36 Uhr).***
*******La Réunion, 11. April,
Freitag.)
Es war vielleicht einfach der „falsche“ Hafen, denn meinen Unterlagen nach und nach meinen Vorbereitungen hat die Insel mehr, viel mehr zu geben als die paar Dürftigkeiten, die ich sah. Wobei, mir gefällt nur allzu oft, was andre Menschen furchtbar finden, und was denen gefällt, ist wiederum fruchtbar für mich. Dazu gehört etwa eine gewissen „Aufgeräumtheit“ der Straßen, ihre Beruhigung, Begradigung, Normierung.
Ich war den anderen, die auf den Shuttle-Bus warten wollten, zu Fuß vorausgegangen, fast zwei Stunden früher, die ganze lange Straße entlang, über die die Trucks donnerten, einer nach dem andern. Einige Kreisverkehre waren zu durchmessen, unübersichtlich für mich, wohin ich gehen müsse: Die Stadt sah ich als weit verstreute flache Würfel liegen durch die Ebene bis in die Hänge hinein, ohne daß sich ein Zentrum ausmachen ließ. Immerhin kam ich wieder zur Küste, die entlang bis zu eienm abermaligen Industriegebiet ein ausgebauter Trimmdich- und Joggingpfad führt; dahinter schwere Steine, schließlich grober Kies bis an die Wellen. Dort standen ein paar Angler und prüften ihre Geduld. Fahrradfahrer tauchten auf, im Dress, Mountainbiker. Und sowieso: das erste Mal wieder, seit ich Europa verließ, Rechtsverkehr. Ich brachte, geb ich zu, ein bißchen Heimatgefühl mit an die Pointe des Galets: La Réunion ist der von Europa entfernteste Ort der Welt, an dem mit Euros bezahlt wird; als französisches Departement, eigentlich muß man sagen: als eine letzte Kolonie, gehört die Insel zur EU. Das machte mich ein bißchen Hüpfen: in der eigenen Währung zu bezahlen, und zwar gerade dann, wenn alle anderen Reisenden das nicht tun können, sondern mit, für sie, Fremdwährung hantieren, läßt einen fast schon zuhause sein.
Die Ernüchterung folgte auf dem Fuß, denn logischerweise traf ich an, was ich doch immer fliehe: eben die Normierung, das Gleichmaß und auf ein Mittel Heruntertemperierte; nichts hier, gar nichts, war ekstatisch.
Nachdem ich das „Zentrum“ des Ortes erreicht hatte, etwa fünfzig Minuten strammen Wegs waren das gewesen, das sich aber vom übrigen Ort kaum unterschied, nahm ich immerhin einmal Platz. Denn dieses nun war angenehm: das vor den Cafés Stühle stehen. Also einen Cafè bestellt und ein Baguette, das auch dann nicht wie eines schmeckte, wenn „La Porte“ den Spitznamen „Petit Paris“ erhalten hat.  Sondern es schmeckte nach einem Baguette von McDonald‘s. Insofern allenfalls ein Petit Paris/Texas, öde Einstöckigkeit, puritanisch gecleant, selbst die Mini-Moschee sah in ihrer Ecke wie ein Fallerhäuschen aus. Obendrein war Feiertag, geöffnet hatten ein paar Textilbillighändler. Markt gab es es nicht, und zwei Stunden später liefen quasi alle Passagiere meines Schiffs auf der einen einzigen Straße herum, die man mit sehr gutem Willen „belebt“ nennen könnte.
In der Ferne lockten die Berge.
Ich hatte einen Fehler gemacht. Hier, auf La Réunion, hätte ich mich einer der Landschaftsexkursionen anschließen sollen, auch wenn wir nur im Bus gesessen hätten. Es wäre zumindest etwas zu sehen gewesen. Für Weiteres gab es ohnedies nicht die Zeit; wir hatten gerade vierfünf Stunden, ansonsten ich umgehend einen der Tauchgründe aufgesucht hätte, für die die Insel berühmt ist. Und für die Haie. Im Alten Hafen etwa, völlig vernachlässigt, selbst die Sportyachten liegen dort am Kai, als würden sie vor Langeweile zerschmilzen, sah ich dieses Schild:  So viel, immerhin, Abenteuer ist hier d o c h, daß die Haie bis in den Yachthafen schwimmen – wahrscheinlich, weil zu häufig von den Booten Essensabfälle ins Wasser geworfen worden sind; auch andere Tiere, nicht nur wir Menschen, tendieren zur Bequemlichkeit. Na gut, zugegeben, ich tu es nicht so sehr, aber da sind wir wieder beim Thema von oben. „T h i s is nice here!“ hörte ich sagen, mehrfach... „and so clean!!“ And comfortable, dachte ich, und rauschlos. Halt auf ein Mittel temperiert. Dahin ging auch ein kleines Gspräch, das ich nach der Serenade nachts mit einem der Barkeepers hatte. Ich hatte gesagt, die Leute hörten einfach nicht zu, hatte die Musik gemeint, und er erwidert, Menschen könnten das nicht, sich dauernd konzentrieren, einzweimal im Monat, dann sein es genug. Er wisse das, seine Frau sei ebenfalls Geigerin an Bord eines Kreuzfahrers; er zog sein Smartphone vor, zeigte mir ein Filmchen. „Auf der Marco Polo“, erklärte er. Man müsse die Menschen unterhalten, dürfe sie nicht fordern.
Es ist mir von Herzen unverständlich, wie jemand nicht immer im Herzen der Dinge sein möchte, wie man neben den Dingen her- und nicht in ihrem Sog leben möchte, wieso man lau sein will, anstatt in Flammen zu leuchten - . Wie? Sie sagen Müdigkeit? Ja-Göttin denn!!: von w a s? Davon, gut zu Mittag gegessen zu haben? und muß sich erholen? Und wenn von einer Arbeit, die man nicht will, weshalb sie dann nicht wechseln und tun, wonach einen verlangt, was uns erfüllt? Geld zu verdienen, allein, ist kein Lebenssinn, sondern es ist - - - sein völliger Verlust. Nur deren Gemüse wird schmecken, die den Acker auch lieben, den sie bestellen, und die Pflanze und das Tier. Wenn es wehtut, daß wir töten, und nicht gemütlos ist, Routine.
Selbst die kleine Moschee war in ihrer zugewiesenen Ecke gemütlos, selbst der kleine indische Laden, alles geordnet ins Kleinstadtbild. Ich seh da sofort David Lynchs abgeschnittenes Ohr auf dem nach Katalog glattgetrimmten Rasen; das Objektiv der Kamera, das auch unser Auge ist, muß nur nah genug heranfahrn, anstelle sich mit dem Schein der Oberfläche zu begnügen. Und noch mal der Alte Hafen, La Porte Ouest: Abgeschnitten von der Kleinstadt durch zwei schwer befahrene Lastwagentrassen, verrottet hinter Zäunen. Jetzt aber wollen sie ihn wieder herrichten, mit europäischen Mitteln, und dort eine repräsentative Hafenfront bauen, man kann sich schon vorstellen, wie das mal aussehen wird mit all den Einkaufs-Malls und „Club“ genannten Diskotheken:
Und doch tu ich La Rénunion-ingesamt ganz sicher unrecht. Es gibt hier atemberaubende, las ich, Bergstürze, Wasserfälle, Wälder, auch Orte mit wirklichen Märkten, sowie die Tauchgründe, von denen ich bereits erzählte, und es gibt den Vulkan: Er zählt zu den aktivsten, gefährlichsten der Welt. Daß ich da hin will, steht außer Frage, aber es ließ sich auf dieser Reise nicht machen. So war ich denn von Herzen froh, als ich auf der schönen Astor zurück war und daß uns dann wirklich das W e t t e r empfing. Das Wetter und sein Salz: 
*******
albannikolaiherbst - Samstag, 12. April 2014, 08:56- Rubrik: Arbeitsjournal
(Sonntag, 7.34 Uhr.
26º00‘ S/44º54‘ O.
Kurs 332º NW.)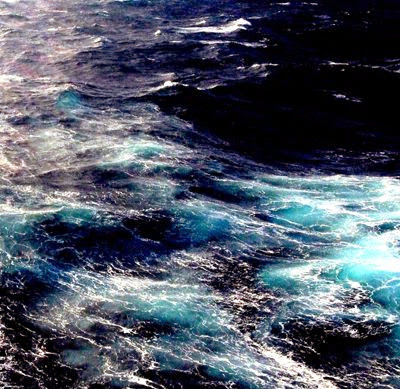 So hat das Meer uns wieder. Wir fuhren „unter“ Madagaskar durch, aber sahen nichts von dem Land; auch Seebewohner haben sich keine gezeigt. Nur das ewige Spiel der Wellen im Rhythmus des Windes und den bisweiligen Umbrüchen von harter Sonne in Regen: abends stand ich vorn am Bug, im weißen Smoking, eine „Paris-Gala“ war in der Astor Lounge angesagt, aber ich war noch etwas früh und sinnierte. Mit einem Mal fielen Tropfen in der Größe von Wachteleiern vom Himmel, mehr mehr und mehr, und ich kam grad noch nur halbnaß davon, schon schüttete es aus Eimern und Feuerwehrschläuchen. Die See selbst blieb dabei ruhig, verhältnismäßig.
Die Tage ver-, im Wortsinn, streichen wieder; ohne täglichen Sport, in der Tat, geht es nicht. Zwei Tage, der Maskarenen wegen, ausgesetzt, schon ein Kilo mehr auf den Seiten; aber es genügt eine Trainingseinheit mit übern Daumen 1000 kCal Verbrauch und daß man zwei Mahlzeiten ausfällen läßt, schon ist das wieder ausgeglichen. Wehe aber, man läßt sich selbst verstreichen.
Andererseits, ich komme dem Roman wieder näher, denke ständig vor mich hin, und auch mein Personal wächst. Allmorgendlich, wenn ich für den ersten Kaffee aufs Achterdeck schlendre und am Captain‘s Club vorbeikomm, spielt dort ein alter Herr am Klavier vor sich hin: tastend mehr, als daß er wirklich spielte, eine morgendliche probende Fingermeditation:  Morgen will ich etwas früher hinaus, um davon etwas für das Hörstück mitzuschneiden, wobei – an die dreizehn Stunden O-Töne habe ich bereits; ich werde später sehr genau auswählen müssen und sollte wirklich damit anfangen, sie zu protokollieren, also die fili di suoni durchzuhören und nach Sekunden „abzuschreiben“, ansonsten die Arbeit in Berlin unübersehbar würde.
Anderthalb, fast zwei Stunden in der prallen Sonne gelegen, über Mittag, dann nachmittags noch mal, nach dem Training, in ihrem Fluten gesessen und gelesen; dazu Aufzeichnungen: bei der Serenade etwa – ich hatte grad die Neigung, „ Seerenade“ zu schreiben, aber es wäre ein nur leeres Wortspiel; trotzdem merken, man kann es ja füllen – also beim Konzert im Captain‘s Club, wie da die alte Dame unvermittelt, ohne hinzusehen, nach der rechten Hand ihres Gatten greift und er nun um die ihre die seine herumlegt, und wie er da lächelt! So sitzen sie da und hören zu, zwei der wenigen, die nicht quasseln. Kataryna und Tatiana spielen wieder das Air; oder daß das technische Personal strahlendweiße Overalls trägt, im Gegensatz zu den, sagen wir, Arbeitern, die blaue tragen; oder Der Posten
Der Posten ist zu stehen hier
zu sehen – wir
durchgleiten beinah still
die Seeund dann schon wieder der Roman: Die „Geweihten“ geben immer an, ein bestimmtes Fahrtziel zu haben, aber ist es erreicht, haben sie ein anderes und behaupten leise, dieses andere immer schon gehabt zu haben, sowie, was mir nach der „Paris-Gala“ deutlich wurde, die ein paar Evergreens aneinanderhing und mit Tanzeinlagen durchsetzte, viel Glitter, immerhin allerdings paar auf Französisch gesungene Chansons, doch Abschluß mit, womit sonst, dem berühmten Can-Can, aber einem, der jeglichen Skandal schon längst verloren hat. Um das, was er einmal gewesen, wiederahnen zu lassen, genügt es nicht, Strumpfhalter und Rüschenhöschen zu zeigen; damals war das schwer obszön, heute ist es harmloser als ein unterm Bademantel getragener Bikini. Nein, die Damen müßten komplett nackt unter ihren Rücken sein, wenn sie die Beine werfen, und so, wie D‘Annunzio schrieb, „glatt wie der Marmor von Paphyr“. Dann wär das Zucken wieder da, und die Entrüstung, freilich, auch.
Aber die Menschen sind es zufrieden, man ist um ihr Wohlsein von morgens früh bis abends spät bemüht, und sie fühlen sich wohl, wenn ihre Weltsicht sich streichelt. Dazu gehort das „Unsitthafte“ n i c h t – oder nur für wenige. Denn womit verbringen die meisten ihre lange Zeit hier an Bord? Einige stricken, andere sitzen da und, tatsächlich, sticken Muster auf Taschentücher, die in runde Rahmen gespannt sind; andere spielen Karten, viele lösen Kreuzworträtsel, manche lesen, bedienen sich in der Bordbibliothek. Im übrigen wird vor allem gegessen, wahnsinnige Mengen, ich frage mich immer, wo das eigentlich reinpaßt in die Leiber.
Einige Außenseiter – das können durchaus Paare sein – aber sitzen und schauen, schauen aufs Meer, in die Wolken, oft schweigend. Andere plaudern von früh bis spät. Ich setzte mich dazu. „Oh, Sie kommen zu uns? Wir dachten schon, Sie seien ein unsozialer Mensch, weil Sie immer nur dastehen an Ihrem hohen Tisch und schweigen.“ Wie könnte ich Ihnen erklären, daß ich nachdenke, vorausdenke, ständig denke, im Sinn einer sehr zielgerichteten Tagträumerei, einer Freiheit des empfindenden Denkens, deren Zielgerichtetheit im Umkreisen besteht?
Überhaupt gebe ich einigen unterdessen Rätsel auf. Nach der Show trat eine s e h r alte Dame auf mich zu, eine s e h r gepflegte, wenn auch nicht mehr wirklich bewegliche, so doch höchst elegante Erscheinung, und legte mir eine Hand auf den Arm – was eine pure Geste war, die aber die Macht hatte, mich zu ihr hinunterzuziehen, ohne eben daß sie zog; es genügte das Handauflegen völlig, und ich, ja, gehorchte. „What ist your role on this ship?“ fragte sie. „It must be something secretive...“ - Aber wir standen im Durchgang, in der Tat setze ich mich kaum je, sondern stehe meist hinten in den Räumen, weil ich von dort die Übersicht habe. „Bitte, Lady, fragen Sie mich das morgen. Es ist zu laut jetzt, zu viel noch los, um Ihnen die Antwort zu geben.“ Leider fiel mir das englische Wort für „angemessen“ nicht ein; die angemessene Antwort, d a s hatte ich sagen wollen. Dabei war das Geheimnis, so nämlich schritt sie dann, und lächelte, weiter, gar nicht auf meiner Seite, sondern ganz auf ihrer. Und ich bin mir sehr unsicher, ob sie das nicht vielleicht sogar gewußt hat. Ihre Art zu gehen, insgesamt, war wissend.
Eine greise Elbin, dachte ich, die sich aber ihre Luzidität völlig erhielt; une femme verte. Und wußte, eine nächste Person des Romans hatte sich zu erkennen gegeben, vornehm, nicht ironisch oder spottend auf Schabernack aus wie diese zwei, ich sag mal, Kobolde dort meiner Abenteurergruppe:  Zu denen freilich paßt, daß einige an Bord davon überzeugt sind, es gebe hier einen Geist, „Klabautermann“, erklärte ich zwei Musikerinnen am Abend, „nennt man den in Deutschland“. Auch an sowas hatte ich für den Roman vorher noch gar nicht gedacht, und auch im Hörstück könnte er eine Rolle spielen. Lanmeister jedenfalls wird ihm begegnen: als Entsprechung zur kleinen wellenreitenden Nereïdin, von der ich neulich schrieb.
Es war lange schon dunkel, der Mond geht auf voll; die Wogen rauschten, grollend stampft der Motor drunten im Schiffsbauch, und hell im Licht des Trabanten zieht aus den zwei schweren Schornsteinen unser Rauch übers Meer. Wir sitzen in der Raucherecke. Und die Musikerinnen klagen leise: jeden Tag, seit Monaten, dasselbe spielen, und niemand hört doch wirklich zu. „Ich tue meinem Instrument weh“, sagt A. „Es geht nicht mehr so weiter“, bestätigt B. „Wir brauchen etwas anderes, etwas, wo wir auch gehört werden und nicht nur Staffage sind, die ebensogut aus Lautsprechern als Background laufen könnte.“ „Wir können uns nicht mehr entwickeln, ja, anfangs war das toll, daß wir die ganze Welt sehen konnten, aber was, in Wirklichkeit, sehen wir denn?“ Und ihr Instrument sei mit ihr böse, sie merke das sofort, wenn es – im übertragenen, aber eben auch dann wirklichen Sinn - verstimmt sei. Außerdem, mit 19 sei sie aus dem Haus, jetzt sei sie 26 und habe in all den Jahren ihre Eltern nur dreimal gesehen; „ich sehne mich danach, einmal wieder umsorgt zu sein, daß man nach mir schaut, und dann ist man immer doch auf sich allein gestellt und träumt nur von daheim.“ „Ich bin kein Zirkuspferd.“
„Ihr könntet“, sage ich, „den Menschen etwas geben. Es müßten Geschichten erzählt werden, so daß sie zuhören wollen – und dann auch der Musik zuhören würden, weil sie dann etwas verstehen würden. Wenn wir etwas nicht verstehen, hören wir es auch nicht. Es muß uns jemand bei der Hand nehmen und in die Dinge einführen; geschieht das, gehen alle r e i ch hinaus, geschieht es aber nicht, ist man zwar befriedigt, aber man bleibt arm.“
Was mir die Wogen erzählen.
(Zwei Tage noch bis >>>Afrika).
*******
albannikolaiherbst - Sonntag, 13. April 2014, 08:38- Rubrik: Arbeitsjournal
(Montag, 8.12 Uhr.
28º04‘ S/37º29‘ O.
Kurs 222º SW.) Dies war nun zum ersten Mal auf dieser Reise: Einsamkeit. Nicht nur Fremdheit, aus denen ich auf Reisen ja durchaus Reize zu gewinnen weiß, sondern ein Alleinsein wie hinter Glas. Die fremde Sprache funktioniert da allenfalls so, wie Mikrophonanlagen, die den Gefangenen mit dem Besucher verbinden, aber über Tausende Meilen, so daß die Kommunikation immer wieder abgebrochen und/oder zerhackt wird, wie ich es hier bei Skype mit der Löwin ständig erlebe. Räumliche Entfernung, indes, ist verstehbar, seelische nicht oder nur sehr viel weniger.
Es war „Disko“ angesagt für die Nacht, und ich, ja, Sie lesen richtig, freute mich drauf. Ein tropisches Buffet dazu, dessen Früchte unser Herr der Gastronomie persönlich auf Mauritius‘ großem Markt ausgesucht hatte, handverlesen reich. Nun kam ich selbst freilich ein wenig spät, erstens gewohnt aus Berlin, daß man zu Tanzveranstaltungen auf keinen Fall pünktlich geht, sonst steht man lang noch allein herum, sondern erst sowas, sagen wir, einzwei Stunden später; zweitens weil ich die Nachtserenade noch hören wollte, im Herzen ein wenig die Hoffnung, die Musikerinnen, nachher, begleiteten mich. Aber die schmale Ukrainerin, noch schlechter im Englischen als ich, ist scheu wie eine Wölfin, tritt auf, lächelt von unten herauf mit ungemeiner Innigkeit ihre Duopartnerin an, wenn sie wählen, welches Stück sie nun als nächstes spielen; dann aber, ist die Serenade vorüber, entflieht sie wie eine Meerjungfrau und bleibt, bis der nächste Auftritt erfolgt, unter Wasser, tief drunten, in einer Muschel vielleicht, verborgen. Ich stelle mir vor, sie, die Muschel, sei ganz aus Musik. (Sie wird aber voll der Sorge sein, um, bemerkte vorhin die Löwin bei Skype, ihre Lieben daheim im geschüttelten Mutterland).
Jedenfalls kam ich aufs Achterdeck, da war die Party voll im Gang, die Oldies tönten übers Meer, und halt die Oldies tanzten. Es ist keine Vermessenheit, wenn ich das so erzähle, wie ich es tu, aber so sehr es mich in den Beinen juckte, ich mich bewegen wollte, ich hätte da einfach nicht hingehört. Zum einen, weil es etwas sehr Bizarres hat, wenn sich alte Leute bewegen, wie wenn sie fünfzehn wären, sich so zu bewegen versuchen, zum anderen, weil diese Ausgelassenheit, die herrschte, keinen Beobachter haben darf; für sich alleine ist sie in Ordnung, menschlich, sogar nahe, nicht aber, wenn das Fremde hinzutritt und seinen Blick darauf wirft. Hinwiederum war dieses Fremde ein Steppenwolf aber, der gerade deutlich auf eine Beute auswar, die sich unter den Tanzenden eben nicht fand. Und dort nicht finden konnte. Die aber, die es hätten werden können, saßen, sofern sie denn dort saßen, abseits im Rauchereck beieinander und sprachen; es geht eine Grenze zwischen dort und hier, und ich stehe mitten darauf: Sie geht, so empfand ich, mitten durch mich hindurch; ich bin von ihr durchstochen und auf diese Weise fixiert.
Es ist besonders eine Angelegenheit der Körper; ich bin nach wie vor trainiert und, abgesehen von der blöden Achillessehne rechts (wenn ich zurück bin, werd ich nun doch mal zum Sportarzt gehen müssen), in geradezu vibrierender Verfassung: So etwas will. Aber geht nicht zusammen mit den Älteren, kaum denen der gleichen Generation, weil eben die Körper der anderen so vernachlässigt wurden; kaum jemand, der nicht Bauch hat, kaum mal eine elastische Biege der Rücken, Spiel der Sehnen der Schenkel, Gesäße, die nicht hängen; und dazu der Geist: bei wem er ist, war gestern nicht beim Tanzen, denn das, denkt Gregor Lanmeister, der ja auch nicht mittanzt, hat Gründe, deretwegen er eben nicht mitttanzt. Ja, beschämt ein wenig, hat er sich auf sein Bootsdeck zurückgezogen, wo er nicht einmal mehr die Musik hört, sondern nur immer das Meer, das Meer, auf dem er davongleiten wird.
Und „natürlich“, so möchte ich schreiben, waren es alles Paare gestern abend, die ja ihre Reise machen, man ist als Einzelner auch insofern schon fremd, Paare, die zurückblicken und sich im Tanzen erinnern: ein höchst intimer, persönlicher Vorgang, der sich nur unter Gleichen mitteilen läßt und sich so austauscht und nur unter Gleichen nicht affig wirkt, sondern da ganz für sich wahr ist. - Also wartete ich, bis sich die Reihen lichteten. Der Mond stand hoch über uns, beinahe voll, mit einem riesigen Halo, und warf achtern ein glimmendes Silber über das Meer. Noch saßen die jungen Leute in der Raucherecke, auch die Geigerin. Vielleicht sie doch, dachte ich. Und fing für mich, abseits, zu tanzen an. Eine Art Lockuf der Gesten. Er wehte und verwehte über die Reling, wie mir der neue Schal um den Nacken flatterte in seinem blassen und nach Braun verwischten Ockergold. Eine Filmszene, dachte ich, es dürfte niemand sonst da sein. Selbstgenügend autoerotisch: aber eben das war es ja nicht, sondern vergebens. Hätte ich sprechen können, wirklich sprechen, ohne nur radezubrechen, ich hätte dem allen eine Wendung gegeben, vertraut in meiner Sprache mit meinen Abgründen, die ich in den Wörtern schillern lassen kann, schlittern, kreisen; es wäre mir nicht schwer gewesen, das no go zu unterlaufen, das durchaus sinnvollerweise Crew von Passagieren getrennt hält, aber diese Abgründe sind mir in der fremden Sprache vergittert. Ich ahne, wo die Fallen liegen, aber zeige immer daneben, und stürzte selbst hinein, wo ich im Deutschen mit Eleganz hinunterzuklettern verstünde, Surfern gleich hinunterzu<>gleiten. Ohne Vollendung der Sprache, ist man als erotischer Spieler disqualifiziert; eine Erfahrung, die ich immer wieder mache, hier aber, in der doppelten Zwischenwelt dieses Schiffes, seiner selbst wie der meinen, brennt sie sich unter die Haut, und man trägt sie wie ein Tattoo aus Fremdheitspheromonen: Keiner sieht es, aber jeder nimmt es wahr.
Welch eine Erlösung dann, momentlang selbstverständlich nur, als einer der Sängerinen, mit der ich schon ein paarmal geplaudert, auf mich zutrat, nach meinem Befinden fragte, und ich legte kurz den Arm um ihre Taille und sie sich, ebenso kurz, in ihn hinein: Berührung. Dann ward sie schon davongerufen von den Freunden und Kollegen. Ich aber ging zur Bar, nahm einen nächsten Whisky und gab es auf. 
*****Einen Tag vor Afrika. Morgen werden wir die Ozeanüberquerung abgeschlossen haben, dann noch die Küste hinunter auf dieser See etwas schippern, bis wir das Kap umrundet haben und in den Atlantik einfahren sein werden. Vorher aber, morgen, Durban. Ein Wiedersehen für mich - nach, rechnete ich vorhin übern Daumen, achtundzwanzig Jahren -, dem ich entgegenfiebre. Um acht Uhr werden wir im Hafen angelegt haben und von Bord gehen können; erst um 20 Uhr abends wird es weiterfahren. So daß es unwahrscheinlich ist, daß ich morgen hier schreiben, bzw. von dem Erlebten schon etwas erzählen werde, sondern wohl erst übermorgen wird in Der Dschungel etwas davon stehen. Ich möchte mich aber, weil es zwar wahr, zugleich aber so unfair ist, was ich über die gestrige „Disko“ schrieb - weil es letztlich frustriert ist („frustra“ heißt „vergeblich“) - entschuldigen, bevor ich dieses schließe, und tu es, und meine Entschuldigung sieht so aus:  Damit ist bei i h n e n alles Recht, nicht bei mir. *******
(20.41 Uhr.) Ich war gestern zum Früchte-Buffet ein wenig zu spät gekommen, das schrieb ich Ihnen bereits. Die Küche, heute, schuf den Ausgleich, was zudem den Vorteil hatte, daß ich auch dort, zur späteren Verwendung, einige Töne aufnehmen konnte. Und ich habe einen neuen Cocktail entdeckt, auf der Basis meines allabendlichen Campari-Sodas: Negroni. Bitter und schwer, serviert im Whiskyglas. Campari, Gin, roter Wermut.
Als ich aß, unterm vollen Mond, war das Meer wie eine Elefantenhaut so zäh. Und schillerte doch. Ich esse fast immer allein, bin dessen aber zufrieden. Schon deshalb, weil alle anderen drinnen dinieren, indessen mich, wenn es nur geht, nichts, aber auch fast nichts unter Deck hält, schon gar nicht ein Restaurant.
Für Durban, morgen, gilt Sorgfalt in der Kleidungswahl. Nicht zu westlich, vor allem nicht „kolonial“. Weiße aufgekrempelte Hose, lose das Hemd darüber, am besten die indischen Sandalen, aber weil ich weiß, daß ich wieder Kilometer um Kilometer gehen werde, nehme ich auch noch die unterdessen fast zerrissenen Chucks mit, schon wegen der wehen Achillessehne. - Eine, übrigens, der besten Tarnungen, die es gibt, ist eine Plastiktüte, die man wie frisch vom Einkauf trägt. Schon mein kleiner Arbeitsrucksack, so praktisch er ist, wär mir zu provokant. Daß ich weiß bin, ist Risiko genug – nach den bitteren Erfahrungen, die diese Menschen mit uns haben. Und gegenüber den allermeisten von ihnen ist jeder von uns, auch wenn nach westlichen Kategorien arm, nicht nur begütert, sondern - reich. Und das ist ein Fakt. *******
(Ab morgen, Leserinnen, Leser, sind wir wieder zeitidentisch.)
*
albannikolaiherbst - Montag, 14. April 2014, 20:04- Rubrik: Arbeitsjournal
 Seit morgens um halb fünf kann ich vor Aufregung nicht mehr schlafen, schnüre wie fiebernd an Deck auf und ab. Afrika! Afrika!
(Die Erzählung folgt dann morgen. Wir fahren soeben in den Hafen ein, und ich will Töne nehmen, Töne!)
albannikolaiherbst - Dienstag, 15. April 2014, 07:11- Rubrik: Arbeitsjournal

(Gestern, am Dienstag, dem 15. April 2014.)
Bereits um halb fünf in der Frühe, liebe Leserin, hatte es mich nicht mehr im Bett gehalten, auch wenn schwer noch die Nacht über dem Wasser lag, das, ich muß nur den Kopf etwas drehen, um es zu sehen, kann dafür einfach liegenbleiben, unter der Bordbeleuchtung schäumte. Afrika, Afrika, dachte es dauernd in mir, und ich stand auf. Ich habe nicht mehr gewußt, wie tief meine drei bisherigen Begegnungen mit diesem Kontinent sind – Nordafrika zähle ich nicht hinzu, eigenwilligerweise; aus wahrscheinlich literarischen Gründen gehört Tanger für mich zu Europa. Sondern die Savanne hat sich mir in das Herz gesenkt und ist dort, merkte ich, geblieben, ebenso die kleinen Reservate der südafrikanischen Ostküste, dort, wo sich Flußpferde, Krokodile und Haie tatsächlich dieselben Gewässer teilen, Schwarzafrika jedenfalls. Das nervöste in mir herum.
So stand ich auf und, jaja, lief an Deck, sah noch gar nichts, lange noch nicht, aber ein enormer Wind ging; man konnte am Bug kaum stehen, und achtern warf er dauernd die schweren Holzstühle um und verrückte die Tische. Es blieb aber hell, beinah sonnig, als denn das Licht gekommen war; erst als wir an Land waren, stürzte es um.
Bis dahin aber verging sehr viel Zeit. Bereits die Einfahrt in den riesigen Hafen erwies sich als ein wenig kompliziert und wollte schließlich ein höchst ungewöhnliches Manöver. Nicht nur, daß wir, wie der Ausdruck lautet, „auf dem Teller“ wendeten, das Schiff also mitten im Hafen einmal herumdrehten, nein, wir „parkten rückwärts“ ein, fuhren dafür auch rückwärts einige Zeit. Lässig der Lotse beim Captain, dieser stoisch die Hände auf dem Rücken, bedacht umherblickend, mal ein wenig an seinen Reglern nachkontrollierend, eine insgesamt höchst elegante Angelegenheit, als hätte der Lotse mal gucken wollen, was der Mann so kann, und dieser ruhig mitgespielt: Später kamen die beiden durch die Abfertigung flaniert und schienen, indem sie völlig schwiegen, vertraut wie befreundete Spieler zu sein.
Später, dies ist das Wort. Afrika. „Als Gott die Zeit schuf, hat er genug davon gemacht“: Selten hatte ich das indische Sprichwort so oft auf der Zunge wie gestern. Bereits mit der Abfertigung der Paßkontrollen ging das los. Wir wurden in Gruppen eingeteilt, die schwarzen Kontrolleure kontrollierten bei uns an Bord – aber nur jene Passagiere, die geführte Exkursionen gebucht hatten und draußen von Bussen erwartet wurden. Alle anderen mußten warten, warten aber auch dieser, weil das Problem darin bestand, daß es diese Busse nicht gab, jedenfalls noch nicht.
Nun war ich ja früh genug, um still für mich zu sein, ahnte noch nicht, was würde. Denn vorabends hatte ich mich mit den beiden Musikerinnen des „Diamond Duo“s verabredet, die Durban gerne sehen wollten, aber alleine sich nicht trauten. Es geht die Rede davon, die Stadt sei gefährlich. Also wollten sie sich mir anschließen, und ich mußte nun, und wollte auch, warten. Dennoch kam ich schließlich für alles weitere immer noch früh hinaus; wir, die wir „individuals“ genannt wurden, weil wir zu keiner Gruppe gehörten, wurden denn auch nicht wie die anderen an Bord, sondern am Terminal abgefertigt, was Ewigkeiten dauerte, weil die im übrigen ausgesprochen freundlichen Grenzer die Pässe nicht etwa nur scannen, nein, sie tippen sie ab. Dann wird der Sichtvermerk mit der Hand ausgefüllt und je in die Pässe hineingeklebt. Sowas braucht schon seine Zeit bei einer Kreuzfahrtbelegung. Also dachte, ich stell mich gar nicht erst in die Schlange, sondern setz mich draußen vor den Eingang und guck dem Vorgang stille zu. Was eine gute Idee gewesen wäre, hätte nicht der Wind derart aufgefrischt, daß man kaum aufrecht stehen konnte. Es flogen denn auch die Hüte davon, und einmal riß es fast den Pfeiler, der das Vordach das Passagierhalle hält, aus seiner Bodenverankerung; bevor dieses Dach nun runterkallen konnte, schlenderten zwei Arbeiter herbei, um die Stütze mit einem dagegengekeilten schweren Steinstück zu fixieren. Mehrmals traten sie das Ding dann fest. Man hörte es geradezu so: „So, das hält.“ Auch das war nett zu beobachten, weil man dabei eine Vorstellung davon bekommt, daß es Leben auch jenseits allen TÜVs gibt. Problematisch war nur, daß die dann endlich abgefertigten „Individuals“, nachdem tatsächlich Busse aufgetaucht waren und die, sagen wir „Groupies“ davongebracht hatten, von draußen wieder hereinkamen, ja aufs Schiff zurückstiegen, denn es gab draußen keine Shuttles in die kaum einen Kilometer entfernte Innenstadt, und zu Fuß zu gehen, verwehrten einem die Sicherheitsleute. Die Astor hatte, weil sich eben dort die Kreuzfahrer-Mole befindet, mitten im Industriehafen angelegt; Passage nur für autorisierte Kräfte. Ohne Shuttle kein Davon – oder man sollte eines der vier Privattaxen nehmen, die draußen standen und eine angemessene Lizenz hatten, oder auch nicht hatten, sondern mit Hafenleuten verbandelt waren, die sie halt durchlassen und -ließen. Afrika. Alles sehr einsichtig, wenn ich heute zurückdenke. Doch die Individuals, die allein in die Stadt wollten, waren nicht richtig afrikanisch. Und strömten eben deshalb sie aufs Schiff immer wieder zurück. Afrikanisch ist zudem, daß man zwar bei der Einreise sehr genau überprüft und auch das Handgepäck gescannt wird, aber nachher, hat man dreivier Worte mit den Kontrolleuren gewechselt und, vor allem, gelacht, kann man sich völlig frei hin- und herbewegen, auch immer mal wieder durch den Körperscanner zurückschlendern, der dann tutet, die Grenzer lachen und winken ab. Nur aus dem Hafengebiet selbst kommt man nicht raus.
Nun saß ich in der Falle. Denn die Crew darf das Schiff erst verlassen, wenn der letzte Passagier heraussen ist, und diese Passagiere aber, jedenfalls einige, stiegen über die Gangway halt in das Schiff immer wieder zurück, teils verärgert, teils einfach nur verwirrt, und da sich manche nicht mehr richtig bewegen können, sondern rollbare Gehhilfen brauchen, müssen nun auch diese immer wieder die Gangway hochgetragen werden, kommen aber logischerweise auch wieder runter, weil es ja darum geht, irgendwie in die Stadt zu gelangen.
Ich saß immer noch draußen und guckte mir das Hin und Her an, immer stoischer werdend, und immer heftiger riß der Wind an mir. Das Schiff, derweil, wurde betankt. Dann erschien Ioan, um mir weiszumachen, die Mädels seien schon hinfort. Kann nicht sein, sagte ich, es gibt einen anderen Ausweg – ja, „Ausweg“ sagte ich – als hier diesen, und da säße ich und paßte auf. Er also wieder hinein, winkend dann von oben, jaja, die beiden warteten, aber es seien immer – derzeit wieder – dreißig Passagiere an Bord, die müßten erst hinaus. Und um dem ganzen die Krone aufzusetzen, wurde mir erklärt, auch ich müsse mich erst abfertigen lassen, egal, auf wen ich wartete, und warum, weil die Grenzer das so vorgesehen hätten: Erst würden auch afrikaseits immer – es fiel wirklich das Wort „immer“, always – zuerst die Passagiere mit Visae versehen, danach erst die Mannschaften.
Es hat wenig Sinn, einer solchen Vorschrift auf den Grund gehen zu wollen, schon gar nicht, sich ihr zu widersetzen; allerdings läßt sich eine jede, wie ich dann abends bewies, einfach unterlaufen. Was allerdings zu, kleinen meistens, Abenteuern führt. Jedenfalls mußte ich jetzt doch, ohne die beiden Damen, durch die Kontrolle, aber sah immerhin Tatjana oben schon stehen; wir winkten kurz, dann war ich fort und wartete außerhalb des Terminals, immer noch freilich innerhalb der Security-Zone, nahe die Stadt, die ersehnte, und doch so fern, und weitere Passagiere, hilflos, gingen wieder in den Terminal rein und wahrscheinlich abermals aufs Schiff zurück, so daß es wirklich dauern konnte, bis meine Begleiterinnen hindurchwärn. Aber so war mir Zeit, mich zu entschließen, daß wir gleich eines der Taxis nähmen; für mich, der ich am liebsten alles zu Fuß erschreite, durchaus ein Haltungssprung.
Nichts störte mich aber, eher fand ich die Situation ziemlich komisch; außerdem hatte ich Zeit, ein paar Wörter Zulu zu lernen, um wenigstens „Guten Tag“, Suwabona, sagen zu können, „Danke“ (schwer auszusprechen für unsereinen:), Ngiyaonga, weil „Ng“ geschnalzt werden muß. Aber es ist der mindeste Respekt, den man dem andern Land bezeugen muß, und erwies sich später als geradezu wundervoll, weil, wenn man es, so falsch auch immer, sagt, ein breites Lächeln zurückkommt. Alles übrige darf man dann sprachgemixturet radebrechen. Tun die andern auch.
Gut, und dann waren sie da, die beiden Schönen. Schon saßen wir im Taxi. „Market“, sagte ich, der vorne einstieg mit dem witzigen Gefühl eines, der glaubt, daß das Steuer auf der „falschen“ Seite angebracht ist, und will deshalb immer selbst auf die Pedale treten. Wo keine sind.
„ Indian market?“ fragte er.
„Indian Market“, sagte ich.
In keiner Stadt der Welt, außer in Indien selbst, leben so viele Inder wie in Durban. Das wußte ich noch von vor dreißig Jahren. Aber die gesamte Hafenfront, die Erscheinung der Stadt selbst hat sich enorm verändert – sofern sich derart alten Erinnerungen vertrauen läßt.
Wie das Geschäft gehe? fragte ich. Schlecht, sagte er, very very bad. - Aber er habe doch einen ganz guten Standort dort. Nein, sagte er, die meisten Passagiere würden organisiert von Bussen abgeholt, sie, die Taxifahrer, hätten imgrunde kaum eine Chance. Und als er uns mitten im Getümmel absetzte, fragte er, ob er uns vielleicht auch wieder abholen dürfe, nein, das mache ihm nichts aus, ein paar Stunden zu warten... - Es tue mir leid, wirklich, von Herzen, aber wir wüßten ja gar nicht, wo wir schließlich landen würden. Das sah er ein. Die Fahrt kostete 100 Rand, das sind keine sieben Euro.
Und dann warn wir drin in der „gefährlichen“ Stadt. Gingen von Laden zu Lädchen durch Ladenpassagen und längst den überdachten und nicht überdachten Ständen. Von einem „Slum“ hatten von den Sicherheitskräften abgewiesene Passagiere erzählt, am Terminal noch, müsse man hindurch, wenn man zu Fuß gehe. Ich frage mich noch jetzt, wo sie den wohl gesehen haben. Man mußte durch endlos wirkende Industrie- und Containeranlagen durch, das ja, aber „Slum“? Und die Stadt selbst ist wild, weniger aber als >>>> Port Louis gewesen, nur halt größer, sehr viel größer, das Risiko aber nicht bedeutender als in einer unserer europäischen Städte, ob Paris, ob Rom, ob Berlin. Auch arme Leute wollen leben und holen sich, was sie brauchen, ob legal oder nicht; auch sie ernähren Familien. Wenn man das weiß und achtet, sind sie nicht nur fair, sondern ausgesprochen freundlich. Wie überhaupt Freundlichkeit ein Charakterzug der Menschen Durbans ist, und Neugier, klar. Wo wir drei uns schließlich herumtrieben, sah man nur ganz gelegentlich jemanden Weißes, und wenn, waren auch das Südafrikaner. „Man könnte denken, du bist hier zuhause“, sagte Kateryna, die innerhalb von fünf Minuten alle Sorge verloren hatte; kichernd durchstöberten die Damen die Textilindustrie, und kichernd wurde ihnen begegnet. Und ich, ich liebe das, Frauen beim „Shoppen“ zuzusehen, ebenso, wie es immer geliebt habe, ihnen beim Schminken zuzusehen. Zwischendurch wickle ich meine eigenen Geschäftchen ab, einen Schlangenleder dort, Süßigkeiten hier, das Gespür bekommen, wo man handeln muß und wo man das aus Anständigkeit eben n i c h t tut, weil der Preis für jemanden wie uns sowieso schon so lächerlich ist, daß man sich schämt. Sie haben ja r e c h t, die Diebe, die uns bestehlen. Es kam aber keiner. Im Gegenteil: Wo seid ihr her? Was macht ihr? Seid ihr zum ersten Mal in dieser Stadt? Dann die Nummer mit dem Internetzugang; die Damen wollten unbedingt Kontakt mit ihrem Zuhause, Tatjana mit ihrer Mutter, Kateryna mit ihrem Freund, wurden nervös, nirgends ein WiFi. Wir fragten an einem komplett leeren, dafür sehr großen Informationsraum für Touristen nach; der Berater stand auf und sagte: Wartet, ich bringe euch hin. So folgten wir ihm durchs Gewimmel über zwei riesige tutende hupende bremsende jaulende Verkehrsadern in eine Mall zu „Nino‘s“, welches eine Mischung aus Kaffeehaus und Mittags-Speisegaststätte ist. Verhandlung mit einem der Kellner, Hand streift dann Hand, nein, nur die Finger streifen; innerhalb von Minuten hatte ich mir diese Geste angewöhnt. Selten habe ich so viele Hände berührt und so viele meine wie gestern in Durban. Angstfreiheit ist das beste Visum, das es gibt; man trägt es auf der Stirn wie ein unsichtbares Drittes Auge, von dem, aber allein als Wärme, Licht strahlt. Damit waren wir schon alle drei gesegnet. Auch wenn es zu regnen angefangen hatte, na gut, zu schütten. Aber da waren Kinder, die den Regen betanzten, auch wenn er, weil dieses Stürmen dazukam, kalt war. Er ist ein Segen für das Land: Und wiederum, nur die Perspektive wechseln, und es gibt keinerlei Grund zur Klage.
Witzig das Geldwechseln dann in dem Filialchen der Western Union. Zwei Schalter, zwei, sagen wir, Beamte, beide mit indischen Wurzeln, der eine füllt die Formulare aus und prüft die Pässe, der andere zählt das Geld ab, der erste gibt es einem dann. Wir verstanden nicht, weshalb beide die Pässe der Damen nicht akzeptierten, den meinen aber sehr wohl, so daß man zwar das australische Geld der Damen annahm, aber mir die südafrikanischen Valuten auszahlte – für jede Damen getrennt und für mich auch, doch es lief über meinen Paß. Dann fragt einer der beiden Männer, ob ich ihm vielleicht eine der Damen abtreten würde. Das ist als Flirten gemeint, geht aber wiederum über mich. Woher sie denn kämen? Mich gefragt. Auch aus Deutschland? Er schien in die Pässe gar nicht erst geschaut zu haben. Nein, Ukaine und Moldawien. Na gut, wenn ich ihm keine abträte, dann müsse er dort halt hinfahren. Er habe erst fünf Ehefrauen. Ich hob den Finger: das wisse er doch, daß der Prophet nur vier erlaube... - Er stockte, war irritiert. Woher wissen Sie das? Na, weil ich den Koran kennte, und diese Vorschrift sei zum Schutz von Frauen gedacht, jedenfalls gewesen. Sie seien aber sehr schön, diese beiden, wiederholte er und lächelte. So flirtete er mit ihnen, aber indem er mich zum Medium machte.
Kann er sich gar nicht leisten, fünf Frauen, sagte ich, als wir wieder auf der Straße waren. Könnte er‘s, ganz sicher säße er nicht d o r t: hinter seinem Schalter in einem Kämmerchen. Und an der nächsten Ecke fragte mich einer, ob das meine Töchter seien. Da schluckte ich dann doch ein bißchen, aber nur kurz. Nö, sagte ich, nur Freundinnen. „No“, nein, heißt „cha“; um zu nö‘en, machte ich „chä“ draus.
Massenhaft Flugblätter für Potenzmittel, gegen Infertilität, und „Dr. Ramah tells all about you before you say anything to him“ mit drei Ausrufezeichen; anderes auf Zulu, es ist bestimmt eine Schweinerei, was ich jetzt abtippe, drüber eine „Herbal Cream for Ladies“, die, zeigt die Abbildung, riesige Brüste haben oder bekommen wollen: „Uma induku Ingafuni Ukuvuka“. Jedes Flugblatt nahm ich mit, meine obligatorische Plastiktüte hing mir am Handgelenk sowieso schon.
Es wurde Zeit für eine Rast. Wir fanden eine Art Café, auf das wir nur deshalb aufmerksam wurden, weil wir eine bestuhlte Holzbrüstung sehen konnten, die rund um das erste Stockwerk lief. Da saßen auch zwei Leute.
Drinnen: Tiefe Dunkelheit, schwerer Biergeruch, Spielautomaten, kleiner Dancing Floor. Paar Jungs an der Theke, die Bier tranken. Eine doppelte Metalltreppe führte durch die wie solarisierte Dunkelheit hoch, die wir nahmen. Oben ein zweiter Thresen, hinter dem ein junger Mann den Sportteil einer Zeitung las, wozu er gleichzeitig eine Fernsehsoap konsumierte. Kriegen wir hier einen Kaffee? Geh runter, bestell unten, mußt du dir holen. Klar, mach ich.
Wir nahmen draußen Platz, also die Damen taten es, ich treppte wieder abwärts. Ein bißchen genervt wurde geschaut, als ich ausgerechnet Kaffee bestellte. Junge Frauen auf schwindelerregend hohen Absätzen kamen herein, alle hatten ein Lunchpaket dabei, das sie ungeniert öffneten; junge Männer ebenso. Bestellen tat man nur Bier oder Saft. Die Boxen dröhnten Agropop. Den Kaffee zuzubereiten dauerte und dauerte. Afrika, dachte ich. Als Gott die Zeit schuf und so weiter. Der erste Kaffee kam, es brauchte wieder zehn Minuten, dann kam der zweite, und auch der dritte schien sehr eigens zubereitet zu werden. Nach etwas mehr als einer halben Stunde – der erste Kaffee war kalt, während der dritte noch glühte – war ich bei den Damen zurück. Die Zubereiter hatten den Kaffee süßen wollen, was ich abgelehnt hatte; jetzt begriffen wir alle drei, daß das ein schwerer Fehler gewesen war. Süße hätte dem Kaffee eine Ahnung von Substanz verliehen.
Während sich der hölzerne Umlauf mit immer mehr Menschen füllte, die ihre Lunchpakete brachten, Fastfood aus Hähnchen und einer Masse, die aus Erbsen und Kartoffeln gemust war – zu verzehren mit einem sehr schmalen Fladenbrot -, wickelte ich die Gebäckstücke aus, die ich bislang erbeutet hatte. Und wir durften rauchen hier draußen, auch die anderen rauchten, bisweilen, während sie aßen: sehr gut gekleidete meist junge Leute, entweder Angestellte aus den Büros ringsherum oder Studenten von der Uni gegenüber; riesige Vorliebe für High Heels, atemberaubende, aber makellos vollzogene Equilibristiken fordernd, oft ganz schmale Taillen bei enormen Hinterteilen, die wie Fahnen geschwenkt werden, doch Sitzkissen sind, vollkommen unscheues Flirten, immer wieder Hinsehen, hochgradig sexualisiert, ohne Scheu und Vorurteil, einfach nur wollend und lebendig und spöttisch verspielt, auch hochmütig manchmal, weil man das kann oder es sich leistet, weil man es eben n i c h t kann. Wogend. Wirbelnd. „Women tight vagina“, steht auf dem einen der Flugblätter, „Good vaginal smell“.
Die Damen unterhielten sich auf Russisch; ich stand an der Brüstung und sah hinab. Eine Polizistin gab mit vollem Recht die Phryne, doch ohne Aeopag. Der hätte sich, na sowieso, nur lächerlich gemacht.
Sann ich.
Und wir zogen weiter.
Es goß und goß, immer wieder, in schräg vom Himmel schießenden Wasserböen. Innerhalb von Sekunden waren Hunderte Regenschirmverkäufer aus den Straßenecken gewachsen, an den Wandkanten der harten hohen Klotzgebäude, zwischen die sich eine neue Architektur gedrängt hat, die repräsentieren will und soll, aber es immer nur, verglichen mit Hong Kong, halbherzig schafft, weil nicht genug Kapital in der Stadt ist; eine wirkliche Aura verleihen ihr die alten kolonialen Gebäude, oft mit hölzernen Fassadenteilen, Säulen, Umgängen, dazu einiges Art Decot, aber eben übernommenes, vom Zweckrationalem wie von Armut und einer gewissen, ungewissen Anarchie übermischtes, so daß die Gefahr nicht besteht, musealisiert zu sein. Hier ist Disneyland nirgends, allenfalls polierte Oberfläche an den als Surfgründen ebenso berühmten Stränden, wie bisweilige, so genannte Hai-„Angriffe“ sie berüchtigt machen. Aber bis dahin reichten unsere Streifzüge nicht, zumal es doch regnete, heftig, weiterhin in Böen; wir hätten auf dunkles Meer gestarrt, wie es anrollt, zurückgezogen wird, wieder anrollt, und hätten gefroren.
Das taten wir, wenn uns der Wind erwischte, aber auch jetzt immer wieder und wühlten uns deshalb in die überdachten Passagen. Perücken, Perücken, Haarteile dann, wieder Perücken; die Menschen möchten glattes Haar. Dreihundert Rand, vierhundert Rand. Da widerstand Tatjana nicht mehr - ein Spaß, sich die Erscheinung zu verändern:  (Abends, beim Konzert zurück auf dem Schiff, machte das die Runde, und einer ihrer jungen Verehrer mußte sich, sagte er, „setzen“. Überhaupt, der Captain‘s Club war fast voll dieses Mal, und die beiden Damen, ich sag Ihnen, s p i e l t e n! Aber noch sind wir nicht zurück.
Noch suchen wir nach einem letzten Café vor dem Aufbruch-)
- nur, daß um fünf Uhr nachmittags die Läden alle schließen, das geht ganz unmittelbar, plötzlich sind Gitter vorgeschoben und müssen für Nachzügler, die drinnen noch durch Waren stöbern oder ihren Einkauf noch zu zahlen haben, eigens wieder aufgerattert werden. Kateryna stand noch drinnen...
Lachen. Gefangenenbefreiung. Sie war ja nicht allein.
Und das Café?
Wir fragten.
Oh, wir müßten zur „Sun Beach“, da sei alles offen bis spät in die Nacht...
Junges indischstämmiges Paar; sie hatte, stellte sich heraus, hier an der Uni Germanistik studiert.
Doch, doch, ein Café gebe es noch. Klar, in einer der Passagen. Wir warn schon dort gewesen, vorhin; dort hin hatte uns der freundliche Herr vom Touristenzentrum wegen des Internets gebracht. Das aber auch dort nicht funktionierte, auch wenn in den Geräten das WLan-Zeichen andres suggerierte.
Doch für die „Sun Beach“ war nicht mehr die Zeit, wenn wir an Bord zurücksein wollten, ohne zu hasten.
Und dort drüben das Kentucky Fried Chicken?
Für einen Kaffee? Nein, nicht wirklich. - So blieb nur noch, Sie werden es nicht fassen, McDonalds. Wo wir dann wirklich landeten und eine Substanz zu uns nahmen, deren Qualität sich vom Kaffee am Mittag wirklich nicht abhob. Aber sie war heiß.
Neben uns der junge Rapper wollte wissen, woher wir kamen, ich, wo die nächsten Taxis hielten. Ich war ein wenig unruhig geworden, weil im Straßenbild nur selten eines zu sehen war, und wenn, dann besetzt. Ja, die halten ganz woanders; man muß im System der Einbahnstraßen denken; am besten, wir gingen zum Bahnhof. Doch wozu? fragte er, der Hafen sei doch nur drei Straßen entfernt.
Mir, dem Fußgänger, leuchtete das sofort ein. Trotz der Regenböen.
So machten wir uns auf, mußten aber schließlich im Gießen über einen riesigen Flyover, und weil es überdies dunkel wurde und die Hafenanlagen durchaus verwirrend sind, standen wir schließlich tropfend und von den Sicherheitsleuten angehalten im Nirgends einer Holzbaracke. Einer der Männer rief einen Shuttle, wir sollten warten. Das Shuttle kam, einer der für fast ganz Afrika typischen zehn- bis zwölfsitzigen Kleinbusse, in die sich aber, so auch hier, zwanzig, wenn nicht dreißig Leute drücken, pressen, schieben. Zumal es blöd war, daß das Gefährt in ganz die falsche Richtung fuhr. Wir wiesen sanft draufhin, dann etwas weniger sanft, „ah, zu dem Kreuzfahrtschiff wollt ihr“, man hatte ganz vergessen, dem Fahrer das zu sagen. „Nein, da müßt ihr ein anderes Shuttle nehmen. Wartet, ich fahr euch da hin.“ Wir wieder ausgestiegen, nächste Sperre, nächste Baracke, wir aber noch mehr naß als die.
Dunkel und Gepladder. Container um Container, ganze Chinesische Mauern aus Containern, hin und wieder ein Hangar. Paar Arbeiter und wir. Die Sicherheitskräfte. Walky Talkies. Bibbernde Tatjana, zunehmend, aus Abwehr, vergnügte Kateryna und ein ANH, der ahnte, es sei der Odyssee ganz sicher noch kein Ende.
Das Shuttle, das nunmehr kam, war eine Art Cabby, wie sie fürs Golfspiel herumfahrn, sechssitzig ohne wirkliche Hülle um einen herum, wenn man von festen, fettigen, milchtransparenten Plastesichten absieht, die auch als Türen dienen. Schnurrender, weil elektrisch angetrieben, Motor. Rumpeln, durch Hallen, triumphierender Fahrer: Na bitte, da sind wir!
Riesiges Schiff, stimmt. Nur nicht unsres. „Ja, wie heißt es denn?“ Zum zehnten Mal: „MS Astor”. Er neuerlich ins Walky Talky. Dann: „Oh je, da darf ich mit diesem Wagen nicht hin.“
- Es regnete, erzählte ich das schon?
Und weil es regnete, na ja, goß, und weil es dunkel war, knalleduster, aber die vielen Arbeitslampen übers Gelände blendend gleißten und das, was wir noch erkennen konnten, sich in den Planen der Plastescheiben gänzlich verschmierte, war allenfalls zu ahnen, wo unser Schiff lag.
„Da müßt ihr ein anderes Shuttle nehmen. Keine Sorge, ich bring euch da hin.“
Wieder eine Baracke. Wieder Wachschutzleute, vor allem aber Arbeiter für die Nachtschicht.
Ach ja, es regnete. Und gab nicht wirklich Unterstand. Dazu der Wind, der nicht blies, nein, stürmte, nein, auch nicht, sondern tat etwas Drittes, für das mir momentan der Begriff fehlt; aber es ist mit dem Regen eng alliiert. Es muß ein komisches Bild gewesen sein: wir in unseren Shorts, T-Shirts, Sandalen, Wachschutz und Arbeiter in schwerer Sturmmontur, teils Sturzhelme auf, wenigstens aber Mützen, von denen es in die Krägen der wächsernen Regenmäntel troff. Dunkelheit mit Nachtglitz, das sich verwäscht und verwäscht.
Und das nächste Shuttle. Mit Leidenschaft alle hinein. Wir auch.
„ Welches Schiff? Nee, da fahren wir nicht hin.“
Diskussion der Arbeiter, Rufe, Abstimmung.
„Bleibt hier drin jetzt“, sagt die Frau neben mir. „Erst bringt er uns zur Arbeit, dann euch zum Schiff.“
Wir lagen aber gut in der Zeit. Zumal es diesmal klappte. Und selten hat jemand, der dort nicht tätig ist, einen Industriehafen derart gründlich kennengelernt wie wir an diesem Abend. Normalerweise wird Geld mit solchen Führungen verdient, sofern sie überhaupt zugelassen sind. War die unsre nicht, ich bin mir sicher.
„Was hat er gesagt? Daß mein Shuttle zu dem Schiff fährt?“ Nachher der Fahrer zu mir, als ich neben ihn auf den Sitz geklettert war, um wenigstens etwas zu erkennen. „ Dahin? Nee, wirklich nicht mehr meine Tour.“
„Hat ihr Kollege aber gesagt.“
Lachen, tiefer tiefer Baß. „Das war bestimmt der schwere Stoff, den er geraucht hat.“ Lacht weiter. „Den Rest müßt ihr nun aber zu Fuß gehen.“
Er hatte vor einem Sperrzaun angehalten, dessen Tor ganz unbewacht war, das ich aber vom Morgen noch kannte. Auch wenn die Sintflut drüber hinging.
„Ab hier darf ich nämlich nicht weiter.“
Weil es, um das nicht zu vergessen, denn es ist entscheidend, regnete, legten wir diese letzten fünfzig Meter in einem Nu zurück, der, hätte es Zeugen gegeben, ins Guinessbuch der Rekorde aufgenommen worden wäre. Doch außer eben ihm, dem Regen, gab es, und außer diesem Fahrer, keinen, der aber vielleicht längst gewendet hatte und davongefahren war. Indessen uns die Grenzer mit einer Art afrikanischer Müdigkeit im Terminal empfingen, der ein einziger Blick auf uns genügte, von jeglicher Kontrolle Abstand zu nehmen. Statt derer starrten sie in das Naß zurück, aus dem wir wie Wassergeister hervorgetaucht waren. Wir schritten durch die Scannertüren, die warnten trötend. Interessieren tat das keinen.
„Hamba kahle“, sagte ich, mich noch einmal herumdrehend. Und das Lächeln, das ich an diesem Tag schon so oft gesehen hatte, leuchtete auch aus dem Dunkel dieser Gesichter. ***Knapp zwei Stunden später saß ich, heiß geduscht und im Leinenanzug und mit guten Schuhen im Captain‘s Club und hörte meinen Begleiterinnen dieses Tages beim Musizieren zu, beide in eleganten Kleidern und Durbans purstes Rauschgold an der Geige: albannikolaiherbst - Mittwoch, 16. April 2014, 18:14- Rubrik: Arbeitsjournal
(10.55 Uhr.)
Wir schippern die südafrikanische Küste südwärts entlang. Sie ist allezeit in Sicht. Die Sonne ist wieder hervorgekommen. An der Erzählung zu Durban arbeite ich, heute abend wird sie fertigsein und hier drinstehn. „DURBAN oder VOM LEBEN“, so wird er heißen.
Jetzt aber muß ich unterbrechen: Es geht für die nächsten Tonaufnahmen unter Deck in die Mannschaftsquartiere. Das Schiff rollt in gleichmäßigem hohen Schaukeln. Das werde ich dereinst vermissen; ich weiß es schon jetzt. ***( Eingestellt, >>>> d o r t: der Durban-Text.
ANH, 16.4., 18.38 Uhr.) *
albannikolaiherbst - Mittwoch, 16. April 2014, 11:03- Rubrik: Arbeitsjournal
 (20.50 Uhr,
Mozart, Klavierkonzert Nr. 20, Haskil, Lamoureux.)
Der ganze Himmel, rundherum, beim Sonnenuntergang, ein einziger Regenbogen überm Meer. Da sind wir alle aber schon zurück, die einen von der Safari, die anderen von den Bergsichten, die nächsten aus der kleinen Stadt, ich aber, und Sam mit mir, von unter der See. Ich kann Ihnen vom Ort also gar nichts erzählen, nur ein offenes Restaurant empfehlen, das uns die hierüber gezeigte Sicht auf unser Schiff gab, und von der Diving Station erzählen, auf die ich es abgesehen hatte; nur wenige hundert Meter vom Hafen entfernt.
Alles schien morgens völlig unproblematisch zu sein, wär ich nur rechtzeitig von Bord. Doch es gab nur zwei „tenders“ - zwei Boote, um alle Passagiere ans Land zu bringen, und diejenigen, die sich für Exkursionen angemeldet hatten, hatten Vorr/gang: einsichtig, wenn man bedenkt, daß das Unternehmen an diesen Exkursionen verdient, nicht aber an den „inividuals“. Da es aber eben nur zwei Boote gab, die zwischen dem für die MS Astor viel zu lachen Hafenwasser und ihr hin- und herfuhren, wurde es immer später und später, und für den gesamten Aufenthalt waren nicht mehr als vier Stunden vorgesehen – das kann dann knapp werden, wenn man auf einen Tauchgang will, der möglicherweise seinerseits zeitlich terminiert ist. So schnürte ich wie ein Tiger auf Deck 4 auf und ab. Noch eine Gruppe. Und noch eine Gruppe. Ich sah den Tauchgang davonschwimmen.
Mit gewaltigem Auf und Ab brachte das Boot mich endlich hinüber.
Strahlender Tag, nachdem es gestern abend saukalt gewesen und meine Stimmung, aber aus anderen Gründen, sehr in den Keller gegangen war. Aber heute früh schaute ich aus meinen Fenstern, und magisch glitt die Küste, und sehr langsam, daran vorbei: Gischtnebel, der Funken unter den pastellenen Bergen warf.
Bereits am Hafen saß Sam, einer der Schiffshotel Trainees, Freunde erwartend. „Ich hab gehört, du willst tauchen. Vielleicht komme ich mit. Aber da sind meine Freunde halt.“ „Kann dauern, bis die ankommen. Hast du den Tauchschein?“ „Nein, aber hab schon mal schnuppergetaucht.“ „Laß uns mit denen reden.“
Ist leicht gewesen, mit ihnen zu reden. Wir waren überdies die einzigen, und die Kosten hielten sich wirklich in Grenzen; Sam mußte wegen der nötigen Einführung etwas mehr bezahlen, hatte nicht genug Geld mit, aber ich, in US-Dollars, die auch spontan angenommen wurden. Der Umrechnungskurs ist leicht: 1:10, übern Daumen.
Einmal wollte Sam noch abbrechen. „He‘s getting nervous“, schmunzelte mein Buddy. „Give him time“, sagte ich. Da war er auch schon wieder da, habe nur noch mal nach seinen Freunden sehen wollen. Und bekam jetzt seine Einführung: Mein eigener Tauchlehrer würde wahrscheinlich die Hände überm Kopf zusammenschlagen: per Video. Das wiederum, wie Sam dem zusah, wurde gefilmt, damit, „wenn wirklich mal was schiefläuft, wir beweisen können, daß er die richtigen Instruktionen hatte“. Na gut, Afrika. Dabei geht es nicht um die Haie, deren wir einige schon um die Astor hatten herumpaddeln sehen: kleine Hammerhaie, ein- vielleicht eineinhalb Meter Länge, harmlos. Sowieso. Sie seien ziemlich neugierig hier, erzählte der Tauchchef, und mein Buddy (das ist dejenige, den man als Tauchpartner hat: ein unbedingtes Gebot, auf das auch hier geachtet wird) erzählte, daß sie von Ammoniak angezogen würden. Und falls nun jemand mal muß... „na ja, dann kommen sie, und zwar direkt auf da unten zu. Also bleibt nichts, als sie am Kopf zu nehmen und sanft in eine andere Richtung zu heben.“ In der Tat eine der kuriosesten Geschichten und auch Ratschläge, die ich von Tauchern bislang gehört habe.  Uns begegnete aber kein Hai, leider. Oder vielleicht doch, und wir sahen ihn nicht (er dann sicher aber uns). Wegen des Sturms tags zuvor war das Meer aufgewühlt und sandgesättigt; Sichtweite ungefähr zwei Meter. Man muß dann schon aufpassen, daß man seinen Partner nicht verliert.
Korallen, massenhaft, knallerot, gelb:  Und Schwärme extrem neugieriger, drei Handteller großer, aber flacher Fische, die einem direkt in die Maske... ja, so ist es: glotzen. Als könnten sie‘s nicht fassen. Zwei riesige Gelbbäuche dann, dreiviertel Männerbeinlang und drei Männerschenkel dick; die warn aber scheuer, also die Fische, als die Schenkel. Sahen uns - und ab zurück ins Riff. Seesterne, die sich gewaltig verrenkten. Eine Muräne, deren Kopf das Ausmaß uralten Pythonschädels hatte. Nur halt keine Haie, jedenfalls keine, die nahe genug waren, um angeguckt zu werden. Und die Wale kommen erst im August. Aber das sei grandios, wenn man unter denen tauche...
Vor allem aber: schweben. Ich hab‘s Ihnen schon oft geschrieben, daß man beim Tauchen nicht schwimmt, sondern fliegt. Allerdings hatten sie mir zu viel Blei gegeben. Hatte ich erst nicht gewollt, aber der Tauchführer drauf bestanden. Also ging ich dauernd auf Grund, was bei sieben bis zehn Metern ein bißchen sinnlos ist und das Schweben sehr erschwert. Mit der Tarierweste dagegenhalten, klar. Kostet aber Luft. Immerhin motzten meine Ohren nicht, die mir bis etwa zehn Metern nicht selten Schwierigkeiten bereiten. Und ich kam sehr gut mit der Luft hin, wegen der geringen Tiefe; man verbraucht dann weniger als im Mittelmeer, wo es interessant erst unterhalb von fünfzehn/zwanzig Metern wird. In tropischen Meeren ist die Oberfläche prallevoll.
Fünfzig Minuten blieben wir drunten, dann ging es zurück: bei 50 bar noch in der Flasche, gibt‘s da kein Drumrum. Ich hatte zwar noch siebzig, aber Sam war irgendwie hochgegangen und kam nicht mehr runter. Trainingssache.
Mit viel Lachen und Scherzen machten wir uns nach nebenan auf, in das zur Bucht und sowieso offene, das heißt unüberdachte, auf Sandboden, Restaurant, in dem bereits ein Feuer brannte:  Lonely Planet empfiehlt es vor allen anderen in Mossel Bay. Und heiter war‘s, mit dem Wirt zu sprechen. „Soso, aus Deutschland kommst du. Meine Großmutter war Deutsche. Und wann mußt du wieder am Hafen sein? O, in einer dreiviertel Stunde? Wart mal.“ Ruft in die Küche, auf Afrikaans, unser „Mussel Pot“ habe Vorrang, wobei ich, wie er das aussprach, an „mazel tov“ dachte, ganz spontan.
Und dann mußten wir wieder zurück. Wie der Ort aussieht: keine Ahnung. Aber kurz bevor der Anker gelichtet wurde, hingen sie vorne alle weit überm Bug: Hammerhaie kucken:: Und weil ich, was Kapstadt angeht, das wir morgen früh erreichen werde, den Eindruck oder das Vorurteil habe, die Stadt sei ziemlich europäisch, geordnet, werde ich dort nochmals tauchen.
Wir verlassen den Indischen Ozean nun, das Kap werden wir am frühen Morgen umsegeln. Ich hatte gedacht: Das darf auf keinen Fall geschehen, daß ich über den ganzen Indischen Ozean geschippert bin und nicht ein einziges Mal getaucht.
Abgewendet. Toller Tag, ***(Ihnen mehr zu schreiben, obwohl es mehr zu berichten gäbe, schaffe ich heute nicht. Und morgen werd ich überhaupt nicht zum Schreiben kommen, da wir den ganzen Tag über, ab morgens, in Kapstadt sein werden, bis in die Nacht. Aber übermorgen dann.)  albannikolaiherbst - Donnerstag, 17. April 2014, 23:03- Rubrik: Arbeitsjournal
 (19.4.2014, 8.30 Uhr.
Auf See.)
Es ging magisch bereits los, als wir das Kap umrundeten, nicht ein Kap nur, nein zwei: das Kap Agulhas und das Kap der Guten Hoffnung, hinter dem, in der nach dem Berg benannten Tafelbucht Kapstadt östlich eingeschmiegt ist; das „eigentlich“ südlichste Land des Schwarzen Kontinentes ist das Kap Agulhas. Mir war das vor gestern nicht klar gewesen. Kapstadt ist nicht einmal der südlichste Ort.
Aber magisch, eben, ging es los. Eine silberhelle, ausgesprochen ruhige See, der Himmel gänzlich unbedeckt; wäre nicht das Stampfen der Maschinen gewesen, die uns vorantreiben, man hätte den Eindruck eines Gleitens gemacht; wir schaukelten nicht einmal.
Es war kurz vor sieben. Jemand ruft. Noch sind nicht viele Passagiere an Bord, vielleicht vier oder fünf, die wir uns morgens fast immer dort treffen. John fehlte, weil er in Durban die Astor verließ, um in Johannesburg Freunde zu besuchen, von wo er nach Walvis Bay weiterfliegen und dann erneut zu uns stoßen will. Auch Patrick hatte aber den Weg noch nicht aus seiner Kabine gefunden. Dafür saß selbstverständlich die Kreuzworträtsellöser da, der ohnedies die Nächte auf Deck verbringt, meist eine Flasche Wein vor sich, die ihm von Abend zu Abend jeweils ein anderer Reisender spendiert. Es ist das erste Mal, daß ich einem Clochard des Meeres begegne. Er hat eine starke Aura um sich, auch wenn er wenig gepflegt ist, um nicht das Bild des Obdachlosen zu stören. Die Menschen drängen sich an ihn, er ist nun fast immer, tagsüber, in Gesellschaft und erzählt und erzählt, lachend, nicht selten mit weiten Gesten nicht nur der Hände, nein der Arme auch.
Die Rufe brachten ihn indessen von seinem Rätselheft nicht weg und von dem, wahrscheinlich, ersten Kaffee. Hunderte muß er auf die Reise mitgenommen haben, oder aber es werden ihm immer wieder neue zugesteckt, die wiederum die Reisenden mitgenommen haben. - Aber auch ich habe ein wenig Anschluß gefunden, an Peter etwa, ein kräftiger, nicht sehr großer Mann um die 65, mit Hemigway-Bart und -Habitus, retirierter Journalist in bereits dritter Generation, „a hundred years of journalism, that is my family“. Er war auch noch nicht auf.
Die Rufe.
„Wale!“
Wir eilen am Bug nach Backbord. Schauen, spähen. Die See gleißt. Einer hat einen Feldstecher dabei, schaut beharrlich. Und dann, in der Tat, die erste Fluke, die ich auf dieser Reise sehe. Kein großer Wal, aber ein Wal. Entfernt die zweite Fluke, dann glättet sich die See wieder. Wir warten. Steuerbords schwebt das Kap Agulhas über dem blanken Wasser, pastellgrau in der dort sehr hoch gehenden Gischt:  Der nächste Wal. Die Tiere pusten aber nicht, jedenfalls nicht erkennbar. Manchmal ein Rücken, manchmal nur doe Fluke. Sie haben keine Lust aufs Posen, nicht so früh am Morgen. Man meint, sie wollen bitte nichts, als ihre erste Tasse Kaffee trinken, in Ruhe bitte; keine Lust auf Gespräche, bis man den Nachschlaf aus den Augen hat.
Steuerbords, als wir das berühmte Kap umfahren, steht mit einem Mal der Nebel. Er steht dann so dicht, daß sich gar nichts mehr erkennen läßt, und wir fahren mitten hinein. Das Schiff macht sich nun durch immer wieder leise ertönende Huplaute kenntlich, die über das Wasser wabern, gar nicht besonders markant, aber in stiller Permanenz. Bisweilen antwortet aus dem dichten Grauweiß, auf das von Westen die Sonne herunterscheint und es für jedes Auge nun wirklich undurchdringlich macht: 
Aus dem Nebel erscheint, dies im Wortsinn, das Lotsenboot, mit ziemlichem Karacho hält es auf uns zu, geht seitlich neben Bord, drei Lotsinnen werden hineingehievt, das hat es auch nötig:  Erst, als wir durch die ausgesprochen schmale Einfahrt hindurchsind und im Hafenbecken schwimmen, erglänzt die ganze Stadt vor uns. Sie er glänzt in der Tat. Ich hatte nicht geahnt, wie nah der Tafelberg ihr ist, auch nicht, daß er sich wie ein schroffer Felsen über sie erhebt, Gebige tatsächlich, und insgesamt liegt der Ort, wie in seiner Ca‘ d‘Oro, Palermo, in einer zur Bay geöffneten, am Tafelberg aber vertikalkantigen Muschelschale. Als ich dann wenig später in die Stadt marschierte, hatte ich dauernd den Eindruck, in Innsbruck zu sein und auf die hohe Nordwand zu blicken, die einem ohne Rücksicht auf einen persönlichen Raum allgegenwärtig auf den Peltz rückt. Geht man in anderer Richtung, bzw. schaut nach Osten, bleibt von diesem Eindruck nichts.
Orientierungs„technisch“ war ich gestern häufig verwirrt, weil mein Gefühl den Berg nach Norden versetzt und den Blick aus dem Hafen nach Süden. Das ist ganz falsch; der Hafen ist zum Osten geöffnet, und das Gebirge schließt die Stadt gegen Westen ab. Eine, in ihrem Kern, sehr kleine Stadt, sehr viel kleiner, als ich mir vorgestellt hatte; allerdings dehnt sie sich über die abfallenden Gebirgshänge gen Norden und Süden in endlosen Zersiedlungen aus, nach Süden hin ins Edle, Begüterte, nach Norden hin, so mein Eindruck, ballen sich die „einfachen“ Wohngegenden.
Es war mit Kapstadt ein bißchen, wie ich‘s mir vorgestellt hatte, aber auch „ein bißchen überhaupt nicht“; das machte es spannend. Und was meine eingelöste Vorstellung anbelangt, so muß ich auch hier vorsichtig sein. Denn es ist keine gute Idee, in eine fremde Stadt an einem Feiertag einzulaufen, wenn so gut wie alles zu hat. Es betont genau das, was ich an westlichen Städten nicht mag: daß alles reguliert ist, daß die Augen keine Abenteuer haben, nicht wirklich wandern können, sondern immer schon festgeleitet werden. Daß es keine Liebkosung für die Blicke gibt, sondern nur Norm und Ordnung und architektonische Rechtschaffenheit. Kein Aufbegehren, kein Rausch. Das wird in dem Moment anders, wenn Betrieb herrscht, die Straßen verkehrsvoll, die Läden lockend, die Menschen wimmelnd und rufend und schreiend und lachend und Verstöße begehend.
Hier verstieß nichts. Man war wie die Wale am Morgen, sann vor sich hin. So weit denn jemand zu sehen war außer bisweilen die Hafenöde entlangschlurfende Arbeiter, wenige, sehr wenige.  Überdies hatte auch keine Bank auf, wo ich hätte Geld tauschen können.
Weite gepflegte Anlagen, riesige, aber halbtote Zubringerstraßen, plötzlich joggt ein Trupp Läufer vorbei: Two Ocean Marathon, Startpunkt ist das CTICC: Cape Town International ich glaube Communication Center, Schwarze, Weiße, alle Färbungen dazwischen, junge Leute vor allem, bisweilen jemand Älteres. Sonntagsstimmung. Auch auf das blickt der Tafelberg hinab, streng, durchaus streng: ein riesiger Patriarch. Seine Autorität erdrückt die Repräsentationshochhäuser, deren es durchaus welche gibt und zwischen die sich zwei-, allenfalls dreistöckige Gebäude aus dem Anfang der vergangenen Jahrhunderts, ja dem Ende des vorvergangenen drücken, bisweilen noch mit hölzernen Fassaden, manchmal mit sehr schmalen Säulen, die den Vorschein eines Vordaches halten-. Zum Bahnhof hin, dessen enorm ausgedehnte Zweckrationalität jeden Mussolini begeistert hätte, spannen sich Hunderte Meter lange Einkaufszentren, die auch in die Tiefe langen und sehr hallen, wenn niemand drin ist. Verschlafen aber ein Supermarkt offen.
Ich erreiche das Zentrum, das vor einhundertfünfzig Jahren noch Meer gewesen ist, Teil der Bucht, in einer irren Schinderei von Mensch und Esel, ja selbst die Karren litten, zugeschüttet Stück für Stück, den Ozeanen, beiden, abgerungen, wie man sagt, die sich im Busen dieser Bucht vereinen: dem Indischen, dem Atlantischen. Und auf der Zentralstraße das erste Ständ/lein mit afrikanischem Kunsthandwerk, noch im Aufbau jetzt um zehn. Wenig entfernt der Kunsthandwerks aber schon im tüchtigen Betrieb: Schwarze verkaufen, Weiße kaufen, deutliche Touris, ich gehe Schlangenledergürtel gucken. Werde fündig. Handle. Ah! Hier muß man handeln! Und w i e ich das tue. Endlich Leben.
Hab aber keine Rands mehr. Oh, eine Wechselstube. „Ich nehme auch Dollars, Euros, was immer du hast“, sagt mein Feilschfreund. Dauern, überhaupt: „How are you?“ Und man bleibt, um zu schauen, nie allein, nicht eine halbe Minute. Sofort immer eilen die Verkäufer, „good price, I make best price, come in my shop, what you are lokking for?“ Bei einer jungen tiefdunklen Frau mit rasend schönem Lächeln: daß ich für meinen Sohn nach DEMudnDEM guckte (nach was, schreib ich nicht, er könnte dies lesen und wäre dann nicht mehr überrascht). „Give me fifty rands, and I will bring it to you.“ - Na, das will ich ausprobieren. Drücke ihr den Schein in die Hand, und sie verschwindet.
Ich warte. Es dauert lange. Ob sie auf und davon ist? Sich gedacht hat: was ein naiver Tourist?
Ich warte aber weiter.
Guck mal in die Stände nebenan rein. Komm wieder zurück. Eine halbe Stunde vergeht.
Eine dreiviertel Stunde vergeht. Ich bin schon anderswo und handle. Da tippt sie mir auf die Schulter und zeigt, was sie gefunden hat: „Much more expensive, much more expensive.“ Als ich sage, okay, was sie denn haben wolle – allein, daß sie wirklich zurückkam nach so langer Zeit, um das Geschäft zuende zu bringen, mein Vertrauen zu bestärken, alleine daß wäre mir einen überhöhten Preis wert gewesen. Nein, sagt sie, wir haben gesagt, 50 Rand, also bleibt es dabei.
Stolz ist sie.
Und sie packt das Geschenk ganz sorgfältig ein. Wir geben uns die Hand.
Ach ja, die Wechselstube. „Für hundert Euros bekommen Sie hier 980 Rand“, sagt die Frau hinter dem Schalter. „Wie bitte? Was ist denn das für ein Kurs?“ „Ich würd das auch nicht machen“, sagt sie, „es ist furchtbar teuer.“ Ich überschlage den Kurs. „Normalerweise“, sage ich, „bekäme ich an die 1500 Rand.“ „Ja“, sagt Sie, „deshalb würd ich‘s ja auch nicht machen. Zahlen Sie doch in Dollats.“ „Ja-aber wieso dieser horrende Kurs?“ Sie nickt müde zu den Touristen, die sich bei den Nippeshändlern scharen. „Firmenpolitik“, sagt sie. „Dann zahle ich“, sag ich, „wirklich in Dollars.“ Sie lächelt und gibt mir den Hunderter durch die schmale Durchreiche unter dem Sichtglas zurück. Das war vielleicht nicht im Sinn ihres Arbeitsgebers, aber man muß es einen wirklichen Kundenservice nennen. Wir lächeln uns in die Augen, dann blickt sie auf ihre Arbeitsfläche und fängt etwas zu rechnen an. „Eightyfive Dollars!“ ruft hinter mir der Händler, mit dem ich schon seit einer halben Stunde um zwei Schlangenledergürtel feilsche, beide Kobra. Losgelegt hatten wir bei um die zweihundert. *****
Ich hatte Kapstadt gar nicht sehen wollen. Was ich gehört hatte bisher, war: europäisch, zivilisiert, geordnet. Das stimmt auch. So daß ich sehr überrascht war, als ich dachte, der Wahrheit wegen schreiben zu müssen, daß Kapstadt nicht nur eine angenehme, sondern auch eine s c h ö n e Stadt genannt werden müsse, die den Eindruck eines Städt chens vermittle, sofern, wie erzählt, nicht die Siedlungszüge, die wie eine erstarrte, tatsächlich aber wohl immer noch weiterfließende Lave aus Häusern sind, mitgemeint werden; außerdem paßt der verwinkelte Hafen nicht und nicht die vorgeblich beliebteste Attraktion der Moderne: der zur neuen „Waterfront“ ausgebaute Alte Hafen mit Victoria Werft und verschiedenen anderen historischen Becken und Silos und dem Leuchtturm, umbaut von einer nach Pop schillenden überdachten Einkaufsmeile, so nach West wie noch Ost, African Art, Helicopterflüge, Shark Diving in Caches, Futterstellen, tausendgesichtiger Nepp, nichts weniger als zehnmal so teuer wie in der Stadt selbst, hochgechict, alles falscher Glanz und voll, proppevoll, Massen Touristen, als hätte eine Völkerwanderung aus der Stadt heraus hier ins hochkaptalistische Vergnügungszentrum stattgefunden, hat es wohl auch, findet ständig statt, „ugly, ugly“, sag ich zu dem jungen Mann, der Tauchgänge vermitteln soll, kleines Lädchen auf Hochglanz; er gibt mir einen Prospekt: „Du muß Ken anrufen, eine Verrabredung treffen, dann pickt er dichirgendwo up und fährt mit dir zum Tauchgrund.“ Dafür nun war in der Tat keine Zeit mehr, und ich hab auch kein brauchbares Telefon hier, und wäre es dem jungen Mann drauf angekommen, hätte er Ken gewiß sofort selbst angerufen und in Kenntnis versetzt, daß da jemand sei, um einen Tauchgang zu machen. Ich hatte aber auch schon keine Lust mehr gehabt, weil mir dieses Touristengebiet so auf die Nerven ging, von dem hinterher, an Bord, so viele wieder schwärmten. Warum gefällt sowas den meisten Menschen, mir aber nicht, sondern ich scheue es? Woran liegt das? Es ist doch keine Vornahme, im Gegenteil, ich fände es erleichternd, wenn ich wenigstens zuweilen Geschmäcker und Einschätzungen teilen könnte.
Aber weg! Bloß weg!  Es wird doch hier irgendwo noch einen Markt geben mit Gemüse, verdammt. Gibt‘s doch gar nicht im Süden, daß wirklich alles reguliert ist... Warm ist es wieder geworden, die Sonne prallt; noch morgens war es empfindlich frisch. Nein, dort und dort hin gehe man besser nicht. Gefährlich, gefährlich, blablabla. Nicht die Spur:  Und überhaupt enorm, was sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten getan hat; Apartheit, an die in der Stadt überall Tafeln erinnern, ist Geschichtegeworden, Mandela überall zugegen. Ich durchstreife den berüchtigten District 6, heute von Backpacker-Hostels durchsetzt, auch teils hochgechict wieder, mach einen weiten Bogen, lange am Autobahnzubringer, unter ihm, muß ich schreiben, bin geradezu mutterseelenallein dort, kehre um, nächste Schleife, das moderne Opernhaus:  Swan Lake, oh je, und Bryn Terfel gastiert in zwei Wochen, den hab ich dauernd in Berlin. Man mag mich erst nichts ins Entrée lassen, vielleicht wegen meiner kurzen Jeans und dem losen Hemd, der nur noch einbügligen Sonnenbrille, den unterdessen halb zerrissenen, zerschrittenen Chucks, aber eine ältere, hochvornehm wirkende Dame möchte ebenfalls hinein, da kann man mich schlecht draußen lassen, A-Train und so, aber ein Programm will man mir trotzdem nicht geben. Kühle, Reserviertheit, die distanzierte Autorität der beiden schwarzen Empfangsdamen; Apartheit gibt es wohl nicht mehr, Klassenschranken aber sehr wohl. Macht nichts, der Spielplan ist nicht verlockend. Wieder raus. Ich seh Busse, diese kleinen flinken Verbindungsziegen, Hunderte, da oben auf dem Platz, na wär doch gelacht. Und tatsächlich: Das ist dann Markt, sind Buden an Buden, Sonntagsleben dazwischen, man liegt in den Buden, sitzt in den Buden zwischen den Waren, und allüberall schwarze Friseurinnen, die Rastalocken drehen, aber zum Zeitvertreib, scheint‘s und weil man eh nichts andres zu tun hat; paar Jugendliche lungern in der Sonne, es rappt heftig aus einer Baracke, die voller Sonnenbrillen hängt, draußen Kosmetikartikel, am Rand die Busse, noch etwas weiter weg die Geleise des Bahnhofs. Durch eine Mall wieder ins Zentrum, zu den Gardens, vorbei am Nationalmuseum, in den Gardens etwas spaziert, allmählich werde ich müde. Setzte mich gerne nach draußen in ein Café, finde aber keines. Das offene im District 6 war voller Weißer, nur Weiße, wirklich, Popbeschallung, eine MacDonalds-Edelversion, im Zentrum die Cafés entweder zu oder Touristennepp oder – drinnen. Worauf ich nun gar keine Lust hatte, da geh ich besser aufs Schiff zurück und sitz noch etwas am Achterdeck bei einem Campari mit Soda. Dennoch, ich wiederhole es: eine nicht nur angenehme, nein schöne Stadt. Und als ich die Händlerin fragte, was man für „Thank you“ in ihrer Sprache sage, antwortete sie: „Merci“. Da hatte ich meine Lehre des Tages.  Eine nicht nur angenehme, nein, eine schöne Stadt. Märchenhaft gelegen. Aber für meinen Geschmack zu wenig Schmutz. Zu wenig Winkel. Zu wenig Geheimnis. Aber auch das nur auf den ersten Blick, von dem ich, als ich wirklich zurück an Bord war, spürte, daß er oberflächlich sei. Ich müsse nur, spürte ich, tiefer graben. Aber dazu braucht man mehr Zeit. Und tatsächlich, architektonisch, reizvoll ist diese Mischung, die man in der Höhe sieht: d a sind die Winkel, dort, wo die Häuschen direkt neben den Hochhäusern stehen, dazwischengedrückt sind, überwachsen sind, aber nicht wegplaniert, sondern erhalten:  So ist meine Rechung mit Kapstadt nicht geschlossen, da klafft etwas weiter, wobei „weiter“ falsch ist, weil ich zuvor ja gar kein Interesse an diesem Ort hatte. Das Interesse ist jetzt d a: als Ambivalenz. Nichts, gar nichts, kann ein Begehren stärker schüren, mein Begehren. Für Leidenschaft ist sie das Fundament. Die Capetonians, übrigens, die Bewohner dieser Stadt, nennen sie - mother. Vielleicht, weil sie nicht, wie ich oben schrieb, in einer Muschelschaale liegt, sondern in einer, halb aus Stein und halb aus See, Plazenta. Über die nun, am Abend an Bord, die Wolken wieder sanken, tiefer, tiefer, bis alles zurück in Nebel gehüllt war: 
*******(11.30 Uhr.)
Wir sind zurück auf See, sind in den Atlantik eingefahren und schwimmen gen Namibia ruhig nach Norden. Land ist aber keines zu sehen. Schlierwolken, dicht, bedecken den Himmel, bisweilen glüht die Sonne da durch. Dann petzt mir die See die Augen zusammen.
******* albannikolaiherbst - Samstag, 19. April 2014, 11:06- Rubrik: Arbeitsjournal
(Ostersonntag,
The Book of Madrigals, Ensemble Amarcord.
MS Astor, Kabine 227:
 .) .)
Bedeckt der Himmel während der Fahrt ums südliche Afrika, dessen Küste nicht zu sehen ist. Dabei ist sie nah: Es gibt immer wieder Möven überm Kielwasser. Aber die Sonne kam kaum mal durch den Dunst, zu dem sich die Wolkendecke an der Küste gesenkt hat, und böte der Wind auf, wurde es sogar kalt. Also saß ich den Nachmittag über an Achtern und wickelte mich immer wieder in zwei Schals, wollte aber nicht unter Deck. Zumal abends wieder Disko angesagt war und ich nicht abermals abseits stehen, vor allem nicht beobachten und dann wieder ungerecht werden wollte; so wußte ich, ich würde mich nach dem Abendessen zurückziehen. Tat das denn auch, lag auf meinem Sofa, schaute ins Nachtmeer und las und las, ging bisweilen mal hoch zur Bar, um mir einen nächsten Whisky zu holen, futterte Süßigkeiten, die ich vom Nachtmittagstee geraubt, ging noch für einen Cigarillo auf Deck, hielt es aber nicht lange aus, ging wieder hinab, sah dann einen bezaubernden, wirklich bezaubernden Film mit dem gealterten Mickey Rourke, eine tief märchenhafte Todesfantasie, darin ein Engel eine Rolle spielt, der gar nicht weiß, daß er einer ist, überdies weiblich, was es ja nicht, sagt die Mythologie, gebe, doppelt märchenhaft also. Dann war ich betrunken und ging schlafen.
Heute morgen abermals Wachküche, verhaltene Stille an Achtern, vor dem Überseeclub sind, siehe oben, Osterhühner arrangiert:  Von elf bis eins wird es im Waldorf einen Osterbrunch geben, an dem ich teilnehmen möchte, obwohl ich gestern insgesamt zu viel gegessen, vor allem aber keinen Sport getrieben habe. Die älteren Menschen, soweit gut in Form, spazieren allmorgens den Joggingpfad um den Schornsteinaufbau herum, zehn, manche zwanzig Runden, was etwa fünf Kilometern entspricht. Im übrigen ist der Bordalltag, wenn wir keinen Hafen anlaufen, gleichmäßig, ruhig, und erst abends fängt das Tamtam an; tagsüber wie gehabt: Kurse in kleiner Gestaltung, Vorführungen, wie welches Essen zubereitet wird, Schnitzkunst aus Gemüse, ein bißchen Yoga, Wellness im Schiffsbauch. Völlig anders allerdings das Crew-Leben: strikte Disziplin:: an einem Schiff ist immer etwas zu tun, nach wie vor läuft irgendwer immer mit einem Farbeimer und Pinsel herum, anderwärts werden Planken ersetzt, und die Servicekräfte sind sowieso von morgens bis nachts auf den Beinen.
Ich war denn auch unten im Lebensbereich der Crew. Eng, enge Gänge: die Messen je nach Dienstgrad und Tätigkeitsbereich, Offiziersmesse, Crewmesse, Messe für das Entertainment.  Man hört die Maschinen sehr nahe, überall, quasi allgegenwärtig, im Boden, in den Wänden, den Tischen. Da dieser Bereich sehr tief liegt, das über den Maschinen unterste Deck, gibt es allenfalls Bullaugen, die hinaussehen lassen; aber ist die See nur ein bißchen bewegt, müssen auch sie, aus Sicherheitsgründen, geschlossen werden. So gibt es Tage, an denen die Leute, mag es noch so hell draußen sein, überhaupt kein Tageslicht sehen; sie leben im Dämmern eines gefühllosen Kunstlichts, und die in allen Gesprächen, die ich führte, berüchtigte Crew-Bar ist so sehr verraucht, daß der Geruch überall hängt.  Er kriecht überall hinein, in einen jeden Gang; ich werde einmal nach Mitternacht hineinschauen und mit den Leuten etwas trinken. Beklemmend sowieso, für mich, der Vergleich des Essens. Wir hier oben schwelgen, dort unten sieht es zerpampt aus; einer steckte mir, man bekäme das oben übrigegebliebene Essen vom Vortag. Mag sein, mag auch nicht sein, mag die auch überall sonst herrschende Kantinenklage sein. Sehr verlockend sah, was ich sah, aber wirklich nicht aus. So habe ich nun immer ein kleines schlechtes Gewissen, wenn ich oben speise, aber weiß, was die unten, die hier arbeiten, zu essen bekommen. Sowas krieg ich nie aus Kopf und Herz. (Lächelnd indes, als ich sie auf dem Achterdeck diesbezüglich ansprach, eine der Servicedamen: „Na ja, ich habe Glück. Ich arbeite ja für die Küche und bediene.“ Und zwinkerte pfiffig. ***Gute Töne genommen, immerhin, für das Hörstück, im Schiffsbauch; in den Maschinenraum darf ich aber nach wie vor nicht, allerdings habe ich auch nicht wieder gefragt. Daß der untere Schiffsbereich „Caribik Deck“ genannt ist, entbehrt auch dann nicht eines gewissen Zynismus‘, wenn im Mittelteil die fürs Publikum selbstverständlich zugängliche sogenannte Wellness Oase untergebracht ist. Im übrigen gibt es drei Decks höher, auf dem Promenadendeck, auch zwei Boutiken, vor und achtern des Captain‘s Clubs, eine für (Mode)Schmuck, die andere für Edelklamotten, für zollfreies Einkaufen von „Spirits“ und für sonstigen Nippes. Die Damen darin tun mir immer leid, vor allem in dem Schmucklädchen stehen sie stundenlang allein. Und eine junge Dame der Rezeption, die nun zweidrei Wochen hintereinander Nachtdienst hatte, seufzte: „Weißt du, manchmal unterhalte ich mich dann nur noch mit mir.“ ***
 Nun ist, während ich dies geschrieben habe, die Sonne durchgekommen, wir sehen blauen Himmel. Ich werde den Beitrag jetzt einstellen, bzw. einzustellen versuchen: Die Internetverbindung kostet Nerven. Nicht nur die, aber das ist eigentlich das Schlimmste, alles andere nur Geld. Ich denke an meine ferne Familie, meinen Sohn, immerhin sind wir nun auf demselben Meer. Es ist das erste Mal seit Jahren, ja Jahrzehnten, daß ich ein großes Fest ohne ihn verbringe. Das tut ein bißchen weh. Andererseits habe ich, seit der Atlantik erreicht ist, dauernd das Gefühl, längst wieder in der Heimat zu sein. Dabei werden wir morgen früh erst Namibia erreichen, Walvis Bay, wo ich abermals tauchen möchte; aber auch die Wüste lockt. Dennoch nehme ich auch dort nicht an der angebotenen Exkursion teil. Nicht aus Dünkel, nein, auch nicht, weil mir das Geld knapp wird, sondern der Erfahrung halber, daß mehr als fünf Menschen, die eine Sehenswürdigkeit besichtigen, das, was sie ist, zerstören. Ob sie das wollen oder nicht. Es genügt, daß sie dort sind, daß viele von ihnen dort sind, und auch hierbei schließe ich mich ein. Masse, immer, vernichtet. Deshalb gibt es Orte, die wir schon heute nicht mehr sehen können und auch niemals wieder werden sehen können, nicht nur Orte, auch Bilder, also Gemälde, die Mona Lisa etwa. Dies ist der Grund, weshalb ich bis heute nicht im Louvre gewesen bin und auch nicht hineingehen werde. Mit Bildern und Orten muß man allein sein. Hier, in der Tat, liegt die Macht der Dichtung und auch der Musik, soweit sie nicht Entertainment, also soziales Remmidemmi ist, sondern Kunst, daß sie uns dieses gute Alleinsein immer noch geben kann – sofern nicht dauernd jemand dazwischenquasselt.
Also ich werde dies nun einzustellen versuchen und mich danach umkleiden, heller Anzug, helles Hemd, Krawatte, und wenn ich der einzige bin, der das für den Osterbrunch tut. Ich habe Ostern immer geliebt, hier spür ich aber fast nichts: von der Fruchtbarkeit, die dieses Fest verheißt, nächstem neuen Aufblühen, das mit einer zur Tarnung ironischen Erotik daherkommt: aber sehn Sie den Hasen nur in die Augen! Nicht grundlos sind die Männchen „Rammler“ genannt. Wie nennt man eigentlich die Weibchen?  Sich kleiden: Festlichkeit schaffen. *******
albannikolaiherbst - Sonntag, 20. April 2014, 10:10- Rubrik: Arbeitsjournal
Die Erzählung zur Namib ist fertig, habe seit morgens daran gearbeitet. Aber ich bekomme keine der Fotografien hochgeladen. Probiere es schon seit über einer Stunde.
Schauen Sie am Abend noch einmal nach.
ANH
hier 14.10 Uhr, bei Ihnen 15.10.
albannikolaiherbst - Dienstag, 22. April 2014, 15:08- Rubrik: Arbeitsjournal
 (MS Astor, 21º55‘ S/11º44‘ O.
Obere Terrasse des Achterdecks.
9.22 Uhr, Kurs 285º W/NW.)
Die ganze Nacht über begleiteten uns, im Achterlicht sichtbar, Vögel. Auch wenn wir keines sahen, war das Land doch offenbar nahe. Als ich erwachte, war es diesig wieder, und ein scharfer, kühler Wind wehte von See ununterbrochen auf Land, noch als wir Walvis Bays Hafen erreichten, der eine langgestreckte Contanieranlage ist, aus Siedlungen von Containern besteht, teil fünffach übereinandergestapelten, labyrinthisch, Krananlage, Ölsilos. Wir mußten eine nur schmale, weit in den Atlantik hinausreichende Fahrtrinne nehmen. Flaches Land dahinter, so weit das Auge reicht, und, was ich zwei Stunden später, als ich bereits von Bord war, sehr schnell merkte: sofort die Wüste. Und eine junge wilde Robbe führte im Becken beim Kai ihren Wassertanz vor, um uns zu begrüßen:  Wieder hatten wir einen Feiertag, wiederum waren „bank holidays“, so daß es schwierig wurde, Geld einzutauschen; auch in den Supermärkten ging das nicht oder nur gegen horrende Tauschraten, die dort mit einem zusätzlichen Konsumzwang verbunden werden, dessen Ausgabe mindestens in Höhe von zehn Prozent der Summe sein soll, die umzutauschen man beabsichtigt. Ich nahm ziemlich sofort davon Abstand, dachte, es werde auch mit australischen Dollars gehen. Aber die werden nicht gern genommen. Nahezu überall akzeptiert sind der US-$ und – der Euro. Dieses hat mich auf unserer Reise immer wieder überrascht.
Walvis Bay jedenfalls, der Ort, ist eine die Küste entlanggestreckte flache Siedlung von streng arithmetischer Anlage, die Straßen sind durchnummeriert, 14th Road, 5th Street, locker, sehr trocken, und trotz des noch am Hafen kalten Windes stand bereits um neun Uhr morgens prallend die Sonne vor Museum und Bibliothek, und man mußte den Schädel vor ihr schützen. Zwischenden Nummernstraßen ziehen sich ein paar Avenues entlang, die Heldennamen tragen: Theo ben Ghirab fiel mir auf, diese eigenwillige Mischung der Namensformen, Theo, Sohn des Girabs.  Namibia hat eine, höchst ungute, deutsche Geschichte. Ob ich das German Village sehen wolle, fragte mich mein Taxifahrer, den ich nach dem ersten Rundgang angeheuert hatte, mir die Gegend zu zeigen: zu weitläufig, um zu Fuß zu gehen, oft auch einfach zu öde, vor allem, so mein Empfinden: zu puritanisch, Kirche an Kirche, sogar eine russische gab es:  Ich war überhaupt der erste Passagier an Land. Vereinzelt saßen oder gingen in ihrem typischen schlaksigen Gang, der immer etwas Müdes hat, Schwarze, wirklich nur snbsp;e h r vereinzelt, alles war auf Ruhe gestimmt, die wenigen Weißen, die sich sehen ließen, fuhren Auto. Ob ich das German Village sehen wolle? Nein, antwortete ich Nokumo, nein, ich selbst sei Deutscher, und die Deutschen hätten in Namibia ein furchtbares Massaker veranstaltet. „Lieber die Wüste“, sagte ich. Der gesamte Ort „atmet“ nach wie vor etwas unangenehm Koloniales, etwa dadurch, daß sich nach Süden hin Villen um Villen ziehen, direkt an der Meerespomenade mit Blick auf die Tausenden Flamingos, die dort stolzieren:  Nördlich schließt sich das, sagen wir, Industriegebiet an, zwischen dem und den infrastrukturellen Gebäuden – Tankstellen, dem Magristrat und dem Museum, den Supermärkten, Einzelläden und Game- und Gamblerbuden zuhauf – die Eisenbahnlinie verläuft; einsam, als einziger Personenzug, stand und wartete den ganzen Tag noch der alte leere „Dune Express“:  Unweit aber toste unter wüstem schwarzen Dieselrauch eine Rangierlok, brachte am unabgesperrten, durch nichts außer einer Warntafel, die abher nach einer Werbung aussieht, gesicherten Fahrtübergang den Verkehr zum Erliegen. Später sah ich den Güterzug durch die Wüste fahren, und es sah wie in einer Filmszene von „Laurence of Arabia“ aus: als wäre Zeit hier niemals vergangen.
Selbstverständlich ist sie das, aber man merkt es nur an Kleinigkeiten der Technologie, jedenfalls an diesem, wie geschrieben, abermaligen Ruhetag.
Und nach Norden erstrecken sich, bis die Wüste, die als Klammer um den Ort liegt, wieder beginnt, kleine Häuser und Häuser, einstöckig, kein Slum, aber slumähnlich dadurch, daß kaum etwas der Verschönerung dient, eingezäunt Parzelle mehrerer Häuser für Parzelle mehrerer nächster Häuser, gegen den Sand, in rechteckigen Mengen, nicht Würfeln, Sandstraßen dazwischen, die, wenn der Regen kommt, verrschlammen werden. Aber er kommt selten, der Regen: Walvis Bay ist eine der niederschlagsärmsten Städte der Welt. „Stadt“ mag ich aber gar nicht sagen dazu, sondern es trifft „Zersiedslungsanlage“ den Sachverhalt besser, wenngleich zersiedelt auch nicht wird... ein wenig vielleicht die Küste, an der sich, bis nach Swakopmund, die touristischen Ressorts reihen. Auch sie aber machten einen fast unbelebten Eindruck gegenüber dem an die Wüste gischtenden Meer. Lange weite Strände, hin und wieder standen da Angler, und ich sah, das war am Nachmittag schon, ein paar wenige Kinder baden:  Zwischen diesen auch nur sehr skeptisch den touristischen Valuten entgegendämmernden Ressorts und der Wüste läuft der gut ausgebaute und durchaus belebte Highway. Das sah ich aber nachmittags erst.
Noch geh ich durch die Stadt selbst, Walvis Bay, „schlendern“ zu sagen, wäre falsch, weil es nichts gibt, das zu flanieren verlohnte. Doch war es seelisch aufschlußreich, im Geist die Reise seit Mossel Bay nachzuvollziehen, die Kehre von der mächtigen Fruchtbarkeit Südafrikas, von der märchenhaften Lage Kapstadts in der vorgeschobenen Muschelhälfte der Drakensberge hier herum zur Einöde, zum Mangel von Wasser und dazu nachzuvollziehen, wie Menschen auch dieses besetzen und zu benutzen wissen. Zur Kolonialzeit war Walvis Bay einer der, von Europäern, meistumkämpften Orte des südlichen Afrikas alleine deshalb, weil es noch heute der einzige wirkliche H a f e n Namibias ist und als Stellung, damals, von militärstrategisch ganz besonderer Bedeutung. Auch das merkt man dem Ort noch an: als Brückenkopf besatzt – doch dieses viel weniger gegen andere Nationen, also gegen die Interessen anderer Menschen, als vielmehr gegen die Wüste selbst. Ich habe noch keinen Ort der Welt gesehen, der mir weniger natürlich vorgekommen wäre, eine gegen die Wüste realisierte „reine“ Rißbrettzeichnung, vollkommen, aber seelenlos, artifiziell. Wer an Oasen denkt, liegt falsch. Hier ist kein Raum für Legenden. Wilhelmshaven, allenfalls, fällt mir ein.  So ging ich sehr bald zum Schiff zurück, über die Geleise, vorher am wie verwaisten Personenbahnhof entlang; das belebteste waren die Containertürme:  Container kasernen sind es, zwischen denen schwere Laster operieren und mächtige fahrbahre Kräne. ***Als ich am Haupteingang zum Hafen zurückwar, der ringsum von Mauern und Lattenzäunen geschützt wird, hatten Nippeshändler dort ihre Waren ausgebreitet, auf festen blauen Ölzeugsplanen: afrikanisches Schnitzwerk, das ganz das gleiche wie in Kapstadt, wie überall auf der Welt, teils in China hergestellt für den Bedarf des Afrikatouristen, ganz weniges wirklich von Hand gefertigt, wonach ich immer schaue. Auch diesmal wurde ich fündig, handelte, handelte.
Für den Nachmittag war ich mit der Crew verabredet, für die in der Wüste eine Quad-Tour gebucht worden war: vierrädrige ein- bis zweisitzige Motorräder, die sehr breite, dem Sand angepaßte Reifen haben. Sam hatte gefragt, ob ich nicht mitkommen wolle, aber man müsse erst die Genehmigung einholen. Sie wurde erst verweigert. Versicherungstechnische Gründe, schon deshalb, weil Quadfahren als Risikosport gilt, es wohl auch sein kann. So hatte ich mir nachts den Exkursionsleiter persönlich zur Seite genommen und immerhin bewirkt, daß man mich im Bus mitnehmen werde; vor Ort allerdings müsse ich meinen Deal mit den Quad-Veranstaltern persönlich, für mich alleine, besiegeln. Das wollte ich wohl tun.
Als ich nun am Schiff zurückwar, hatte wiederum der namibische Verranstaltet ein no gut gesprochen, das abermals unterlaufen werden mußte. Ich war mir sicher, es würde gelingen, kostete auch bloß dreivier Sätze. Er sah mich an, nickte, okay, we‘ll give you the rite. Treffen um halb zwei, Viertel nach eins, sowas ungefähr. Mir blieben noch paar Stunden.
Also abermals kehrtgemacht, zurück zum Portal, mir einen Taxifahrer geschnappt, was er haben wolle für anderthalb Stunden Rundfahrt. Zeig mir, was du meinst, daß ich es sehen müsse. Das waren, zum Beispiel, die Flamingos, war aber auch eine der welthöchsten Dünen, ein paar Kilometer landeinwärts, Dune 7 genannt, vor der malerisch, Laurence of Arabia, der Güterzug dampfte rauchte spuckte, wie um der Kamera ein historisches Bild aus den arabischen Befreiungskämpfen zu bieten. Man kann sagen, der Zug habe im Fahren posiert.
Meine erste wirkliche Begegnung mit der Wüste.  Dune 7 ist an die dreihundert Meter hoch und zieht sich wie ein scheinbar erstarrter Zunami weit dahin: man kann sie ersteigen. Drunten provisorische Anlagen zur Touristenbewirtung. Es war voll, als wir ankamen, unter anderem stand die Hälfe der Astor-Passagiere herum und fotografierte. Zu viele Menschen, wenn ich etwas sehen möchte, nehmen mir immer die Lust daran, man sieht ja nicht mehr, um was es geht, sondern die Menschen, die es auch nicht sehen. Also blieben wir nicht lange, Nokumo und ich, aber ich steckte meine Hand in den Sand, entsann mich sofort, unbeabsichtigt, eines weiteren Films, nämlich Ridley Scotts Gladiators, der vor jeder Schlacht, in die er zieht, Erde vom Boden in die Hand nimmt und zwischen seinen Fingern hindurchrinnen läßt: zu wissen, aus was man ist und f ü r was. Die Erde als Gebet.  Ich hatte zu wenig getrunken für die Hitze, viel zu wenig, mochte aber nicht trinken, weil El ‘Aurence wieder da war, als Sharif ihm die, ich glaube: lederne, Wasserflasche reicht, und er, O‘Toole, den Araber fragt „Und du?“, der dann antwortet „ich muß noch nicht trinken“, worauf El ‘Aurence nun erwidert: „Dann muß auch ich es nicht.“ Ich verehre diesen Film so sehr, weil ich keinen zweiten kenne, der auf nur annähernd poetische Weise von Willenskraft erzählt. Und sie in ihrem Tiefsten so erfaßt. (Zuvor, im Casino, nach der Kerzennummer, fragt ihn jemand, was der Trick daran sei. El ‘Aurence: „Daß es keiner ist.“ Lawrence hat in Arabien gesucht, was Munthe auf Capri zu finden hoffte und einige Zeit lang auch fand: Unverstelltheit. Und soeben erst begreife ich, daß sie Zeitgenossen waren.) 
*****Als ich der Löwin während einer unserer verbindungstechnisch oft problematischen Skype-Gespräche (Facetime funktioniert g a r nicht über Staellit) von meinem Quad-Vorhaben erzählt, hatte sie ziemlich lakonisch erwidert: „Das wird aber ziemlich laut werden.“ Was ich auch wußte, aber in kauf nehmen wollte, weil mir auch dies, Wüsten zum Rummelplatz zu machen, wie eine menschliche, wohl auch menschengemäße Besiedlungsstrategie vorkommt, deren in schlechtem, weil nicht erotischem Sinn perverser Reiz darin besteht, schlichtweg durch Leugnung – und Selbstermächtigung qua Training und Technologie – die Gefahren zu bannen, die ganz objektiv, und für die allermeisten hier lebenden Menschen, bestehen. Wir springen einfach über sie hinweg und nehmen sie als einen Jux, den man sich macht, auch und gerade dann, wenn das zugleich existierende Elend so offensichtlich ist, und der ständige Überlebenskampf. Es steckt eine enorme Kraft in dieser Haltung, auch wenn sie moralisch höchst zweifelhaft ist. Jedenfalls wollte ich mitmachen, Teil des Rausches sein, der nur im oberflächlichen Teil einer der Geschwindigkeiten ist. Grundtrieb ist Überhebung. So stoßen wir, oder haben es getan, oder werden es wieder tun, ins lebensfeindlichste All vor. Daß wir den Mars besiedeln werden eines Tages, daran besteht nicht der geringste Zweifel; es muß nur erst die Notwendigkeit groß genug sein.
Dennoch. Ich sprang also mit in einen der kleinen zähen Busse, hinter mir auf der Rückbank hatten sich die schöne Pianistin und mein Freund Sam zu einem Paar gefunden; wann es geschah, das weiß ich nicht, doch neben einer ganz leichten Melancholie durchzog mich das mächtige Empfinden von Schönheit, und von Wahrheit, und von etwas, das so sein muß. So daß das Melancholische seinerseits sehr schön wurde, wie ein Geschmack von Süße, den die Augen wahrnehmen können, und wie Süße auf unseren Zungen wird, nur daß man sie eben sah und nicht schmeckte. Explore the desert:  Und wie brausten dahin, immer am Meer lang, das links von uns lag, die Ressorts passierend, dann wieder Hüttensiedlungen passierend, rechts die weite flache gelbe, nur am Fahrbahnrand von fleckigem Grün durchsetzte Wüste. Es ging nach Swakopmund, aber nicht hinein, sondern vor der südlichden Einfahrt, gegenüber einer Touristensiedlung, liegt rechts zur Wüste hin ein abgegrenztes Areal, Büro mit kolonialer, ziemlich großer Sitzgruppe, vierzig Leute haben da vor den beiden Fernsehbildschirmen Platz, hinter einer ums Eck geführten Theke wird gebucht, dann eine kioskähnliche Bar hinter Querbänken unter einer seitlich glasgeschützten, oben überdachten und von zwei lebhaften Aras unterhaltenen sandbodenen Terrasse, wobei die Papageien in die Namibia nicht wirklich gehören, nicht einmal auf diesen Kontinent.
Aber die Kamele gehören dort hin, die außen neben den Quad-Hangars am Boden lagen  So entschied ich mich spontan um, war der einzige. Nicht mit den Motorrädern in die Wüste fahren, nein: Was kostet eine Stunde Ausritt? Lawrence hat mich bis in die Tiefen geprägt, es wird Zeit, daß ich sein Buch, Die sieben Säulen der Weisheit, endlich vollständig lese, und bedaure es ein wenig, es nun nicht mit dabeizuhaben. Es wäre vielleicht ein wiedernächstes Hörstück, das sich darüber schreiben ließe. Aber nein, Leans Film ist zu nah -
Indessen nun die anderen, neununddreißig insgesamt, zum Hangar abzogen, sich behelmen ließen – unter die Helme werden dünne weiße Tafthauben über die Köpfe gezogen –, ihre Gefährte zugewiesen und eine kurze Einführung bekamen, bevor sie dann in krawallender Gänsefahrt in die Wüste zogen, hatte ich meinen Biglietto für den Ausritt erstanden. Mir voraus ritt ein schmaler dunkler Mann, der mir, bevor ich aufsaß, beide Kamele, seines und das nun meine, mit Namen vorstellte, mir zeigte, wie das Tier zu lenken usw., schon hatte ich auf der Art Sattel Platz genommen, die nicht direkt dem Tier aufliegt, sondern ein doppelter, über den Polstern gerüstartiger Aufbau überm Höcker ist – es waren Dormedare -; der hintere dient als Sitz, und es ging, zuerst mit den HInterbeinen, in die Höhe, schwankte enorm, ich stemmte mich in die Steigbügel, beobachtet dann, wie mein Führer jede Bewegung in seinem Körper vorausnahm, versuchte es meinerseits. Es wäre gut gewesen, eine Tasche dabeizuhaben; so mußte ich ständig auf Portomonnaie, Ifönchen, meine eCigarillos undsoweiter achten, was besonders dann schwierig wurde, als wir zu traben begannen: über die Dünben dahin, in die Senken, wieder hinauf, man denkt, wir gehen in die Knie, aber können uns auf den federnden Tritt des Tieres verlassen, müssen nur Vertrauen gewinnen:  „Wenn du willst, reiten wir schnell“, sagte mein Führer und gab auch schon mit Schnalzlauten Zeichen und mit der Gerte, einer rohen selbstgeschnittenen; auch ich hatte eine, und sie lag gut in der Hand: vertraut, wenn auch ganz woanders her. Doch es war eine Nähe. Man schlägt, um zu weisen, es geht nicht um zuzufügenden Schmerz. Hochgradig erotisch, dieser Ritt, und scharf der Wind. Ich hatte unterschätzt, wie kalt es werden kann. Das machte aber nichts. Ich bin nicht aus Zucker und auch nicht aus Sand wie die Wüste, bin keine Düne, die zerwehen kann.
Die Klänge aber des Windes! Und wie sah, jede Verwehung, Meeresböden gleich – ich weiß, schon Hunderte vor mir haben das beschrieben. Wellen, Wogen, aber solche nicht aus Wasser, sondern aus quasi-geologischer Zeit. Tiefer hinein, dachte ich, tiefer, noch tiefer. Doch mußten bereits wenden, wollten wir rechtzeitig zurück sein. Mein Führer ließ es sich nicht nehmen, von mir Bilder zu machen, und ich, eitel vor Glück, ließ es ihn tun. 
******* Und nun sind wir wieder auf See:
(22. April, 11.45 Uhr.
Achterdeck ff.)
Es war mir nicht leicht, Afrika schon wieder zu verlassen. Es war mir schwer.
Einmal, im Dunklen, ging ich noch hinaus, um nach der Küste, ihren letzten Lichtern, zu sehen. Hielt es nicht lange aus. Nahm meinen Whisky mit auf die Kabine, nachdem ich noch ein wenig der schönen Pianistin und der Geigerin zugehört hatte; nein, um zehn, nachdem ich weiter in Henry James‘ grandiosen Erzählungen gelesen hatte, eigentlich schon ziemlich betrunken war, bin ich doch noch mal hinaus, aber nur in den Captain‘s Club zum letzten, dieses Tages, Vorspiel des Duos, nicht, weil mir wirklich danach gewesen wäre, sondern weil ich mochte, daß sie merkten, es komme mir auf die Musik an, nicht auf eine eigentlich andere, sagen wir, Absicht hinter.meinem Interesse; dann doch noch mal an Deck, kein Afrika mehr, wieder unter Deck, kein Afrika mehr, einen Film angucken: schön, wie er musikalische Entwicklung – zu wissen, was sie ist, die Musik – an das sexuelle Erwachen geknüpft hat, auch wenn der deutsche Filmtitel mal wieder völlig idiotisch war: „Süßes Verlangen“. Man sollte diese Titler kastrieren. - Ach, ich war es zufrieden, war müde, betrunken, aber so, daß man schweifend immerzu denkt, und daß ich heute morgen erwachte und nichts als Grau sah, bedeckten Himmel mal wieder, kein Vorschein von Sonne, schon gar nicht, daß wir uns dem Äquator wieder nähern, machte mir kaum etwas aus. „Reichtum“, dachte ich. Rechts unter mir wird ein Barbecue bereitet, ich sollte aber Sport machen, doch da war so ein Chat mit der Löwin in Skype, der in mir gnadenlos erregend rumort. Und daß gestern genau die Hälfte der Reise vorüber... erst die Hälfte, könnten Sie sagen, aber die Erfahrung lehrt, daß mit zunehmendem Alter die Tage immer kürzer werden. So ist es mit Entfernungen auch. Und das Frappierendste auf dieser Reise ist mir der Eindruck nicht, wie groß die Welt sei, sondern: wie k l e i n. Schon jetzt bin ich ein Viertel um sie rum, und nicht auf grader Linie:  John ist zurück, der in Duban das Schiff verließ, um dort eine Nacht zuzubringen, dann zu Freunden nach Johannesburg weiterzureisen – oder zu „Geschäften“, wie meine Fantasie erzählt – , von wo aus er dann das Flugzeug nach Walvis Bay genommen, um zu uns an Bord zurückzugelangen; es habe alles, für afrikanische Verhältnisse, geradezu elegant geklappt, erzählt er. Und dem, was ich mir für Gregor Lanmeister vorgestellt habe und weiterhin vorstelle, am nächsten kommt unser „Clochard“, der das Schiff tatsächlich niemals verläßt, nicht für einen einzigen Landgang, sondern immer in einer seiner Ecken sitzt und Kreuzworträtsel löst:  Die würde Lanmeister selbstverständlich n i c h t lösen wollen, sondern der – denkt nur und denkt. Wir können gar nicht sagen, ob auch Erinnerungen darin sind. Auch bekäme er ganz sicher nicht allabendlich eine Flasche Wein hingestellt, der irgend jemand an Bord unterdessen ein Kleid gestrickt hat, das wie ein Präservativ über sie gezogen wird, über die „Lady Astor“, wie diese allabendliche Flasche unterdessen benamst ist.
Barbecue. Hamburgers. Vielleicht sollte ich davon versuchen. Für unsere Prinzipien gilt dasselbe wie für Regeln ( regulations) und Gesetze: Wir brauchen sie, aber auch, sie zu übertreten – nicht nur, das zu können, sondern auch, es zu t u n. Verlieren wir diese Fähigkeit und ihren Willen, haben wir auch das Leben verloren: seine Freiheit. (Sowieso hab ich noch gar nichts gefrühstückt).
Schreiben und Meer.  (18.37 Uhr.)Mich rasiert, geduscht, gekleidet, die Krawatte gebunden, dann an meinem Steh- und Nachsinnplatz mit diesem Blick den Abendcigarillo geraucht und dazu als ersten Abenddrink einen Negroni getrunken: 
(Negroni, wenn keine Sonne scheint; scheint sie, dann Campari Soda, bevor ich später zum Whisky übergehe.)Die meisten anderen sind nun zum Dinner gegangen, das ich heute ausfallen lassen werde, zum einen, weil ich nicht im Training war, zum anderen, weil ich nachmittags auch noch von den Süßigkeiten des afternoon teas nahm. Ich will die vergleichsweise Leere nun nutzen, um vielleicht doch noch diesen Beitrag in Die Dschungel zu bekommen, was über den Tag bisher völlig unmöglich war. Ich >>>> schrieb es Ihnen ja, bekam aber auch diese doch nur kurze Mitteilung weder in Twitter noch gar Facebook hinein und auch keinen Zugriff auf meine Emails. Man sitzt dann fast stundenlang da un probiert und probiert, und die fürs Internet gekaufte Zeit tickt und trickt, und aber nichts gelingt.
Als ich es wieder einmal aufgab, hinaus, mit Henry James‘s Erzählungen, die mich sprachlos machen vor Feinheit und Genauigkeit und Hinterhältigkeit. Welch ein Meister, der uns bis ganz zuletzt in der Ambivalenz hält: „Die Lehre des Meisters“, worin der Konkurrenzkampf eines alten Dichters mit einem jungen um eine schöne Frau, viel zu jung für den Alten, erzählt wird, den der Alte gewinnt, aber, so kann man meinen, indem er den Jungen mit Wahrheit austrickst oder vielleicht gar nicht austrickst, sondern ihm wirklich den richtigen Rat gibt. Es bleibt rein an uns zu entscheiden, was wir schließlich glauben. In jederlei mögliche Richtung sind Spuren gelegt, die alle zu wahren Antworten führen, solchen indes, die sich in ihrer Richtung völlig widersprechen. Und James erzählt das in einer so ausgehorchten Sprache, daß schließlich selbst das Ironische wie ein Schicksal daherkommt, das alles andre als ironisch ist:<BR „Wenn Sie kein Ziel haben, nicht durchhalten wollen, dann ist das Ihr gutes Recht; es geht niemanden etwas an, niemand kann Sie dazu zwingen, und kaum mehr als ein paar Leute werden überhaupt merken, daß Sie Haken schlagen. Die andern, der ganze Rest, jede einzelne Menschenseele in England wird glauben, Sie strebten nach vorne, Sie hielten durch – auf Ehre, bestimmt! Ich werde einer von den wenigen sein, die es besser wissen. Es ist nur die Frage, ob Sie sich wegen dieser wenigen derart ins Zeug legen wollen. Sind Sie aus solchem Stoff gemacht?“Es ist dies in der Tat die künstlerische Frage an die empirische Person. Andererseits dient aber eben ihre Antwort, jazusagen nämlich, dem alten versagenden Dichter dazu, sein eigenes Ziel zu erreichen: die Hand der jungen Frau, auf die der Junge nun verzichtet. Meine Achtung vor dieser Erzählkunst ist ungeheuer, und so gerne ich vorher Ian McDonald las, so schal welkt er meiner Erinnerung nunmehr dahin. ********* albannikolaiherbst - Mittwoch, 23. April 2014, 16:08- Rubrik: Arbeitsjournal
 (MS Astor, 8-03 Uhr: 17º45‘ S/0º19‘ W.
Obere Terrasse des Achterdecks.
Kurs 265º W.)
Nun sind wir bereits wider den dritten Tag auf dem Meer, dem Atlantik, direkt auf St. Helena zu, eine Insel, die, abgesehen von Bonapartes Lebensende, insofern eine heitere Geschichte hat, als sie lange Zeit geheimgehalten wurde, ein bißchen umstritten zwischen den Niederlanden und England; man wollte einen guten Stützpunkt haben, aber ausschlaggbend war die Insel dann doch nie und floß schließlich ins Commonwealth ein. Eine für letztlich nichts Geheime Staatssache, sozusagen, was mich nun wieder an den „Skandal“ erinnert, den ich ganz offensichtlich dadurch ausgelöst habe, daß ich vorgestern nacht in der Crew-Bar aufgetaucht bin dort herzlich begrüßt, sehr herzlich, von denen, die zugegen waren. Ich trank einen Jim Beam und einen Gin Tonic, um 1.30 Uhr schlägt die Glocke in dem völlig verrauchten Raum, dem einzigen, den die Besatzung hat, um überdacht zu rauchen. Am Morgen drauf, also gestern, ging es dann rund. Jemand hatte sich beschwert, daß ein Passagier dort unten war, das darf niemals geschehen undsoweiter, die Sache ging zum Kapitän, der ebenfalls schwer verärgert sei, wie mir hoch bedeutungsvoll, mahnend, mit fast Strafblick, auf den ich mit purem Lachen reagierte, eigens noch einmal bedeutet wurde. Man tut so, als wäre dort unten etwas zu sehen, in das Uneingeweihte nicht blicken dürfen, aber dahinter steht nichts als eine zum Fetisch gewordene, der Disziplinierungen halber, Hierarchie. Reisende und Besatzung sollen aufs strengste getrennt bleiben. Dabei hatte ich längst vorher drüber gesprochen, daß ich die Bar sehen wolle, wenn sie belebt sei, also nachts, wenn die abgekämpften Mädels und Jungs sich erholten, täglich zehn bis zwölf Stunden Dienst sind normal. Nun wird in Teneriffa, wurde mir ebenfalls mahnend erklärt, jemand von der Company dazusteigen, um mit mir ein, nun ja, „ernstes“ Gespräch zu führen; ich ließe doch wohl nicht heimlich Mikrophone aufnehmen usw. Zuvor hatte es sogar, wegen des „Vorfalls“ eine eigene Krisensitzung gegeben, Kapitän, Staff-Captain, Hoteldirektor, Servicedirektor, alles, weil ich nachts an der Crewbar gesessen und geplaudert hatte, ein echter Weltuntergang im Wasserglas; zumal war ich, als ich dort unten erschien, mit großem Hallo! begrüßt worden, wir hatten mehrmals das Glas aneinandergestoßen, Hände warfen sich ineinander. Was also sollte ich nicht sehen? Daß es auch Pärchen in der Crew gibt, umschlungen, wenige freilich, in ihrer Bar? Es geht ins Herz, das zu sehen, wie sich auch aus der strikten Hierarchie das Leben sein Recht nimmt, und seine Lust, sein Bedürfnis nach Nähe und Körper.
Was aber an dem „Skandal“, ergo, i n s g e s a m t irritiert, ist, daß ich nicht der einzige bin, sondern sehr wohl von sehr vielen Passagieren ein Bedürfnis danach besteht, die Besatzung zu kennen und menschlich mit ihr zu sein, miteinander umzugehen, aber es darf nichts vermischt werden. Besonders absurd daran ist nun, daß die beiden Getränke, die ich unten hatte, nicht nach Kantinenpreisen bezahlt werden dürfen, sondern nach den höheren Preisen für Passagiere; das ist aber nicht das eigentlich Absurde, sondern daß man jetzt nicht weiß, wie rein technisch verbucht werden soll. Es sind zwei unterschiedliche Abrechnungssysteme, und es gebe, heißt es, keine Brücke vom einen ins andre. Auf welche Eröffnung ich abermals nur lachen konnte: „Na, dann rechnen wir das halt über X oder Y ab, und ich gebe ihm/ihr das Geld dann in bar.“ Das schien als ein nun ganz besonders blasphemischer Vorschlag anzukommen. Immerhin gilt wie überall auch hier, daß Heiterkeit unschlagbar ist, und die meine war gestern ziemlich hell.
Ich hatte nämlich ein Analogon zu Stevensons berühmtem Apfelfaß gefunden; da ich niemandem schaden will, heb ich‘s mir für den Roman auf und berichte hier und auch im Hörstück davon nichts. Aber wir sahen, einander nahe, die Sterne. Lanmeister beobachtet das, wenn er nachts, da er oft schlaflos ist, an Bord herumgeht, wandelt, ganz mit seinen Gedanken für sich. Denn auch er merkt selbstverständlich, daß hier, fast unter Ausschluß der See, über See gefahren wird als ein Organismus, der aus zwei strikt getrennten Organismen besteht, deren einer aber den anderen nährt, wofür der andere vorher bezahlt hat. Hegel, Herr & Knecht: Dialektik der Interdependenzen. Also Lanmeister beobachtet die huschenden Gestalten, wie sie aufwärts und aufwärts steigen, himmelentgegen, Firmament und Meer längst eines, darinnen abgekapselt wir.
Dieses beseite, wird mir Lanmeister immer rätselhafter. Was will er hier? Am St.George‘s Day, gestern, wurden am Achterdeck Kinderspiele gespielt, ein riesiger Regreß, in den beglückt wie Kinder, die umsorgt sind, die Passagiere glitten. Nicht alle, nein, aber viele. Er wird offenbar als erholsam erlebt. Es war wirklich wie ein Kindergeburtstag; ich dachte, man müsse jetzt nur noch Topfschlagen spielen.  Abseits allerdings die ernsteren Charaktere; auch von denen gibt es einige, nicht nur in „meiner“ Abenteurergruppe: hier finden sich die Typen, solche, die Schicksale haben jenseits der Banalität oder die sie ganz plötzlich haben, die über sie hereingefallen sind, wie das von, ich nenne ihn einmal, Will, dessen Frau im Dezember verstarb, „nach fünfundvierzig Ehejahren“, der Mann weinte, als er‘s erzählte, nach innen. Um uns das Meer und das ewige gleichmäßige Raunen der Maschinen. „Nun suche ich in mir den jungen Mann, der ich war.“ Er ist nie mehr zu vergessen, dieser Satz, in seiner ganzen schweren Bescheidenheit. Für Will nimmt diese Fahrt Abschied. Wahrscheinlich ist er derjenige, der Lanmeister am nächsten kommt, ein völlig anderer, in seiner Erscheinung, Typos freilich, nicht im entferntesten von dessen längst gelebter Distanz, ein Mann des freundlichst Sozialen, der Konversation und kleinen Freuden.
Lanmeister, aber, was will er, ich frag es noch einmal, hier? Er sucht nach Klarheit, nähert sich ihr, und das ist das Gegenteil von Regreß. Utopie und Realität vertragen sich nicht; zwischen ihnen steht, als von Normen streng bewachte Grenze, das Bedürfnis nach Banalität. Ich werde, für den Roman, das gesamte Schiff umschreiben müssen. Auch deshalb hat sich meine Idee, den Text direkt an Bord zu verfassen, unterdessen als illusorisch herausgestellt; selbst unter anderen Umständen wäre es gar nicht möglich. Vielmehr muß Lanmeisters Schiff ein wirkliches Traumschiff sein. Ich kann hier nur aus dem, was mir begegnet, das, was ich brauchen werde, herausfiltern, kann es schon einmal klären, so, wie man Gold aus Bächen wäscht, mehr nicht. Es bleibt freilich genug, meine wichtigsten Charactere sind beisammen. Und das Hörstück wird ein anderes werden, das wird erzählen von dem realen Schiff, so, wie es aber auch projektiert war.
Erschwerend kommt hinzu, was sich vielleicht nun doch als Fehler erweist, daß ich versuche, täglich in Der Dschungel zu erzählen, aber durch die katastrophale Internetverbindung Stunden damit zubringe, irgendwie Bilder hochzuladen. Ich habe mir die Isolation der Seele, die der Rman braucht, selbst durchgestrichen, bin nervös und genervt, wenn wieder einmal nix funktioniert, obwohl ich stundenlang dransaß; vor allem aber habe ich die eigentlich erstrebte und für mein Romanvorhaben so nötige Trennung vom deutschen Literaturbetrieb nicht vollzogen, sondern bin an ihn gebunden geblieben. Was bisweilen zu erneuten Frustrationen führt, Ärger, haltender Kränkung – zu allem mithin, was ich für Gregor Lanmeister wirklich nicht gebrauchen kann. Zwischen ihm und mir steht nun nach wie vor mein Wille. Der aber hat im Roman nichts zu suchen. ***Was ich im Apfelfaß hörte.****(8.55 Uhr.)
Wir nähern uns fühlbar dem Äquator, es ist wieder warm geworden und trotz der bisweiligen Wolkendecke, die uns gestern gegen abend sogar geschlossen bedeckte, die Zeit der frischen, ja kalten Morgen- und Abendwinde vorbei. Nur noch aus Gewohnheit ziehe ich zu meinem ersten Frühgang, der unmittelbar an die Kaffeestation führt, noch einen Pullover an und ziehe ihn gleich wieder aus: unter Deck ist es, der Klimaanlage wegen, sehr viel kühler; Klimaanlagen entfernten einen von der Welt, schließen einen ab, man verliert den Instinkt für die wirkliche Witterung. Auch dies ist, ob im „guten“ oder „schlechten“, auf einem Kreuzfahrer besonders zu spüren. Das Bedürfnis nach Commodität, letztlich, entfremdet. Meine Abenteurer wissen das, sie sitzen allezeit im Grüppchen beisammen, unteres Rauchereck, sehr früh morgens sieht man allerdings den zurückgekehrten John allein für sich an der Reling, sinnierend, dann geht er zum nächsten Meditationspunkt, immer mit Blick auf die See.
Eine sehr alte Frau, Raucherin auch sie, hager, wissend, hat sich der Gruppe angeschlossen, wird von ihr, die Gehbehinderte, aufmerksam und still umsorgt; sie erzählt Geschichten. Der Flugängstler ist quasi jeden Abend betrunken, aber auf eine Weise, die sein persönliches Unglück zu einem großen Spaß macht, über den er flucht: Ich muß etwas erleben, ich muß etwas erleben! Ein kräftiger, sehr durchtrainierter Mann von um die dreißig, vielleicht fünfunddreißig; bevor er zu trinken beginnt, trainiert er hart im Fitneßraum, mächtige Schultern, Oberarme wie Reifen von Trucks, der Rücken eines Profiboxers, kein Gramm Fett, die Seele aber Teddy. Ungeheuer freundlich, offen, vorbehaltlos. Gestern vesuchte er, mich von meinem Henry James wegzuziehen, damit ich mit ihnen, ihm und paar anderen, spielte. Das sind die Momente, in denen ich meine Fremdheit wieder spüre, mich ihrer aber schäme, weil ich vorbehaltlos nie sein kann, oder nur in ganz seltenen Fällen. Daß man ein Dichter ist und dieses immer Distanz bedeutet, vermag ich allein in der Musik zu überspringen, und im Sex.
Hört Lanmeister Musik? Eher nicht. Und für den Rausch der Körper ist er nicht mehr gemacht. Er besteht von Kopf bis Fuß aus Abschied, er ist der Abschied, als Person. Man hat sehr oft den Tod als Person dargestellt, durch alle Jahrhunderte hin und alle Kulturen; Lanmeister aber ist ein Übergang dahin, einer, der sich festgestellt hat und selbst zum Bild wird. So denke ich ihn mir. An sich müßte er auch die Unterschiede der Geschlechter in sich aufheben, aber ich weiß nicht, ob mir so etwas gelingen kann; indessen ich doch, als ich die Reise plante, nur mit Lanmeisters Augen sehen, mit seinen Ohren hören, seiner Nase riechen wollte, drängt sich in der Wirklichkeit das Wollen immer vor, und das ist sexuell und in meinem Fall dezidiert männlich. Die Faszination, die das Androgyne auf viele Menschen ausübt, hat mich niemals berührt; als ich Ian McDonalds Cyberabad las, das von dieser Faszination mitgeprägt ist, wurde mir das wieder einmal überaus deutlich. Ich kann sie abstrakt nachvollziehen, theoretisch, aber spüre das Sinnliche nicht daran, das es doch offenbar hat, so, wie ich nicht begabt bin, die hohen Ortungslaute von Fledermäusen zu hören, so, wie ich im ultravioletten Bereich des Lichtspektrums nicht sehen kann.
Kann es Lanmeister? Geht in ihm das Sichtbare ins Unsichtbare über, und wenn, weiß er das? Es gibt Fragen, die nur und erst der-Roman-selbst mir und Ihnen beantworten kann.  Ich hatte n o c h eine Idee: Die >>> Casa Verdi auf einem Schiff. Denn es treffen sich frühnachmittags einige Leute im Captain‘s Club, um zu singen, angeleitet von einer jungen Dame der Entertainment-Crew, begleitet von Kateryna am Klavier; ich habe eine sehr schöne Aufnahme davon. Und überhaupt wird bisweilen gesungen, auch schon mal mit dem leichten Haut gout des Gegröls; meisterhaft sind die Abenteurer darin. Beim Karaoke kam man zu englischen Nationalhymne zusammen, wobei man nicht zusammen kam. Ich stand dabei, schnitt mit, und dann, ganz spontan, dirigierte ichein bißchen, worauf dann gleich nachher Glenn: „It‘s like 1944, Englishmen singing, conducted by a German.“ - Bittrer Scherz, der mir einmal kurz durch den Bauch fuhr. Er war nicht böse gemeint, überhaupt nicht, aber zeigt, wie Verletzungen noch nach zweidrei Generationen weiterwirken, sich wie ein Gen verkapselt haben, das als solch ein Satz unerwartet aufplatzt, kurz auf-, dann davonweht. Aus Geschichtserfahrung und Kränkung sozialisierte Gene als Viren. Sie hinterlassen eine Geruchsspur, die sich nie mehr ganz verliert.  Das Schiff leiht dem Roman nichts als seine Gestalt. Ich darf auf keinen Fall vergessen, daß die messingnen Handläufe der Passagieraufgänge nicht goldfarben, sondern silbrig sind. Darf nicht die Kotztüten vergessen, die, nunmehr nur noch sporadisch, hinter diese Läufe geklemmt sind. Und in der kleinen, von Svarowskis Kitsch mit Banalität geschändeten Juwelenboutique sitzt tagaus tagein eine schöne, wahnsinnig blasse junge Frau und wartet auf Kundschaft. Meist ist sie allein, ganz allein. Ich weiß nicht, ob sie auf dieser Reise auch nur ein einziges Mal das Tageslicht gesehen hat. Ich sprech sie seit dreivier Tagen öfter an, schau bei ihr hinein, aber nachdem ich nun erfuhr, wir rigide die Apartheit - so muß ich das nennen, ja: Apartheit - ist an Bord, ist ein näherer Kontakt völlig ausgeschlossen. Die Verkäuferinnen der Boutiquen, hab ich den Eindruck, haben noch einmal ein anderes Leben, verkapselt für sich. Werden die Lädchen geschlossen, gehen die Damen im Grüppchen hinab und sind nicht mehr gesehen.
Was ich, ich les es soeben im Notizbücherl, für >>>> Kapstadt zu erzählen vergaß: Kommt man am Hafen an, riecht alles, alles nach Fisch. Das ist nur dort so gewesen. Und scheint Jahre bereits zurückzuliege. Raum wird zu Zeit. Wir schwimmen Ihnen jetzt – heute nacht waren abermals die Uhren um eine Stunde zurückzustellen – einhundertzwanzig Minuten voraus. Wenn ich mich auf die Zeit zu konzentrieren versuche, merke ich, wie sehr sie mir entglitten ist; ihre Einteilung, die Norm ihrer Einteilung, wurde beliebig. So, als wäre sie Illusion-selbst.  Der einfache, ruhige Tag hat begonnen, die ersten Drinks gehen über Deck. Die Abenteurer sitzen in ihrer Ecke, auf den Liegestühlen wird gelesen, man trägt Schirmkappen und seltsame Mützen, bisweilen steigt jemand in den brühwarmen Pool. Kellnerinnen und Kellner huschen, unten im Schiffsbauch wird gebacken: Brot für den Mittag, Brot für den Abend, Brötchen, Kuchen für den afternoon‘s tea; gestern mittag gab es Fish ‘n Chips, unter andrem, die Offiziere schauen in weißen Uniformen. Neue Planken werden eingezogen, das tiefe Brummgröl einer elektischen Schleifmaschine dröhnt in die Schlagermusik. Und auch auf Deck 9 wird gemalt und gewerkt: Ein Schiff ist ein über Tage, ja Wochen autarkes System. Es fährt über eine bewegte riesige Oberfläche, unter der eine andere Welt. Wäre sie, wenn es nicht stürmt, nicht so diskret, man spürte das Geheimnis.  albannikolaiherbst - Donnerstag, 24. April 2014, 12:58- Rubrik: Arbeitsjournal
 (Wir langen soeben an, der Lotse kam an Bord. Die Erzählung dieses Tages folgt.)
albannikolaiherbst - Freitag, 25. April 2014, 19:10- Rubrik: Arbeitsjournal
(9.16 Uhr, i.e. 11.16 Uhr Ihrer Zeit.
MS Astor, oberes Achterdeck.
12º30‘ S/9º30‘ W.
Kurs 353º N.)
Wir nähern uns dem Äquator, und es ist endlich, und zwar „wirklich“, warm geworden: Keine Rede mehr von Pullovern und Schals am Abend, geschweige denn Morgen. Ich mag auch nicht mehr in der Kabine tippen, auch wenn draußen das Licht so hell ist, daß ich die Augen zusammenpetzen muß, um auf dem Bildschirm etwas zu erkennen. Ich schreibe darüber hinaus auch nicht, wie eigentlich vorgehabt und worauf ich mich mit entsprechendem Equipment vorbereitet hatte, am Ipättchen, sondern am Laptop, weil dessen Bildschirm matt ist, was unter der Sonne die Erkennbarkeit nicht ganz zu kompliziert macht, wie wenn man gegens eigene und das Spiegelbild seiner Umgebung angucken muß.
Des weiteren habe ich mich gestern nacht entschlossen, fortan erst einmal nur die Texte zu verfassen und ohne Bilder einzustellen. Ich war jetzt während dieser Reise sechsunddreißig Stunden lang im Netz, das sind fast anderthalb ganze Tage, die dabei meistens mit nichts als oft vergeblicher, zumal sehr teurer Warterei gefüllt wurden, weil sich Bilder nur extrem langsam hochladen lassen, und zwar auch dann, wenn ich ihre Auflösung sehr verkleinere. Es soll jetzt also, jedenfalls anfangs, meine Kunst zu schildern langen; später über den Tag werde ich jeweils versuchen, Bilder nachzuliefern. Tut mir leid, aber es verging schon so viel vergebliche Zeit, die ich anders hätte nutzen können; das kostet mich Nerven und Stimmung.
Wir nähern uns, schrieb ich, dem Äquator. Übermorgen, nach dem Halt vor Georgetown/Ascension, werden wir ihn überfahren. Ich habe eine riesige Lust, da einfach von dem Schiff zu springen und über ihn hinwegzuschwimmen. Aber man würde mich dann am nächsten Hafen von Bord weisen. Es gibt freilich Kapitäne, die, erzählt gestern James, am Äquator anhalten lassen, die Beiboote wassern, und von denen aus darf dann geschwommen werden. Nach Character der hiesigen Hierarchie wird das für uns nicht geschehen.
Immerhin bin ich gestern auf S. Helena geschwommen, das sich, wie >>>> dort http://albannikolaiherbst.twoday.net/stories/where-the-hell-is-s-helena-der-fuenfundzwanzigste-tag-der-grossen-fahr/ zu sehen, morgens aus dem Dunst hob; wir mußten ankern und wurden mit Tenders an Land gebracht; S. Helena hat nicht eigentlich einen Hafen, sondern nur einen Pier, vor dem in auch dafür gebührendem Abstand, die Fischerboote dümpeln, meist indes flache Kähne, flach genug, um sie tatsächlich bis zu diesem Kai zu bringen. Den ganzen Tag umschipperte uns so ein Kahn, besatzt mit drei in blaue Overrolls gekleideten Männern, die nichts anderes taten, als unser Schiff zu fotografieren, von einer jeden möglichen Seite, deren es freilich nur zwei plus scharfem eleganten Bug und der Achterbreite gibt.
Das Meer war strahlend türkisblau und überflogen von Pärchen hellweißer Vögel, die aussehen, als hätten sich Möven und Schwalben gekreuzt; wie Mauersegler segeln sie auch, sei es im, wie ich beglückt beobachtete, dauernden Liebesturtelspiel, sei es, daß sie jagen. Die Art ist, ich fragte an Land, „Trophy“ genannt, eine Verkürzung von Red-billed Tropicbird. Die hochgewandten Flieger von etwa zwei Handspannen Länge, der Schlankheit aber eines Beguettes schießen, wenn sie fischen, ins Wasser hinab, packen, schießen draus wieder hervor in einer Anmut, die uns den Atem raubt. Ich bin nicht das, was man ernstlich einen Vogelliebhaber nennen könnte, abgesehen davon, daß ich vernarrt in Spatzen bin, aber diese Vögel besegelten mein Herz und nisten nun darin.
S. Helena ist, was man auch sofort sieht, vulkanischen Ursprungs; schroff und in schrägqueren Schichten klifft die Insel zum Meer hinab. Da sie sehr viel, was ich auch gleich erleben durfte, Regen hat – einen schüttenden plötzlichen, der die kleinen Straßen wahrhaft über schwemmt -, ist sie vor allem im Inneren kräftig begrünt, teils tropisch mit Palmen und Farnen, teils europäisch, wobei die eingeführte Vegetation die endemische fast völlig verdrängt hat. Man fängt jetzt gerade an, die eigenen Pflanzen zu schützen; nett dabei ist, daß der öffentliche Wachschutz auch am Hafen, auch die Begleitung der Grenzbeamten, „ Biosecurity“ genannt ist; so ist das auf die TShirts und weißen Hemden gestickt.
Es gibt einige Weiße, aber der Großteil der nur geringen Bevölkerung sieht nach indischem Ursprung aus, Inder, die die mit Schwarzen vermischt haben, auch kreolisch kam manches mir vor. Nicht freilich die Straße des Orts, der flach ist, übersichtlich, verschlafen mit ein paar Magazinen, die einen in ihrer Bescheidenheit anrühren, und mit dem Ruch vergangenen historischen Glanzes, vornehmlich, weil Napoleon Bonaparte, der von Elba hatte, um noch einmal auf Europa loszumarschieren, pfiffig noch entkommen können, hier sein Exil verbrachte und auch hier starb. Das Paradies als Gefängnis. Sein Unterwerfer, Wellington, besitzt eingangs des Hafenstädtchens Jamestown eines der Häuser mit Plüschsalon und Entrée; er sei hierher aber nur mal zu Besuch gekommen, erzählte mir die beaufsichtigende Dame des Hauses.
Nun war mir nicht nach Geschichte, auch wenn ich Bonaparte einigen Respekt zollen muß; ohne ihn gäbe es kein Bürgerliches Gesetzbuch oder es sähe anders aus, und dieses, ob man will oder nicht, ist die Grundlage eines jeden modernen Rechtsstaates. Mir war nach dem Meer und seiner hier kristallklaren Tiefe. Also informierte ich mich, spazierte ins Tourist Office, die nette dicke Frau griff sofort zum Telefon, rief die Tauchstation an; ja, er möge etwas warten, man werde mich abholen.
Ich wartete.
Unterdessen kamen nicht nur Astor-Passagiere, „individuals“, die meisten indes waren längst mit dem gecharterten Bus landeinwärts gefahren, sondern auch Sam mitsamt anderen, mir unterdessen Freund gewordenen Menschen der Crew, wir rauchten auf der Piazza, Linksverkehr, aufpassen, guckten in zweidrei Geschäfte, versuchten vor allem, Geld zu tauschen: Australien-Dollars („Aussies“) in Saint-Helena-Pounds, aber Euros wurden lieber genommen, überdies war der Kurs dafür besser. Selbst US-Dollars, was ich – wirtschaftlich, aber besonders politisch betrachtet – als angemessen gerecht empfand, mochte man nicht gar so gerne nehmen. Für die vielen Australier freilich, die diese Reise machen, ist die Skepsis gegenüber ihren Dollars schon ein wenig kränkend. Immerhin, sie werden sie los, wenn auch nicht immer, ohne daß jemand eine Augenbraue hochzieht, weil es nämlich bei jeder australischen Banknote ein Fläch‘chen gibt, durch das man, wie durch ein Püppchenhausfenster, durchgucken kann. Das stimmt auch solche mißtrauisch, die Transparenz eigentlich lieben: zumindest kommt niemand umhin, ein kleines bißchen amüsiert zu sein. Hingegen das Saint-Helena-Pound absolut konservativ daherkommt, man könnte es für eine wirklich britische Note halten, was sie trotz der Queen darauf nicht ist.
Gut, wir wollten also tauschen, aber es gab nur eine, wie in einem Wildwest-Ort aus Filmen, kleine Bank mit ein paar in Edelholz polierten Schaltern; indes hatten sich gestern leider zwei Drittel der Bevölkerung dahin aufgemacht, und nun stand draußen eine Schlange, echt britisch, bis fast zur Piazza hin. Formulare, selbst Überweisungen, werden per Hand ausgefüllt, all das braucht viele nicht so sehr britische denn afrikanische Zeit. Und wie wir nun so standen – es hatte sich über den Bergen dunkel zusammengezogen -, ging der Wolkenbruch nieder. Brausend strömte das die komplett überschwemmte Straße entlang. Wurde aber nicht kühl, wir sind ja nun endlich in den Tropen; man muß nur auf die Technik achten, die man so bei sich trägt, wenn man ein Hörstück produzieren will.
Dann war der Spuk vorbei, unmittelbar, als hätt ihn jemand weggepfiffen, und die Sonne prallte erneut. In nicht einer Minuten waren wir Durchnäßten komplett wieder trocken. Den Schädel schützen, dachte ich und zog meine weiße Gebetsmütze drüber, die ganz genau nur ihn bedeckt. Wir hatten es jetzt auch zum Schalter endlich hingeschafft. Kritisch lugte die dunkle und aparte Frau durch den australischen Schein.
Zurück zum Tourist Office. Mal gucken, ob mein Tauchführer eingetroffen. Nö. Nix. Rauch ich halt noch eine, setzte mich auf die Stüfchen. Dann kam die Dame heraus, es tue ihr leid, Anthony – so heißt der Inhaber der Tauchstation, die aber gar keine ist, sondern man fährt mit Booten hinaus und läßt sich dann in Rückwärtsrolle in See -, Anthony also sei mit seiner ersten Gruppe grad erst zurückgekommen, und nun habe er erfahren, daß ich bereits um eins wieder den letzten Tender nehmen müsse; da reiche die Zeit nicht.
Ach, ich war enttäuscht. Aber selbstverständlich hatte er recht, zumal in diesen Gewässern strömungshalber streng konservativ getaucht werden muß; ein bißchen Einführung, auch für Erfahrene, ist nötig. Leicht ärgerlich war nur, daß, hätte ich‘s vorher gewußt, ganz sicher zu Bonapartes Grab aufgebrochen wäre. Hätt ich auch jetzt noch tun können, aber es gehen keine Busse, auch keine Minibusse, jedenfalls nicht gestern, und Taxi zu fahren ist, der sehr hohen Benzinpreise wegen, ausgesprochen teuer; der Grundtarif liegt bei 15 SHD, das sind knapp zwanzig Euro. Darauf dann die Fahrtzeit. Nein, übersteigt entschieden mein Budget. Allein wegen der hohen Internetkosten muß ich vorsichtig sein, mach auch alle zweidrei Tage einen kompletten Kassensturz. Vor allem will ich finanziell Luft für meine Taucherei haben. Denn mittags schließlich – wir hatten die Laube eines Restaurants gefunden, geplaudert, Bier getrunken und die jungen Frauen vor allem ein WiFi gehabt, um mit Mutter und Freund, daheim in Ukraine und Moldawien, zu sprechen; die jungen Männer hingegen, beherzt, griffen in riesige Hamburgers und mampften – , mittags also schließlich, ich war zum Tenderboot aufgebrochen, auch noch ein bißchen geschlendert und, gleich neben der Mole, Zeuge eines schulischen Staffelschwimmens von Jungen geworden, in dort dem abgezäunten Swimmingpool – herrliche Atmos hab ich davon – – , - mittags traf ich Anthony dann persönlich. Es war ein ebenfalls, sagen wir, „kreolisch“ wirkender, nicht sehr großer, aber schulterbreiter Mann, der da die Tarierwesten schleppte, noch die Atemflaschen daran, und sorgsam an die Kaimauer lehnte. Selbstverständlich wußte ich noch nicht, daß er es war, aber Taucher sprechen sich an, stellen sich vor, sind immer sehr schnell vertraut. Klar, unter Wasser ist einer immer potentiell des andren Lebensretter. „Ah, du warst das, der angerufen hat! Ja, es tut mir leid, aber ich habe erst zu spät realisiert, daß so wenig Zeit ist. Wo fahrt ihr denn als nächstes hin?“ Ich: „Georgetown.“ „Wann kommt ihr an?“ „Übermorgen mittag.“ „Na, dann ist das doch einfach. Schick mir eine Email, und ich arrangiere, daß man dich dort gleich am Pier abholt. Dann könnt ihr hinausfahren.“ Er gab mir seine Visitenkarte mit der Netzadresse. „Da ist aber noch jemand, der gern möchte. Nur hat er keine Linzenz.“
Anthony schüttelte den Kopf. „Keine Chance“, sagte er. „Das ist kein Schnuppertauchen, wir sind immer gleich weit draußen oder an Küstenstrichen ohne Ausstieg.“ Ich habe dennoch, vorhin in der Email, noch einmal für den Freund zu intervenieren versucht, zumal es noch jemanden gibt, ohne Lizenz auch der, der mittauchen möchte. Vielleicht wird sich für die beiden doch noch etwas ergeben. Ich selbst jedenfalls, von heute aus morgen, geh von Ascension aus ins Boot.
Der kurze Ausflug auf die Insel endete mit einer Wahnsinnslust auf Meer und Darinsein. Zwei der Crewleute waren es schon, nämlich drin, ich konnte mich nicht halten. Links von uns tuckerte das Tenderboot im Leerlauf, die ersten Passagiere stiegen schon ein. Also raus aus Hemd und kurzen Jeans und aus den Schuhen, macht mir nix aus, im Boxerslip zu schwimmen, auch wenn der nach jedem Kopfsprung tief unten in den Kniekehlen hing. Ich wär auch nackt reingesprungen.
Warm, tiefwarm und salzig. Hellblau, man sah bis zum Grund. Schon Anthony hatte von an die dreißig, fünfunddreißig Metern Sichtweite gesprochen, unter Wasser. Ich tat ein paar wie erlöste Züge. „Und was sieht man?“ Ich fing zu kraulen an, drehte mich, schraubte mich, vor purem Wohlbehagen, durch die See wie ein Otter. „Du siehst hier alles, große Rochen, Delphine, auch Wale, aber nicht um diese Jahreszeit. An den Küsten Muränen und riesige Fischschwärme. Natürlich keine Korallen, aber alles andere. Auch Haie, klar. Und Ascension, das ist wie hier.“ Da war ein erster von der hohen Kaimauer, zehn Meter vielleicht zur Meeresoberfläche, mit sprintendem Anlauf hinein. Riesiger Platsch. Die Passagiere knüllten sich, sahen zu. Sam kam, sah‘s, kletterte sofort, das Tenderboot wollte los, „wartet!“ - und ebenfalls Platsch. In<> der Jeans. Tropfend saß er dann neben mir im Boot, Bächlein uns zu Füßen.
Und schon verschwand sie wieder, die Insel, in ihrer Vergessenheit. Auf dem TShirt eines Bewohners war zu lesen gewesen: „Where on earth is S. Helena?“ W e i t e r entfernt h a t Bonaparte nicht verbannt werden können. Von hier, in der Tat, gab es kein Entkommen. Selbst wenn er frei herumlaufen durfte und wahrscheinlich oft, mit einem Fernglas, auf die Meeresweite hinausgeschaut hat, dorthin, wo, irgendwo, seine Heimat lag: das große Frankreich, das wirklich das Seine gewesen.
*******
Und am Abend wurde Geburtstag gefeiert, der Sopranistin Dreißigster, wie die offizielle Version lautet, daß sie es geworden. Die inoffizielle wird hier verschwiegen; auch wenn ich ein Causeur bin, so bin ich doch diskret. Die Astor Lounge trompetete, die Leute klatschten im Marsch, Happy Birthday wurde gesungen, der Schiffsbauch bebte; später saßen wir in kleinerem Kreis, ich ließ einen Korken knallen, er schoß in den dunkeln Himmel hinauf. Wir tanzten quer übers Achterdeck, wenige, zehn Leute vielleicht, noch vier Passagiere, die mit uns aufgeblieben waren. Dann ging‘s in die Crewbar hinab, wohin ich aus Gründen, die Sie bereits kennen, besser nicht mitging. Ich will ja nicht ausgesetzt werden. Ein Albanson Crusoe hat mit Sicherheit ein noch schlechteres Internet als ich. Sozusagen ging ich also Ihretwegen nicht mit, und, klar, weil ich nicht möchte, daß jemand meinetwegen Schwierigkeiten bekommt. Mein Bleiben ist ja nur begrenzt, für alle anderen, auch wenn ihre Verträge immer terminiert sind, ist das Leben an Bord der Beruf.
Immer begrenzt: auch das muß man wissen. Die Mannschaft eines Schiffs ist nicht die bleibende seine; sondern selbst der Kapitän ist Kapitän auf Zeit. Die Reederei heuert an für festgelegte Fahrten und Termine. Heuert die Zimmerleute an, die Bäcker, die Köche, den Arzt, das Dienstpersonal, die Zimmermädchen, bzw., was zeitgenössisch weniger falsch ist, Zimmer frauen, die Offiziere, den Hotelchef usw. - all die Berufe, vom Arbeiter bis zum Manager, die ein einzelnes Schiff genau so braucht wie jede andere einzelne Welt und sei‘s die ganze unsere. (10.52 Uhr.)*******Aus dem schwarzen Notibuch,
dem mit dem Goldschnitt:Die nächsten neuen Planken werden eingezogen. Starboards wird achtern die Reling neu poliert. *Chopin im Captain‘s Club. „Ja, setz dich durch, junge Frau!“
Wie erholsam, wenn einem Musikstück einmal k e i n durchlaufender Beat untergehämmert wird!
(Sie selbst sagt, sie sei nicht schnell. Dafür hat ihre Langsamkeit etwas eigen Schwebendes. Ich würd gern ein Gedicht auf sie schreiben wie vor anderhalb Jahren >>>> auf die Tänzerin.
Ihr scheues, scheuendes Lächeln, jedes Mal, derselbe unsicher beschirmte Blick, wie wenn sie zur Geigerin zur nächsten Stückauswahl aufblickt: suchend. Verszeile: Nie sah ich solch suchenden Blick.
Wie ihr stets nach einiger Zeit des Spieles von der rechten Ferse der Pumps-Riemen rutscht.)
Im Hörstück dieses Klavierspiel mit den störenden Schwätzern verschneiden. *Über der See schwankte der volle Mond wie ein am Kinderarm getragener Lampion. Mit ihm schaukeln die Wolken. *Ebenfalls Hörstück: Lanmeister von außen sehen, ihn beobachten und dann erst, nach und nach, seinen Blick übernehmen. Indessen die besondere Schwierigkeit meines Romanes darin besteht, Menschen, die wirklich völlig anders sind, ihr Eigenes zu geben, indem man sie umschreibt. Auch sie müssen wahrgelogen werden. *Im Schiffsbauch: „Ich bin heute noch gar nicht draußen gewesen.“ Die Leute in der Küche, wurde mir erzählt, sähen quasi niemals das Tageslicht. *Der ganze Himmel ein einziger Regenbogen! *Lanmeister, der in die junge Pianistin verliebt ist, aber die Perspeltive, von allem Anfang an, des Verzichts einnimmt, sie annimmt, als wäre eben s i e seine Geliebte. *Eines der wesentlichen Motive bei Henry James: die moderne, meist junge Frau, der die Männer nicht eigentlich gewachsen sind. *Jacob‘s Ladder. *Wie schwierig lange ununterbrochene Seetage für die Crew sind. Daß die Zimmermädchen, der Dienstzeiten wegen, quasi niemals von Bord gehen können, es sei denn, wir ankern einen ganzen Tag; dann, vielleicht, haben sie für zwei Stunden Landgang. So segeln sie zwar um die Welt, aber sehen sie nicht. Die Souvenirs, die sie später mit heimbringen, haben ihnen vom Land oft die Passagiere mitgebracht oder Kollegen anderer Dienste. „Sie hat mich umarmt vor Glück, daß ich an sie gedacht habe“, erzählte gestern C. *Ich sah die Fußsohlen der Schlafenden
Alle Körper verwesen
Wie geht das, zerfällt das
In Indien meint man, dem zu entgehen
und recht die verkohlten Knochen zusammen
Die Schlafenden aber schlafen mit offenen Mündern
Selbst wo sie sich sonnen
Wie hängende Mumien, die liegen
und verdorren in den Nischen
(...)*Lange, sehr lange sehe ich von hinten die riesigen Ohren eines alten Mannes an, verwundert, erschrocken. Und ich dachte: ich verstehe diese Ohren nicht. Was aber versteh ich denn? *******An Do denken. Heute vor zweiunddreißig Jahren, Philosophicum Frankfurt am Main, Raum 309. *** albannikolaiherbst - Freitag, 25. April 2014, 19:10- Rubrik: Arbeitsjournal
(8.03 Uhr, i.e. 10.03 Uhr Ihrer Zeit.
MS Astor, oberes Achterdeck.
8º32‘ S/13º50‘ W.
Kurs 287º W.
Sonne.)
Welch eine warme Nacht! Und nun, welch warmer Morgen. Es war ein reine Akt meiner Sentimentalität, daß ich zum Sonnenaufgang mit Schal um den Hals erschien. Den ich dann auch gleich wieder in meiner Kabine abgelegt habe, von wo ich den Laptop zum Schreiben holte, und um Fotografien und weitere Töne auf das Gerät zu übertragen. Wobei ich, à propos, Sie abermals um Nachsicht bitte; Bilder ließen sich gestern wieder nicht hochladen, und ich mag einfach nicht, jetzt vor allem nicht mehr, stundenlang in klimatisierten Räumen sitzen. Denn dies hier, die Tropen, sind klimatisch mein Zuhause, ich bin glücklich allein, wenn ich die schwere Luft in die Lungen bekomme, schwer von der Hitze. Alles in mir wird schneller. Ich beobachte schärfer, ich drehe auf Hochtouren ständig, hüpfende Glückswallungen permanent. Ich kann in der Hitze auch besser arbeiten als in auf Mittelmaß temperierten Zonen, die Fantasien gären, blühen, tragen schon Frucht, alles in Minuten, ich weiß gar nicht, woher das kommt. Aber es war immer schon so, seit ich das erste Mal mich in tropischem oder subtropischem Gebiet aufgehalten habe, spät, sehr spät für jemanden meiner Generation, ich war nicht jünger als dreißig. Sogar, ich erstaunte gestern tatsächlich, die Fingernägel wachsen schneller, keine anderthalb Wochen, und ich muß wieder schneiden. Und von morgens bis abends könnt‘ ich vögeln, wobei ich grad das hier nicht tue, aus naheliegenden Gründen, nicht weil ich treu wär, denken Sie bloß nix Falsches von mir! Die Tropen, das sind Sinne-p u r. Es gehört ganz organisch dazu, daß auch der Tod immer mit nah ist, die Krankheit, die eines anderen Wesens Erhebung und Nahrung.
Ebenfalls seltsam tropisch: Nach vierfünf Tagen ohne Sport ging ich davon aus, zugenommen zu haben. Hatte ich aber nicht, sondern abgenommen; was paßt: offenbar ist auch der Grundumsatz höher, verbrennt man mehr, jedenfalls ich.
Man wird verleitet.
Man wird verleitet, wie unser kleiner blinder Passagier, der heute früh auf dem unteren Achterdeck landete, völlig erschöpft von dem zu langen Flug, der die Nacht vielleicht durchging. So rettete das Tierchen sich auf das Schiff, nicht größer als ein Amselweibchen und ebenso braun, aber weißschwarz die Unterschwingen, als es sie wie zum Trocknen ausbreitete. Die kleine Lunge ging und ging. Halb ängstlich, halb froh drückte sich der Vogel an die Bordwand. Jemand vom Service entdeckte ihn, hockte sich, strich mit zwei Fingern über das Gefieder, ging wieder, kam mit einer Serviette, nahm das Tier achtsam mit ihr auf, es in sie gehüllt, trug es hinein. Wenn wir nachher die Insel erreichen, wird er es wieder fliegen lassen.
Es ist erstaunlich, wie weit sich die Flieger vom Land entfernen, das schon längst zu sehen nicht mehr ist, wenn sie immer noch kreisen und kreisen. Ich verstehe Noahs Geschichte erst nun, nun erst wirklich, weil ich sie fühlen kann. Zu fühlen bedeutet, er lebt zu haben.
Dann kam die Frage, des Barkeepers, es gingen Wetten, weil er gesagt habe (es steht mit auf den Rechnungen), ich sei neunundfünfzig. Allgemeiner Widerspruch. Was mir schmeicheln kann, aber dann realisierte ich, daß auch dieses Teil meines Fremdseins ist, eines nicht aufzuhebenden, denn man gehört nun auch körperlich nirgendwo dazu, nicht zu den Älteren/Alten, nicht zu den Jungen und nicht zu denen dazwischen. Man steht draußen, so daß, was doch ein ganz offenbares Privileg zu sein scheint, mit einem Huf des Teufels lahmt. Das ist ein spannender, weil ganz uneitler, ja pragmatischer Befund. Was „das Geheimnis“ fragte mich der Kellnerchef vom Dienst, der dabeistand. „Do never anything, you don‘t want. Be allways on your own. And never never want to be safe.“
Und meine erstaunliche Entdeckung, daß ausgerechnet ich mich in den Kitsch fallen lassen kann, mich drehen kann darin und mich wohlfühle bei hin und wieder einem Schlager; daß das aber schlagartig aufhört, wenn unter die Melodie ein Beat gelegt wird. Offenbar ist meine Aversion eine gegen den – Marsch. Auch das wurde mir gestern klar, daß durchlaufende Rhythmen imgrunde marschieren lassen wollen; nicht hingegen synkopierte. ***Wie schön dann, wie berührend, wie, ja, erhebend, das ältere Paar zu beobachten, das nachts an der hinteren Reling steht; der Wind umschmeichelt es. Es war kein Paar zuvor. Da schließt er sie in die Arme. Man könnte von einem „Kreuzfahrschatten“ sprechen, analog zu „Kurschatten“, wäre das Geschehen nicht derartig hell. Und leuchtet den Sternen wie Spiegel zurück.
Ganz ebenso: Captain‘s Club, 22 Uhr. Die schon sehr alte hagere Dame in Rot, sehr elegant, und er – einen Buckel und wie als Gegengewicht vorne den Bauch; der Mann geht, wenn er schreitet, immer schräg nach vorne gebeugt – , - er trägt eine weiße Smokingjacke mit genau so roter Fliege und passend rotem Einstecktuch. Wie nun sie in einer unvermittelten Regung ihre linke Hand auf sein rechtes Handgelenk legt und sie dort liegen läßt, während sie der Musik lauscht. So schütter sein graues, nach hinten gestrichenes Haar. Aber eine Locke, die keck um Spuren zu lang ist, rutscht ihm vor, er streicht sie zurück, sie rutscht ihm abermals vor.
Andere, nicht diese beiden, tragen die Bordcard, mit der hier wie mit einer Kreditkarte bezahlt wird, an einem Bändel um den Hals. Stil ist daran zu erkennen, daß man das n i c h t tut, sondern kleine Unbequemlichkeiten auf sich nimmt. Das ist eine Lebensweisheit. Dazu gehört auch die Frage, weshalb man ein Fußkettchen trägt, wenn man auffällig verdickte Waden hat und an den Fersen dicke weiße Hornhaut. Zumindest diese doch ließe sich entfernen. Nun ist das Kettchen wie ein Pfeil darauf: Guckt alle, alle hin! ***Nach einiger Zeit, so sehr sich die Küche, und wie gut auch immer, bemüht, wird sie einem langweilig, so daß es gar nicht weiter schwer ist, auf Mahlzeiten zu verzichten. Immer derselbe Küchenchef. Er kann ganz ausgezeichnet sein, und ist es. Aber wird Alltag, und der Reiz vergeht. ***Nachts, Schwarzes Notizbuch:Hoch steht das Kreuz des Südens, aber, seltsam, der Orionstab, der unsere Reise allezeit begleitet hat, ist vom Firmament verschwunden. Ich steige zum Oberdeck auf, gehe die Reling bis zum Bug entlang und suche ihn. Nichts. Unter dem Horizont vielleicht, vielleicht hinter einer Wolke? Doch ich sehe keine Wolken, nur, aus unseren Schloten, den gegen das tiefschwarze, indessen von Millionen Stecknadellichtern gespickte Himmelszelt, den weißen langen langen faserigen Rauch.
Als ich so sann, kam mir die Idee einer ganz anderen Geschichte, nämlich die eines schwer krebskranken Mannes, der, um den Zeitpunkt seines Ablebens selbst zu bestimmen, um die Schweizer Staatsbürgerschaft einkommt. Dort darf man ja, anders als in Deutschland, sterben, wenn man es möchte und darf sich die Mittel besorgen. - Wie würde reagiert werden? Gäbe man sie ihm?
(Auch wenn es mir nicht bewußt ist. denke ich über den Tod stänmdig nach und bin damit tatsächlich mitten in meinem Roman. Manchmal merke ich es: als wäre ich aufgeschreckt und sähe.) ***Und abermals: die Tropen. D a n n ist es warm, wenn wir nicht mehr nach Süden fahren müssen, sondern der Süden – kommende Kälte bedeutet. Wir sind von Australien aus immer weiter nach Süden gefahren, bis das Kap umschifft war. Nun fahren wir für die Wärme nach Norden. Relativität der Perspektiven. Die – gefühlten! – Bedeutungshöfe selbst der Himmelsrichtungen ändern sich. Wer, der in Kenia lebt, könnte sagen: um den mythischen Ursprung zu finden, mußt Du nach Osten?
Und es ist ja auch nur eine kleine Mittelverdickung der Erde, die uns näher der Sonne sein läßt; doch sie genügt. Und mit welchem Effekt! Was es von daher bedeutete, ihr nur einen einzigen Kilometer näher zu sein auf der Umlaufbahn unsres blauen Planeten, und was, einen weiter entfernt! Welch eine meteorologische Rutsche! Was der kleine Fingernagel eines Handpüppchens bedeutet. Er entscheidet über Leben und Tod.
Die meisten aber, mittags, ziehen sich vor der Hitze, die ich suche, zurück. Sitzen im klimatisierten Promenadendeck und schauen durch die Scheiben aufs Meer. Lesen in den Gängen, spielen im Kartenspielzimmer Karten, legen Patiencen in der Bibliothek, deren Bücher ausgesprochen frequentiert sind: Forsyths und Clancys und Chrichtons. Es gibt eine hohes Registerbuch, in das man die Ausleihen, wird gebeten, eintragen möchte. Oder sie puzzeln Riesenpuzzles. Wieder andere häkeln, stricken, besticken. Ich dachte: Durch eine Scheibe auf die See zu schauen, ist nur eine andere Art von Fernsehgucken: eine Ferne sehen jedoch, die so nah ist. Zu nah vielleicht. Wie man nicht nah sein w i l l. ***Gestern „meinen“ James „aus“gelesen, jedenfalls die auf die Reise mitgenommene Erzählsammlung. Bin nur noch immer mehr beschämt von seiner Sprach- und damit Darstellungskunst, nämlich des Kleinsten, Inneren, ohne daß wirklich etwas geschieht. Dann waren mir die „richtigen“ Bücher ausgegangen, und ich nahm den Kindle wieder vor. Peter H. Gogolin, Herz des Hais. Ich hatte das schon mal angefangen, war dann unterbrochen worden. Großartig, auf S. 31, daß jemand „ein Fachmann für Beherrschung“ gewesen sei. Wie Sie sehen, hab ich es mir, und Ihnen jetzt, notiert. *******Gegen ein Uhr, das ist bei Ihnen des frühen Nachmittages drei, werden wir in Georgetown anlegen, auf Ascension. Es ist nun aber nicht heraus, ob wir überhaupt an Land gehen dürfen, weil, erfuhr ich gestern abend, der Wellengang zu hoch für die Tenderboote sei. Abwarten also. Ebenso ist nicht heraus, ob ich es diesmal mit dem Tauchen schaffen werde. Zwar schrieb ich gestern die Email, aber sie kam dreimal als unzustellbar nicht zurück, nein das passiert im Internet ja nicht, aber der mailing demon frechte, und er beharrte drauf zu frechen. Doch es berührt mich nicht wirklich. Denn ich bin in den Tropen. * albannikolaiherbst - Sonntag, 27. April 2014, 11:29- Rubrik: Arbeitsjournal
(7.58 Uhr, i.e. 9.58 Uhr Ihrer Zeit.
MS Astor, oberes Achterdeck.
3º56‘ S/16º05‘ W.
Kurs 325º NW.
Sonne.)Das schwere Frühstück laß ich wieder ausfallen, nahm aber zum ersten Kaffee an der Achterreling zur Sonne, die da noch unter dem Horizont war, doch schon die leichten Wolken färbte, ein süßes Stückchen, „e“-dampfte da vor mich hin, sann und sinne: Schwer liegt die Wärme, in die nur zuweilen eine Brise fährt, eine von jenen, die nur die Erinnerung an eine Frische tragen, die sich kühl nennen läßt. Kühl indessen ist‘s unter Deck, ist‘s in den Gängen; jedes Mal, gestern, ging ich hinunter, fröstelte mir. Nachts war der Orion wiedergekommen; er stand um sehr wenige Grade über dem Horizont direkt im Westen; wir drehten uns drunter schon weg. Wie automatisch fange ich seit vorgestern an, unseren Kurs nach dem Sternenhimmel abzuschätzen. „Nordnordwest“, sagte ich, aufs Kreuz des Südens weisend. Unseren Polarstern, des Nordens, gibt es noch nicht.
Aber es gab Ascension. Die Insel erhebt sich aus dem Meer, nein, liegt quasi flach darin, aufgefaltet inmitten von leicht begrüntem Fels, der siebenhundert Meter hinaufgeht und, wie ich las, meistens von einer dichten Wolkenballung verdeckt ist, die für Feuchtigkeit sorgt; gestern war der Gipfel aber blank erigiert, den Spalt seiner Eichel fordernd zum Himmel. Er ganz aber selbst, der Fels, weithin umpickelt von vulkanischen Hügeln, rot, blaßrot, selten dunkler, als wären sie eine Akne der Insel; bisweilen kann man erstarrte Lavastraßen erkennen. Der letzte Ausbruch sei, hörte ich, für vor siebenhundert Jahren verzeichnet worden. Das bedeutet Sicherheit n i c h t. Ascension (ausgesprochen nicht, wie ich immer tat, nämlich französisch, sondern englisch: Äß‘ßen‘schn; eigentlich wäre Spanisch richtig: A und gelispeltes „s“,. danach „en“ und betont „ßión“) liegt zwar nur eine Schiffstagesreise von S. Helena entfernt, aber gehört, anders als die andere Insel, bereit zur Mittelatlantischen Platte; dazwischen schiebt sich ein Grabenbruch. So braucht‘s einen kleinen tektonischen Ruck nur, so daß der Erdmantel dünn wird, und eine nächste Insel kann aus der Tiefe steigen, aus Lava, die im und über dem Wasser zu Land wird. Und/oder das hochquellende Magma nutzt die bereits vorhandenen Schlote und Schlötchen, sofern nicht in den Kratern der vorherige Ausstoß allzu sehr ausgehärtet hat; ist das der Fall, ist es für den Druck viel leichter, ein neues Vulkanchen, an anderer Stelle aufzuwerfen.
Es paßt zu den verschiedenen geologischen Substanzen, daß die Färbung der Insel permanent changiert. Wir hatten gut Zeit, das zu sehen und zu beobachten, denn wir fuhren einmal herum, nachdem uns nicht erlaubt worden war, das Eiland zu betreten. Zu hoher Seegang, hieß es. „Es ist nicht unsere Entscheidung“, ließ der Kapitän über die Bordlautsprecher vermelden. Das konnte so sein, konnte aber auch nicht so sein. Zu hoher Wellengang? Wo denn? Zwar, wir sahen die Gischt an den Felsen zerstäuben, das war in Mossel Bay indes nicht anders gewesen, und auch dort waren wir mit Booten übergesetzt. Sehr viel wahrscheinlicher ist, daß George„town“ uns nicht haben wollte. Schon das Formular, das wir vor Landgang ausfüllen und immer bei uns tragen sollten, verbot uns quasi alles: Es ist nicht erlaubt, den Ort zu verlassen; es ist nicht erlaubt zu baden; es hätte schon wie eine Übertretung gewirkt, daß wir atmen.
Denn Ascension ist Krieg. Vorbereitung auf den kommenden, Nachbereitung des stattgehabten. Von hier aus wurde zwischenlandend und bombertankend während der Falkland-Krise operiert: Die Insel liegt auf halbem Weg zwischen Afrika und Brasilien, und also sind nicht die Vulkane zu fürchten, auch nicht die Haie, vor denen an Bord jeder zweite angstzuhaben scheint. Zu fürchten sind die Teleskope, runde, die wie Kuppeln wirken und deren Weiß fast das erste ist, das man von der Insel zu sehen bekommt. In ihren Hügeln und Bergen erkennt man aber ebenfalls Trails: Kletter- und Wanderwege, die wahrscheinlich vermint sind. Ein Paradies, über das der Stacheldraht geworfen wurde. Vierhundertfünfzig (in Zahlen: 450) Einwohner und alles, fast alles, Garnisonsstationierte, die Herrschaft der unbedingten Befehlsketten, auch etwas NASA, die von hier aus die Mondexkursionen mitkoordinierte – und natürlich Versorger: kleiner Supermarkt, ein Hotelchen, falls nun doch mal ein Gast kommt. Ascencion hat nicht grundlos den Ruf, einer der herrlichsten Tauchgründe zu sein, die es überhaupt gibt auf der Welt. Ach, das war eine Lektion in persönlichem Fatalismus, wie ich da an der Reling stand und hinübersah, wo ich das Tauchteam erkennen konnte, das schon auf mich wartete. Und nicht hinüberdurfte. Insch‘allah, sprach ich leise, doch ohne auf zum Himmel zu sehn.
Aber es ist, d a ß es solch ein herrlicher Tauchgrund ist, nun wohl der Unzugänglichkeit der Insel gerade verdankt. Selbst die häßliche, in ihrer ästhetischen Brutalität unmenschlich öde Präsenz des Militärs, ein Eiter aus Hangar und Schuld, hat ihre lichte Seite: bewahrt die Insel eben vor Besuch. Nicht der einzelne Reisende macht, was ihn umgibt, zunichte, doch wenn es ihrer zehn sind, schon hundert, schon tausend... - Keine Fischerei nahbei, geschweige eine Flotte, die fischte und längst schon selbst Industrie ist; kaum je ein Schiff, außer hin und wieder einem Kreuzfahrer. „Mich wundert das nicht, daß wir nicht an Land dürfen“, erzählt mir ein Passagier. „Vor drei Jahren, als ich diese Strecke fuhr, war das genauso. Und wer da dann spazierengeht oder möchte doch nur einfach an einen Strand, nur um zu schauen, zu meditieren, wird als möglicher Spion verhaftet.“ Gunatánamo, dachte ich, obwohl d a s ein US-amerikanisches Folterlager ist, kein britisches. Ich habe einen tiefen, sehr tiefen Ekel vor Militär; nicht vor dem einzelnen Soldaten, nein, und schon gar nicht vor dem Kampf, aber vor dem Gehorsam, dieser Zwinge, die Menschen prinzipiell zu Ungeheuern macht, weil der Vorgesetzte es will und bestimmt. Ich habe einen an Haß grenzenden Abscheu vor Vorgesetzten.
Und dennoch, diese hassenswerte, Befehl über die Selbstverantwortung, über alle Ethik und Moral stellende Organisation, das Militär, schützt die Insel eben auch, als Insel, schützt die hier ungefährdete Vogelwelt vorm Schwarzen Tod des Massentourismus, schützt das Meer und alle seine Arten. Nirgendwo sonst im Atlantik sind diese noch so zahlreich zugegen wie hier. Ich weiß zwar nicht, ob, daß ich Ascencion, also die Insel selbst, ein Paradies nannte, berechtigt ist, weil ich nicht weiß, ob es dort anderes Wasser als nur der Niederschläge gibt; es kann gut sein, daß Ascension von Menschen gar nicht belebbar wäre auf ohne riesige Steuergelder vermahlende, vernichtende Dauer, aber wir waren noch nicht einmal herum, da schwammen mit uns die Delphine: glänzende, dicht unter der tiefblauen, teils strahlend türkisen Meeresoberfläche dahinschnellende Leiber, von denen Cortàzar nicht zu unrecht schrieb, sie stammten in Wahrheit vom Mond: eben deshalb sprängen sie, sprängen der einstigen Heimat zu. Einer der Märchen, selbstverständlich, der Träume, nicht des realen toten Trabanten. Und da schon taten sie es, sprangen. Es war, als hätten sie bemerkt, beobachtet zu sein, hätten all die Finger gesehen, die auf sie zeigten, und wollten sich nun präsentieren g a n z, in aller ihrer selbstbegeisterten Herrlichkeit. Nur, wer kein Empfinden für Schönheit hat, würde es wagen, diese Lunaren eitel zu nennen. Ach, puritanistische Prüderie... was sag ich?: Blasphemie! Doch selbst solch lebensfrohe lunare Kapriolen, so dankbar ich für sie war, kennen ihre Kehre: Hier wär ich, dachte ich, unter Delphinen getaucht -. Vorbei. ***Die Wehmut ging noch bis zum Abend in mir um. Ich würde nie wieder hierherkommen in meinem Leben, wußte ich und weiß ich. ***Schwieriger, weniger luxuriös als Enttäuschung, war das für die Crew. Einen ganzen Seetag nun mehr, an dem man nichts sieht außer Dunkel, nichts ißt außer dem vom Vortag, an dem eingebunden in die feste Disziplin ist, paramilitärisch, des Bordlebens – und für wie wenig Geld. Das wollte ich auch wissen, was man hier eigentlich verdient. Manch Zimmer„mädchen“ und die Arbeiter 400 Euro pro Monat, manch Musiker 700. Steuerfrei, in Ordnung, und bei freier Kost und Logis. Aber daheim müssen doch Mieten bezahlt werden... So ist zu verstehen, daß, selbst wenn sie könnten, die meisten am Oberdeck nie erscheinen; es gibt sogar einige, die überhaupt nie einen Landgang unternehmen, eben, weil sie sparen müssen. In den Offiziersrängen freilich, auch im Management der Unterhaltungssparten, sieht es ein bißchen besser aus. Und abermals: das Vorgesetztentum. Verdient wird nicht nach objektiv geleisteter Arbeit, sondern nach Rang. Mein luxuriöses Schiff ist ein sozialer Spiegel der übrigen Welt.
Wieder nagte ich am schlechten Gewissen, geradezu unstatthaft privilegiert. Als hätte mich eine Fügung gesegnet. Es ist wie bei der FAZ: Es sei eine Ehre, für sie zu schreiben, da brauche man nicht auch noch ein angemessenes Honorar. Hier ist‘s die Erfahrung, die man auf Weltreisen mache, was den miesen Lohn mehr als nur ausgleiche. Hie wie dort: perfide. Und nun, die es unbedingt wollten, durften nicht mal mehr an Land. Selbst wenn sie zugeben – auf Nachfragen, selbstverständlich – , wie enttäuscht sie seien, lachen sie uns dabei an oder, sind sie asiatischer Herkunft, lächeln. Das tut fast am meisten weh. ***Trainiert also, am Abend vor dem Trinken, um mir wieder Form zu geben. Alkohol hat Kalorien. Auch der Kraftraum der Besatzung war proppedickevoll. Es gibt in Gogolins Herz des Hais eine Stelle, die eine Meditation beschreibt, in welcher das Ich vom Körper getrennt wird, nichts als „Zeuge“ sei, nicht etwa Betroffenes selbst. Ich habe Gefühle, aber ich bin sie nicht, ich habe Gedanken, aber bin sie nicht, habe Schmerzen und bin auch die nicht. Ich bin der Zeuge. - Gogolin erzählt hier den absoluten Gegenentwurf m e i n e s Glaubens. Ich bin - und w i l l es sein -, was ich empfinde, fühle, denke. Will nichts darüber hinaus sein. Ich will ein Teil der Welt und nicht sein außer sie. Erde. (Es gibt in dem Buch einen homosexuellen Dirigenten, der Frauen nicht begehren kann, weil sie, wie er sagt, „ihren Ursprung nicht verleugnen können“ und immer Sekret seien; ich aber begehre sie genau deshalb. Der „reine“ Geist ist nicht nur frigide, nein, er ist lebensfeindlich wie das Militär. Und viel sentimentaler - schlecht, ja b ö s e sentimental -, als es je der Geilheit möglich wäre. )
Ein dichter, sehr sehr warmer Wind geht, notierte ich am Abend, und: „daß ich ausgerechnet jetzt, hier, an Paris denken muß! ans 18. Arrondissement, an die Rue Macadet“ - - dachte uns zusammen, sie und mich, so daß sie ganz atlantisch mit mir wurde, südatlantisch. Und morgen wird der Äquator durch sie hindurchgehn.
(9.54 Uhr.)***** albannikolaiherbst - Montag, 28. April 2014, 11:54- Rubrik: Arbeitsjournal
|
|
Für Adrian Ranjit Singh v. Ribbentrop,
meinen Sohn.
Herbst & Deters Fiktionäre:
Achtung Archive!
DIE DSCHUNGEL. ANDERSWELT wird im Rahmen eines Projektes der Universität Innsbruck beforscht und über >>>> DILIMAG, sowie durch das >>>> deutsche literatur archiv Marbach archiviert und der Öffentlichkeit auch andernorts zugänglich gemacht. Mitschreiber Der Dschungel erklären, indem sie sie mitschreiben, ihr Einverständnis.
Kontakt ANH:
fiktionaere AT gmx DOT de
E R E I G N I S S E :
# IN DER DINGLICHEN REALITÄT:
Mittwoch, den 5. April 2017
Bremen
Studie in Erdbraun
Mit Artur Becker und ANH
Moderation: Jutta Sauer
>>>> Buchhandlung Leuwer
Am Wall 171
D-28195 Bremen
19 Uhr
Sonnabend, 23. September 2017
Beethovenfest Bonn
Uraufführung
Robert HP Platz
VIERTES STREICHQUARTETT
mit zwei Gedichten von Alban Nikolai Herbst
>>>> Beethovenhaus Bonn
Bonngasse 24-26
D-53111 Bonn
16 Uhr
NEUES
Bruno Lampe - 2017/03/29 19:48
III, 280 - Bei Äskulap
Gegen zwei löste ich mich kurzentschlossen vom Schreibtisch. Es war nichts mehr abzuliefern. Aber die ... Die in einem ...
... Deckenlabyrinth sich mäandernde Inschrift...
Bruno Lampe - 2017/03/28 21:42
Vielhard, Leichtgaard:
albannikolaiherbst - 2017/03/28 07:53
Bruno Lampe - 2017/03/27 20:43
III, 279 - Oder auch nicht
Kühler Nordwind. Die Sicht ging bis zu Sant’Angelo Romano weit unten im Latium. Jedenfalls vermute ich ... Bruno Lampe - 2017/03/24 19:55
III, 278 - Einäugigkeiten und Niemande
Ein Auge fiel heraus, abends beim Zähneputzen. Es machte ‘klack’, und der Zyklop sah nur noch verschwommen. ... Danke, gesondert, an...
bei der sich in diesem Fall von einer "Übersetzerin"...
albannikolaiherbst - 2017/03/24 08:48
albannikolaiherbst - 2017/03/24 08:28
Schönheit. (Gefunden eine Zaubernacht). ...
Es juckt sie unter der Haut. Es juckt bis in die
Knochen. Nur, wie kratzt man seine Knochen?
Sein ... Bruno Lampe - 2017/03/22 19:39
III, 277 - Die Hühner picken
Irgendwas ist schiefgelaufen seit dem 9. März. Man könnte es so formulieren: die Verweigerung der Worte ... ich hör' ein heer...
ich hör’ ein heer anstürmen gegens...
parallalie - 2017/03/21 06:51
Ich höre berittene...
Ich höre berittene Landsknecht sich ballen vorm...
albannikolaiherbst - 2017/03/21 06:18
albannikolaiherbst - 2017/03/21 06:12
James Joyce, Chamber Music. In neuen ...
XXXVI.I hear an army charging upon the land,
And the thunder of horses plunging, foam about their knees: ... den ganzen tag lärmen...
den ganzen tag lärmen die wasser
ächzen schon
trist...
parallalie - 2017/03/18 09:55
Den ganzen Tag hör...
Den ganzen Tag hör ich des brandenden Meeres
Klagenden.. .
albannikolaiherbst - 2017/03/18 08:23
JPC

DIE DSCHUNGEL.ANDERSWELT ist seit 4675 Tagen online.
Zuletzt aktualisiert am 2017/04/01 07:33
IMPRESSUM
Die Dschungel. Anderswelt
Das literarische Weblog
Seit 2003/2004
Redaktion:
Herbst & Deters Fiktionäre
Dunckerstraße 68, Q3
10437 Berlin
ViSdP: Alban Nikolai Herbst
HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Der Autor diese Weblogs erklärt hiermit
ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen
Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle
und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft
der gelinkten/verknüpften Seiten hat der Autor keinerlei Einfluss.
Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten
aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung
verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb
des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für
Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Gästebüchern,
Diskussionsforen und Mailinglisten, insbesondere für Fremdeinträge
innerhalb dieses Weblogs. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen,
haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde,
nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung
lediglich verweist.
|