ANH spricht S a m h a i n (2006).
albannikolaiherbst - Sonntag, 1. November 2015, 07:49- Rubrik: Videos
|
Alban Nikolai Herbst / Alexander v. Ribbentrop
|
































ANH spricht S a m h a i n (2006).albannikolaiherbst - Sonntag, 1. November 2015, 07:49- Rubrik: Videos
ANH spricht Hans Deters packt keinen Koffer (1999).Alban Nikolai Herbst Hans Deters packt keinen Koffer in: Büchner Zeitschrift für Literatur, Kunst und Kultur 1999 albannikolaiherbst - Montag, 2. November 2015, 07:55- Rubrik: Videos
ANH spricht S v a v a (2003).albannikolaiherbst - Mittwoch, 4. November 2015, 07:22- Rubrik: Videos
ANH spricht Sätze aus Thetis (3).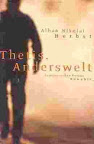 Alban Nikolai Herbst Thetis.Anderswelt Fantastischer Roman Rowohlt 1998 Elfenbein 2013 [>>>> Bestellen.] albannikolaiherbst - Donnerstag, 5. November 2015, 08:02- Rubrik: Videos
„Überorchestrierung“ vs. Motivarbeit. „Bildungsballast“ vs. Themenverknüpfung. Und nach wie vor zur „Ironie“ als willentlicher Selbstentfremdung. Im Arbeitsjournal des Freitags, dem 6. November 2015.[Arbeitswohnung, 8.45 Uhr Richard Strauss, Daphne]
Es ist schon bitter. Jetzt wurde >>>> des Perlentauchers suggestive Fälschung der >>>> Rezension Insa Wilkes in der SZ >>>> von Bücher.de übernommen. Genau auf diese Weise funktioniert im politischen und also auch poetologischen Marketing suggestive Meinungsbildung. Mein Protest war begründet, und diejenigen, die mir sagten, ich solle das nicht so ernst nehmen, es sei halt Schlamperei, haben böses Unrecht. Schon Karl Kraus wurde nie müde, auf die eminanten politischen Gefahren hinzuweisen, die solche „Schlamperei“ bedeutet. Es geht mir aber um prinzipiell mehr. Daß ich größere Furcht vor der Ironie als vor dem Kitsch hätte, sagte ich gestern abend der Löwin. Und will das jetzt begründen. Ironie ist eine Form der Distanzierung, das heißt, sie schiebt zwischen Subjekt und Objekt eine noch schärfere Trennung, als das abendländische Denken es sowieso schon vornimmt. Politisch ist so etwas ganz sicher oft nötig. Wenn es aber alle anderen Lebensbereiche des Menschen ergreift, wird er zum Replikanten, das heißt: macht sich selbst zum Objekt, also Ding. Etwa ist leidenschaftliche Liebe ironisch nicht möglich; zudem setzte ironische Liebe ein Machtverhältnis des sich Distanzierenden zum Distanzierten. Das liegt im Prozeß selber, mag gar nicht beabsichtigt sein. Leidenschaftliche Liebe ist ihrer Natur nach pathetisch, anders würde sie wieder und wieder relativieren, was Leidenschaft eben ausschließt. Entgrenzung, Begeisterung, Orgasmen sind ironisch nicht nur nicht mehr spürbar, sondern sie werden vernichtet, erstickt und überdies sogar lächerlich gemacht – auch und gerade sich selbst gegenüber. Damit verlieren die Menschen ihren Kontakt zu sich selbst und zur Erde. Sie entgeistigen sich ihr. Hiergegen standen – sofern sie nicht ein politisch definiertes Ziel, eine Botschaft also, hatten – seit je die Künste, spätestens jedenfalls, seit sie sich vom alleinigen Handwerk trennten und nicht mehr nur-mimetisch waren. Sie hoben, sehr wahrscheinlich zuerst die Musik, genau diese Trennungen auf. Daher auch ihr rituelles Moment, das wir bis heute ebenfalls vor allem in der Musik erleben können, gleichgültig, ob U oder E. Doch auch Romane und Lyrik haben diese Kraft – eine der Erschütterung - die mithin emotional ist und nicht nur auf die Ratio wirkt. Diese hat mich in meiner Arbeit immer nur insoweit interessiert, als sie notwendig für das ist, was ich „Motivarbeit“ nenne: also für die Faktur eines Werkes, die dafür sorgt, daß es weder sich zerfließend verschwimmt noch im Gefühl untergeht, dem bewußt die Strukturierung zur Seite gestellt wird, eine Geländer quasi, an dem man sich auf dem Weg durch Hölle und Himmel festhalten kann, und doch erlebt man beide. Genau diese Motivarbeit wird mir nun, und wurde mir schon vorher, immer wieder als „Überorchestrierung“, „Überinstrumentierung“ bin hin zu, siehe Perlentaucher, „Ballast“ vorgeworfen. Dahinter steht der unselige Gedanke, daß alles, was wahr sei, „einfach“ sei, mithin keine Zwischentöne (Schnitzler) kenne und keine Ober- noch Untertöne, sondern gewissermaßen der „reine“ Gedanke. Wie ich über „Reinheit“ denke - einen letztendlich religiösen Terminus, dessen sich auch Hitler bedient hat -, ist bekannt. Auch und gerade biologisch ist im Gegenteil Vermischung nötig, um organische Systeme lebensfähig zu halten. Dafür steht mein literarischer Synkretismus. Interessant an den Vorwürfen – oder Einwänden – ist, daß sie quasi nur bei deutschsprachiger Literatur Anwendung finden. Was hätte man an „Überorchestrierung“ allein nur gegen García Marquez vorbringen können, um von dem stilistisch n o c h größeren – und komplexeren – Lobo Antunes zu schweigen. Auch gegenüber Gaddis und Pynchon wurde solche „Kritik“ kaum je laut. Es scheint sich mithin um ein intrakulturelles Problem zu handeln, um etwas, das Deutsche nicht dürfen, alle anderen aber sehr wohl. Etwa pathetisch zu sein und zu schreiben, direkt auf Pathos hin. Die komplette U-Musik ist ohne Pathos nicht denkbar, aber gerade auch hier wirkt ein extremer Überhang des, sprachlich, angelsächsischen Raums. Ich habe schon mehrmals erzählt, daß es in meiner Jugend für die meisten Menschen gut möglich war, „I love you“ zu sagen; vor „Ich liebe dich“ scheuten sie zurück. Dahinter stand und steht eine kulturelle Selbstentfremdung, die zweifelsfrei eine Hitlerfolge ist und der die Forderung nach permanenter Ironie sehr genau entspricht. Es handelt sich um einen Rationalisierungs- also Abwehrprozeß von Schuld, die aber diese jungen Leute weder hatten noch haben überhaupt konnten. Doch ganze Wertecluster waren desavouiert: Ehre, Treue, Heimat und eben sogar die Muttersprache, jedenfalls da, wo sie ins Innerste geht und nicht nur funktional ist. Die Auswirkungen reichen uneingeschränkt ins Heute. Genau deshalb auch die Scheu vor dem Pathos, die dagegen ein US-Amerikaner so wenig kennt wie ein Südamerikaner oder Schwarzafrikaner; bisweilen ist diese Scheu pathologisch, also ein durchaus klinisches Symptom. Zugleich gibt es aber ein Bedürfnis danach, und man erfüllt es sich in der U-Musik und im Spielfilm, die aber eben ihrerseits meist nicht aus dem eigenen Land kommen. Die Filme aus dem eigenen Land (und eben die Literaturen) haben dagegen, wenn man sie anerkennen will, rationalistisch, ironisch, distanziert zu sein. Eine deutliche Ausnahme allerdings stellt das Werk Werner Herzogs dar. Es ist hingegen typisch, daß etwa Syberberg seine tatsächlich großen Erfolge im Ausland gehabt hat, nicht hier, wo man ihn schließlich als „reaktionär“ aus der Gesellschaft gebannt hat, ein Vorgang, der sich Jahre später mit Botho Strauß wiederholte. In der Musik jedenfalls, die meist U-Musik ist, goutiert man das Pathos allerdings genau so intensiv, wie man es in der Dichtung, so sie deutschsprachig ist, ablehnt. Im Fußball übrigens auch. Dieser Zusammenhang ist signifikant. Es wird eine scharfe Trennung zwischen der Dichtung und anderen Künsten vorgenommen, so daß wir fragen müßten, wie Dichtung eigentlich noch verstanden wird: als was man sie sehen will. Sie soll funktional sein; Botschaften vermitteln, kurz: auf säkulare Weise predigen. Dabei ist überhaupt nicht einzusehen, weshalb ein Dichter ein besserer Mensch sein soll als zum Beispiel ein Rockmusiker, dem man die Drogen ja ohne weiteres zugesteht; Stars wie Michael Jackson gestand man sogar den Kindesmißbrauch zu, im Innersten. Besonders problematisch scheint es aber zu werden, wenn Pathos und genaue Motivarbeit zusammenkommen; dann stimmt nämlich in der Wahrnehmung das sozialisierte System nicht mehr; die akzeptierte Codierung erleidet eine Störung. Denn man hat sich angewöhnt, Pathos mit Grobheit, Ungenauigkeit und vor allem mit tiefer Amoral, ja mit wesenhafter Bosheit zu assoziieren – wie gesagt: wenn es deutschsprachig grundiert ist. Auch dies ist eine Hitlerfolge. Es wurde akzeptiert, daß der Hitlerfaschismus die eigenen kulturellen Werte zerstörte. Hitler, hier ist dein Sieg!“ ruft einer von Syberbergs Protagonisten in dem großen Hitlerfilm aus. Man gesteht Hitler den Sieg zu und stellt sich damit auf seine Seite, merkt das aber gar nicht mehr oder hat es noch nie gemerkt. So groß war das Gefühl der Schuld an etwas, an der allerspätestens meine Generation eine Schuld gar nicht hatte noch hätte haben können. Schuld und historische Verantwortung wurden zu einem. Der westlichen, USA-geführten Hegemonialpolitik kam und kommt das restlos entgegen und wird von ihr nicht „nur“ ökonomisch genutzt. Für die folgenden Generationen, etwa der meines Sohns, spielt all das keine Rolle mehr, aber sie wurden von den so geprägten Eltern geprägt und tragen die deutsche Pathosscheu weiter, gegenüber dem Deutschen, nicht dem US-Amerikanischen, nicht dem Französischen, nicht dem Schwarzafrikanischen usw. usf. Genau aus dem Grund setzt sich die Pathosscheu auch bei jungen Kritikern fort. Sie hat sich, gegenüber dem Deutschen, über die Generationen hin als Tabu etabliert. Das „Deutsche“ meint hier das Deutschsprachige, nicht das Land selbst, nicht die Nation, die längst eine kulturell sehr viel gemischtere ist als es z.B. die USA sind; „gemischt“ im Sinne gegenseitiger organischer Einflüsse. „Multikulti“ ist ein ebensolch deutsches Neuwort wie „Handy“, und beides verzeichnet einen Sprachverlust, der aber als Gewinn erlebt wird: als einen Anschluß an den Sieger, den die eigentlich betroffene Generation „Befreier“ nannte, auch das schon leicht jenseits der historischen Wahrheit. Psychodynamisch gesehen hat man so selbst Anteil am Sieg. Freilich waren auch die Sowjets, den Hitlerfaschismus vor Augen, Befreier. Kaum einer aber nannte sie so, abgesehen von der DDR. Auch Frankreich und England sind uns als Befreier nicht wirklich im Bewußtsein; das Gefühl hält sie vielmehr für Handlanger der „eigentlichen“ Befreier. Nicht jene als die Bedrohten und wirklich Geschädigten haben gesiegt, sondern die USA. Sieger zu sein schließt aus, ein Opfer gewesen zu sein: Das ist die heimliche Botschaft. All diese und weitere Überlegungen, meine Irrtümer eingeschlossen, sind seit langem Grundlagen meiner Arbeit. Deshalb würde ich, so, wie man mir „Überorchestrierung“ vorwirft (ohne daß eine solche ästhetisch jemals begründet worden wäre, übrigens), bei sehr vielen anderen Texten deutscher Sprache von einer auffälligen Unterkomplexität sprechen, sprich: von dem Hang zur unangemessenen Simplifizierung – und zwar gerade, weil das, was ich Motivarbeit nenne, so gut wie gar nicht vorkommt. Außer in der Lyrik, allerdings. Doch die Romanliteratur, die seit Jahren, ja Jahrzehnten en vogue ist, hat in Deutschland die Moderne quasi durchgestrichen und ist poetologisch weit zurückgefallen, wenn‘s gut geht bis Keller. Es ist dies ein ungeheurer ästhetischer Regreß. Dagegen Autor:inn:en, die sich dem alten Anspruch, der einer der Kunst ist, gestellt haben und stellen, wurden und werden marginalisiert oder kommen in der öffentlichen Rede gar nicht mehr vor. Dem entspricht das Verfahren durchaus, U- mit E-Künsten als gleichwertig zu erachten, ja dies ist sogar ideologische Voraussetzung. Es handelt sich dabei in der Tat um Ideologie, um einen also säkularreligiösen Prozeß. Letztlich geht es um Profanierung. Eben sie ist die Voraussetzung für einen „rein“ pragmatisch handelnden Markt und die Reduzierung von allem und jedem auf tauschbare Ware, die Menschen inklusive, denen die Herkünfte weggeschnitten werden oder die sie sich selbst wegschnitten und -schneiden, manche aus Not, andere aus Überzeugung und/oder nicht erhaltener Bildung. Hier sticht jedenfalls nach wie vor Marx. Dem entspricht auch die allein aufs Ökonomische ausgerichtete Verschulung der Universitäten und die Abschaffung auch nur der Möglichkeit eines studium generale, kurz: die Mißachtung und sogar Verhöhnung ( „Bildungsballast“ !) kultureller, nichtpositivistischer Werte. Wenn die Bildungsinhalte selbst der eigenen Kultur nicht mehr vermittelt werden, ist in der Tat ein vielorchestriertes Kunstwerk nicht mehr verständlich. Genau das soll erreicht werden und wurde in Teilen schon erreicht. Wer noch komplex arbeitet, lebt in einem kleinen gallischen Widerstandsdorf, zwar ohne Zaubertrank (außer dem großen, freilich, der Schönheit), doch immerhin gibt es noch mehrere solcher Dörfer, sogar über Deutschland verstreut. Das ist gut, läßt eine Hoffnung. Denn gerade die Frage nach den Herkünften – sowohl kulturellen wie landschaftlich-klimatischen Heimaten, damit – ecco! – auch nach dem Boden – wird uns durch all die Fliehenden, die hier eine neue Heimstatt suchen, beschäftigen müssen. Die Diskussion jedenfalls, was „Überorchestrierung“ sei, wird nirgends geführt, nicht an prominenter Stelle, allenfalls in abgelegenen Grüppchen, deren Mitglieder für rückständige Nerds gehalten werden, nicht chic, nicht angepaßt genug. Es ist mir um so wichtiger, meine Position klarzustellen, wenn sogar schon ein vergleichsweise locker gebauter Roman wie >>>> Traumschiff für „schwer verständlich“ oder zu pathetisch gehalten wird. Wer in die Heime schaut und in die Hospize, hat es schwer, noch ironisch zu sein; Ironie dort wird umgehend zu Zynismus. Weil dem so ist, erleben wir das Phänomen der Verdrängung des Todes aus der Gesellschaft. Dem wäre anders, wüßten wir zu trauern. Auch Trauer schließt Ironie aus. Ganz wie die leidenschaftliche Liebe. Ein ironischer Orgasmus, in dem Moment, in dem er uns, durch uns, mit uns geschieht, ist nicht möglich. Extase ist nicht ironisch. Aber noch die Grundlage unserer Art – bis uns auch hier die Technik entfremdet haben wird und Zeugung wie Empfängnis zu „Aufgaben“ der Industrie geworden sein werden, fern der körperlichen, die in der beiderseitigen Extase immer auch eine geistige ist, Vereinigung. „Ergriffen sein!“ lautet eine Stelle >>>> bei Schoeck. ANH, 6.11.2015 Berlin [Poetologie.] albannikolaiherbst - Freitag, 6. November 2015, 14:02- Rubrik: Arbeitsjournal
ANH spricht Die Schwangere (2008).Alban Nikolai Herbst Die Schwangere (2008, unveröffentlicht) albannikolaiherbst - Freitag, 6. November 2015, 08:21- Rubrik: Videos
ANH spricht zur Lage der Kritik. In der Nacht des 6. Novembers 2015.albannikolaiherbst - Samstag, 7. November 2015, 09:41- Rubrik: Videos
Zum 100. Tag: ANH spricht M e e r e (2003/2008). 1.aus:   Alban Nikolai Herbst Meere Roman mare 2003 Axel Dielmann Verlag („Persische Fassung“) 2008 [>>>> Bestellen.] albannikolaiherbst - Sonntag, 8. November 2015, 08:52- Rubrik: Videos
„So hat sich der Kapitalismus in ein kriminelles System verwandelt.“ANH 16 Uhr albannikolaiherbst - Mittwoch, 11. November 2015, 16:03- Rubrik: Rueckbauten
TRAUER FÜR PARISKein Arbeitsjournal.
Kein Eintrag. Dschungelstille über den weiteren Tag. ANH, 8.38 Uhr. (Ich mag jetzt auch die morgige Veranstaltung in Braunschweig nicht ankündigen. Sehen Sie einfach rechts auf die "Ereignisse"-Liste). albannikolaiherbst - Samstag, 14. November 2015, 08:38- Rubrik: Arbeitsjournal
The BoxSie stand noch an der Box
Es ging zu schnell und doch nicht schnell genug Sie federte schon weg, als er sie an sich riss Ihr rechtes Ohr vorübergehend zwischen seinen Zähnen. Sie machte sich los und rannte die Treppe hinauf Schmückte die Schläfen sich mit den Blüten des süßduftenden Majorans Nahm den Schleier der Braut und kam her Den weißen Kuss zwischen den roten Lippen. findeiss - Montag, 30. November 2015, 00:16- Rubrik:
|
|