Verschlüsselung im Roman. Notwendigkeit und Absicht.
Eigner vorhin: „Vielleicht wieder so schreiben, wie D u es immer gemacht hast: Verschlüsseln, bis kein Mensch auch nur a h n e n kann, daß solche Leben wirklich gelebt werden.“
Dahinter verbirgt sich ein Irrtum. Ich mußte verschlüsseln, weil mein Name im Literaturbetrieb tabuisiert war; ich d u r f t e nicht unter ihm veröffentlichen, mußte ihn also verstecken und damit mich selbst. Das hatte Folgen für die Poetologie. Die deshalb nicht falsch ist; vielmehr behauptet sie Reales: man m ü s s e sich tarnen. Das wird als soziale Aufgabe an einen herangetragen. (Deshalb meine theoretischen Arbeiten zur Desinformation.)
Mit der Geburt meines Sohnes, der wieder meinen alten Namen trägt, war diese Bewegung hinfällig. Sie wäre nun keine Selbsterfindung mehr geblieben, sondern wäre zur Spaltung geworden. Das beschreibt unter anderem das verbotene Buch. Ich gehe immer auf den K e r n, stelle immer den realen Prozeß dar. Genau das aber ist nun gerade nicht erwünscht, und schnell erweist es sich, siehe den Prozeß um diesen Roman, daß die „ursprüngliche“ Poetologie vollkommen berechigt war, und zwar g e r a d e, weil man ihr immer ihre Verschlüsselung vorwarf. Man wollte weiterhin strafen, abstrafen, wollte Schuldloses strafen, aber so, daß niemand begreift, d a ß man das tut. Wollte Schaden zufügen, ohne verantwortlich zu sein. (Ich meine nicht den prozessualen Gegner des Romanes, sondern die Mitläufer, die das Verbot so begrüßten; sie nämlich sind von ihm eigentlich getroffen. Und s i e hat er ja auch wirklich gemeint. Und wird er weiter meinen.)
[Letztlich ist die Diskussion jedoch müßig: Jedem einigermaßen mit Intellekt Begabten ist es höchst einfach, den Schlüssel ins Loch der Romane - irgend eines Romanes! - zu stecken und darin herumzudrehen; wie bei einer lockeren mathematischen Aufgabe ergibt sich die außerpoetische Lösung immer von selbst. Die poetische Strahlkraft hingegen bleibt, so oder so, Geheimnis.]
Dahinter verbirgt sich ein Irrtum. Ich mußte verschlüsseln, weil mein Name im Literaturbetrieb tabuisiert war; ich d u r f t e nicht unter ihm veröffentlichen, mußte ihn also verstecken und damit mich selbst. Das hatte Folgen für die Poetologie. Die deshalb nicht falsch ist; vielmehr behauptet sie Reales: man m ü s s e sich tarnen. Das wird als soziale Aufgabe an einen herangetragen. (Deshalb meine theoretischen Arbeiten zur Desinformation.)
Mit der Geburt meines Sohnes, der wieder meinen alten Namen trägt, war diese Bewegung hinfällig. Sie wäre nun keine Selbsterfindung mehr geblieben, sondern wäre zur Spaltung geworden. Das beschreibt unter anderem das verbotene Buch. Ich gehe immer auf den K e r n, stelle immer den realen Prozeß dar. Genau das aber ist nun gerade nicht erwünscht, und schnell erweist es sich, siehe den Prozeß um diesen Roman, daß die „ursprüngliche“ Poetologie vollkommen berechigt war, und zwar g e r a d e, weil man ihr immer ihre Verschlüsselung vorwarf. Man wollte weiterhin strafen, abstrafen, wollte Schuldloses strafen, aber so, daß niemand begreift, d a ß man das tut. Wollte Schaden zufügen, ohne verantwortlich zu sein. (Ich meine nicht den prozessualen Gegner des Romanes, sondern die Mitläufer, die das Verbot so begrüßten; sie nämlich sind von ihm eigentlich getroffen. Und s i e hat er ja auch wirklich gemeint. Und wird er weiter meinen.)
[Letztlich ist die Diskussion jedoch müßig: Jedem einigermaßen mit Intellekt Begabten ist es höchst einfach, den Schlüssel ins Loch der Romane - irgend eines Romanes! - zu stecken und darin herumzudrehen; wie bei einer lockeren mathematischen Aufgabe ergibt sich die außerpoetische Lösung immer von selbst. Die poetische Strahlkraft hingegen bleibt, so oder so, Geheimnis.]
albannikolaiherbst - Montag, 3. Januar 2005, 20:12- Rubrik: Arbeitsjournal
































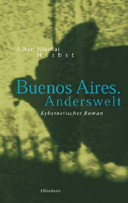






Trackback URL:
http://albannikolaiherbst.twoday.net/stories/459551/modTrackback