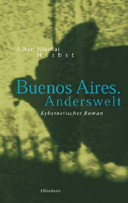|
|
„Bitte haben Sie ’ne kleine Spende.“ Auf einer Tonhöhe permanent wiederholt. So schleicht jemand heran und stützt sich auf den Stock mit der Rechten, in der Linken einen leeren Pappbecher haltend, und zwar so schräg, als sollte er ausgekippt werden. „Bitte haben Sie ’ne kleine Spende.“ In einem fort, wie ein Priester die katholische Messe deklamiert, nur sehr viel leiser. Gerade w e i l so leise gesungen wird, ist der Mann unentwegt zu vernehmen, durch den schleifenden Krach der ein- und ausfahrenden Züge hindurch. Es m u ß irgendwann geben, wer sensibel ist. Auch wenn man weiß, es ist für diesen Menschen eigentlich gar nichts, vielleicht ein Bier. Aber nach Trinker sieht er nicht aus. Und wem alles wäre sowieso und ständig zu geben!
Er bedenkt sich mit „Gottes Segen“. So etwas habe ich lange nicht mehr gehört. Er wiederholt es: „Gottes Segen“. Zuletzt sprach mir das jemand in Catania, auf den wenigen Stufen zu S. Michele Arcangelo, via Etnea. Aber hier ist es nicht eine von morbus bechterew Gebrochene, sondern ein alter Mann, der arm, doch nicht obdachlos wirkt. Und wie uns allen, den Fahrgästen, das peinlich ist, als er mit einstieg und nun immer weiter wiederholt „… bitte haben Sie ’ne kleine Spende“! Wie wir zu Boden sehen, jedenfalls wegschaun! Als brächte dies das Elend, und schützte uns vor ihm, zum Schweigen. [In der S-Bahn. 10.50 Uhr.
Aus dem Notizbücherl.] albannikolaiherbst - Freitag, 1. September 2006, 13:09- Rubrik: LOYOLA
"Ich konnte die Erfahrung machen, daß kein einziger Mensch
von Musik besser wird. Die größten Schurken, die ich gekannt habe,
waren tief muikalisch. Kunst ist irrational, das läßt sich nicht verleugnen.
Etwas birst in einem, und man beginnt zu singen."
Allan Pettersson.
„Er ist solch ein Schwein! Wie darf er da eine solche Musik schreiben können?“
Tränenüberströmt saß die Frau noch immer da und zitterte. Niemand bemerkte sie, da sie sitzengeblieben war unter der Tausenden, die standen und dem Podium Ovationen brachten. Es war der 2. November 2005, Carnegie Hall. Wieder und wieder kam der Trompeter heraus, kam auch sein Team heraus: George Dewell (synth.), Michelle Personne (voc.), Nasrath Khan Anaswami (dr.), Wilm van’t Houven (bs.). Und der ganze Chor wurde immer wieder hinaufgeschickt, The Lord's Choir, der ihn eingeladen und dessen Vorstand ihm diese „Madrigals of Time“ in Auftrag gegeben hatte, die nun etwas geworden waren, das so noch nie jemand gehört zu haben schien. Und vielleicht wirklich noch nie jemand so gehört hatte. Müller habe dem Klangkörper, schrieb tags darauf ein Kritiker, Klänge verliehen von Jenseits. Es ist offenbar, daß er nicht gewußt hat, wie wahr sein Satz auf eine ganz andere, eine radikal reale Weise war.
Gesualdo Müller verbeugte sich nicht, nicht e i n Mal, stand nur da und ließ den Jubel über sich. Unberührt sein Gesicht, unberühr bar. Man kann fast sagen, er sei geekelt gewesen, so beherrscht der ganze Ausdruck des Mannes. So leidvoll imgrunde auch, so unfrei, so geworfen und getrieben zugleich. Und so hoffärtig. Schon daß er seiner kleinen Band diesen Namen gegeben hatte - „Gesualdo Müller Group“ - und sich selbst, kurz nachdem er sein erstes Opfer gefunden, zeigte das; wie verächtlich es war, daß niemand nachfragte. Wußte denn keiner, wer Gesualdo di Venosa gewesen war? Der Mörder hätte die Fotografien seiner blutigen Session vorlegen können, man hätte gesagt: Das sind Montagen. Er war sich dessen sicher, er war so voller Verachtung. Er hatte schon die nächste Musik von Jenseits im Kopf, das ging darin hin und her, stürmisch, böse, man konnte gar nicht anders, als sich zu beherrschen. Ein Weinen schwang darin mit, das Weinen dieser Frau, die in der vierzehnten oder fünfzehnten Reihe saß und sich noch immer schüttelte in ihren Krämpfen, wie eine von Fieberwellen überrollt wird, noch und noch. Hätte Gesualdo Müller sie bemerkt, aber das tat er nicht, er hätte gedacht: Erlöserin. Doch er hörte ihre Stimme, eine Sirenenstimme, in seiner inneren Musik. Und komponierte sie bereits hinein. albannikolaiherbst - Freitag, 1. September 2006, 05:49- Rubrik: PROJEKTE
zähl’ abends aus dem Pappebecher
mir Gottes Kleingeld auf den Segen
für mein lahmes Bein den wunden
Stock über den alten Schenkeln
sitz ich in Bier und dicken Schals
schmal an der Kippe fröstelnd zieh ich
an gelbgewordnen Fingerkuppen
und zähle Gottes Segen mir
um den ich ging und bat
(Es hustet Bröckchen Schleim
auf alle deine Gaben
ein solcher Bursch war ich
den liebten zweidrei Frauen
und hockt heut mürb. Und spuckt.)
albannikolaiherbst - Samstag, 2. September 2006, 23:16- Rubrik: Gedichte
Dem Monteur Beliebigkeit vorzuwerfen, das ist so, als klagte wer R. L. Stevenson an, Jeckyll nicht gerettet zu haben. Der würde ja lachen. Oder Poe. Bei Kafka ist es schwieriger, der glaubte sich selbst nicht, deswegen mußte er immer wieder Parabeln schreiben, auf daß ihm ein andrer den Sinn sagte. Übrigens auch eine Form der Montage: ein Rätsel erfinden, ohne zu wissen, ob es eine Lösung gibt, - - und andre schreiben sich die Finger dran wund. Das ist dann die Lösung des Rätsels.Montage 1 <<<<
albannikolaiherbst - Samstag, 2. September 2006, 23:08- Rubrik: Arbeitsjournal
Indessen wagt er hier mindestens gleich viel in einer „Tonalität jenseits der Tonalität“ u. a. in dem Sinne, daß diese Komplexe – wie schon das fixsternhaft unbewegliche h-moll zeigte – wohl „bedeuten“, nicht aber mehr in harmonischen Strebungen und Verhältnissen wahrgenommen werden können, eher neugefunden als erinnert und heraufgeholt. Derlei latenter, schwer durchschaubarer Avantgardismus kennzeichnet auch die scheinbar ganz in sich versunkene, weitausgesponnene Episode der Streicher, mehr Idee eines brucknerschen oder mahlerschen Adagios als ein solches selbst, eher Sehnsucht danach als Realisierung (… -)… erst, da sie sich entzieht, erst, wo sie heraustritt aus dem engeren Bereich ihrer Nützlichkeit, wird die Melodie, wenigstens in ihrer präsumptiven Schlußwendung, kenntlich und greifbar.>>>> Notizen zu Allan Pettersons Siebenter Symhonie.[Poetologie.] >>>> ARGO 264
ARGO 262 <<<< (Es hat Gründe, weshalb hier Nähe empfunden wird.)
>>>> AP 7
AP 5 <<<<
albannikolaiherbst - Samstag, 2. September 2006, 12:43- Rubrik: HOERSTUECKE
Von Tullius. >>>> Hettche auf platz 1 der swr-bestenliste. wen muß man da schmieren?An Tullius. Man muß nur gut situiert sein im Betrieb. Jemanden zu schmieren ist da gar nicht nötig. Aber ich gönn es Hettche. Und vielleicht ist sein Buch ja wirklich gut. Ich selbst kümmer mich weiter um Die Dschungel und ihre Ästhetik. Um die Bamberger Elegien und um Argo. Daß ich wie Pettersson - allerdings vitaler und sehr sehr viel glücklicher als der - ästhetischer Außenseiter bin, ist doch ohnedies klar. Und wird sich nicht mehr ändern. (In "Lettre", berichtete mir Do, habe es einen langen Artikel zu Weblogs gegeben. Völlig klar, daß Die Dschungel nicht drin vorkamen – egal, >>>> welche Zugriffzahlen sie unterdessen haben.)
[Hammerhart und politisch mehr als bezeichnend übrigens d i e s e r, >>>> >>> die Kritik abschließende Satz aus der FAZ: „Über das Amerika, das unvermeidlich zu dem Stoff gehört, aus dem wir gemacht sind.“ Wen meint der Autor des insgesamt sehr intelligenten Artikels? Sich selbst? Diese Dschungelfrage bezieht sich auf die mitschwingende Affirmation des stattgehabten antieuropäischen Kulturverrats. Wir selbst, Die Dschungel, beharren auf dem europäischen, d.h. a u c h: auf dem orientalischen Erbe. An anderer Stelle ging ich auf den „Stoff, aus dem wir gemacht sind“ bereits ein, also daß die meisten von uns in den nächsten Dingen, etwa der Liebe, US-amerikanisch sozialisiert wurden: „I love you“ wurde zum Gesang auch des deutschen Herzens und nicht etwa „Ich liebe dich“.]Korrespondenz - Samstag, 2. September 2006, 08:52- Rubrik: Korrespondenzen
Gegen den Krieg zu sein - eine Selbstverständlichkeit -, enthebt uns nicht zu schauen, >>>> wo und weshalb in jedem Krieg Existenz näher berührt wird als im zivilen Leben. Enthebt uns nicht zu sehen, daß Extremsituationen uns mit ‚ursprünglichen’ Energien weitergehend konfrontieren, als jeder Alltagsablauf das könnte, der von diesen Energien absehen will, obwohl sie permanent in uns wirken. Die Beschäftigung mit Kriegssituationen und das Bewußtsein, daß wir unterdessen (auch wenn wir es nicht merken, bzw. nicht merken wollen) in einer von ihnen s i n d, hebt Verdrängtes ins Bewußtsein zurück. Erst nun, uns selber wieder näher kommend, kann es bearbeitet, d.h. ein angemessener Umgang mit ihm gefunden werden. Dies gilt ganz besonders für die Umgang mit Sexualität und unter der kultivierten Decke gehaltenen Sexualfantasien, deren Wirken uns selbst eigentlich völlig unbestritten ist, die wir aber dennoch nicht zugeben wollen, weil wir mit Recht befürchten, es fiele sonst der Schutzraum unserer Sublimationen in sich zusammen. Das Gleiche gilt für aggressive Impulse, die wir selbstverständlich haben, ohne die wir auch gar nicht leben könnten, die aber dennoch genau dem widersprechen, was Kultur uns vormacht, daß es ‚human’ sei. In einer geschichtlichen Größenordnung * ist dies das, was Adorno und Horkheimer Dialektik der Aufklärung nannten; es gibt ganz ebenso - es ist die psychische Entsprechung – eine Dialektik der sie schöpfenden und hemmenden Bewußtseins- und Instinktsenergien, deren eine das vorantreiben, was deren andere zugleich einzäunen. [Poetologie.]
[*) Man ist an Freuds berühmtes Postulat >>>> aus dem Mann Moses gemahnt: „Wenn wir den Fortbestand solcher Erinnerungsspuren in der archaischen Erbschaft annehmen, haben wir die Kluft zwischen Individual- und Massenpsychologie überbrückt, können die Völker behandeln wie den einzelnen Neurotiker. Zugegeben, daß wir für die Erinnerungsspuren in der archaischen Erbschaft derzeit keinen stärkeren Beweis haben als jene Resterscheinungen der analytischen Arbeit, die eine Ableitung aus der Phylogenese erfordern, so erscheint uns dieser Beweis doch stark genug, um einen solchen Sachverhalt zu postulieren.“ Damit im Zusammenhang >>>> Ernst Bloch, Erbschaft dieser Zeit: „Nichts befreit daher vom Untersuchen der Begriffe, die der Nazi zum Zweck des Betrugs, aber als eines zu endenden, so entwendet wie verwendet hat. Führer, vor allem Reich tauchen derart auf, und wird ihrem ursprünglich zu endenden Sinn nachgegangen, so tauchen sie in anderer, in nachdenklicherer Weise auf, als das zuletzt gewohnt war. Der Stoff ist noch großenteils frisch, desto fauler gerade ist und mußte werden, was Blindheit und Verbrechen mit ihm angestellt haben. Das etwas träumerische Wesen der Sache war überdies gegen Mißbrauch schon des öfteren wehrlos. Aber auch Schönes und Edles leuchtet aus verschollenen, nicht verschollenen Tagen herüber, es ist wichtig, daran zu erinnern.“]albannikolaiherbst - Samstag, 2. September 2006, 08:15- Rubrik: NOTATE
Einigen begann zu dämmern, daß eine historische Epoche bevorzustehen scheint, in der ausgewählt werden muß, in der die Auswahl aus der Vielfalt der uns umgebenden Kulturen aber nicht mehr durch ein allgemein gewordenes ästhetisches Konzept abgesichert werden kann, sondern nur noch sich aus den Konzeptionen des einzelnen Künstlers erklärt.Die vielkritisierte Theoriemüdigkeit unserer Zeit ist allein der Tatsache zuzuschreiben, daß Theorie in weitestem Sinne Verbindlichkeiten voraussetzt, von denen heute keine glaubhaft bleibt. >>>> Manfred Trojahn, (vorläufiger) Abschied von Allan Pettersson.
[Also: >>>> Glaubenskriege. Zumal in einer auch ästhetisch globalisierten Epoche. Politisch gewendet, führt die von Trojahn markierte Notwendigkeit der Auswahl zu einem Überschuß dort, wo Macht am stärksten ist; Macht in diesem Sinn bedeutet auch G e s c h m a c k s m a c h t, ganz unabhängig von der der moralischen Normation, die sich zur Zeit zwischen dem Islamismus und dem säkularen Christentum austobt, die beide extrem hegemonial orientiert sind und ihren Krieg bezeichnenderweise auch nach innen führen, nämlich moralisch innerhalb der je eigenen Kultur. Kunst und Politik (Moral) sind hier einander wechselseitig Spiegel.]
>>>> AP 8
AP 6 <<<<
albannikolaiherbst - Sonntag, 3. September 2006, 11:21- Rubrik: HOERSTUECKE
>>>> Aber das Argument, dass Gehirnunterschiede Unterschiede im Verhalten oder in den mentalen Fähigkeiten produzieren grenzt an den biologischen Determinismus. Einen Unterschied einer „biologischen“ Ursache zuzuschreiben impliziert, dass er unveränderbar und permanent ist, was aber nicht der Fall ist. Biologische Faktoren und persönliche Erfahrungen führen in ihrer Kombination zu einem bestimmten Verhalten.Ilka Sommer, Biologische Erklärungsansätze.
So aufschlußreich dieses Hypothesen und empirische Ergebnisse summierende Referat auch ist, gegen Ende schiebt sich auch hier ein unklares Denken hinein, das >>>> enthymemisch moralpräformiert ist. Denn tatsächlich sind „persönliche Erfahrungen“ ebenfalls Faktoren von Determination des je Einzelnen, der zu seinen Erfahrungen ja durchaus nicht aufgrund einer sog. freien Wahl gekommen ist. Daß soziale Determination eine biologische modifiziert, ist unbestritten; zusammen e r g e b e n sie aber überhaupt erst das Netz der Determinierung – zusammen allerdings mit, wie ich es nenne, fiktiven Determinanten, nämlich kulturell wirkenden wie etwa der Vorstellung (= dem Glauben daran), man verfüge über einen ‚freien Willen’. Die Kehrseite davon ist die Ergebung in ‚Gottes Ratschluß“.
Unnötig, hoff ich, darauf hinweisen zu müssen, daß diese Bemerkung >>>> hiermit eng verschränkt ist. Allein die unterdessen erwiesene Tatsache, daß Frauen sich ihre männlichen Geschlechtspartner je nach dem gerade zu befriedigenden Bedürfnis aussuchen (für Affären und oft auch als genetische Väter Männer mit hohem Testosteronspiegel, für eine Beziehung und soziale Väter aber eher solche mit einem niederen *), zeigt auf wechselweise Determination. Zeigt auch die Ausgeliefertheit von Männern mit hohem Testosteronspiegel an die Triebe, und zwar je nachdem, wie hoch ihr „sozio-ökonomischer Status (SES)“ ist. Hierbei ist zusätzlich zu berücksichtigen, daß es Männer von erblich präformierten sehr unterschiedlichen Hormongraden gibt. [*) Wozu auffällt, daß Männern, die geheiratet haben, der Testosteronspiegel signifikant sinkt, ebenso wie bei Männern, die Väter wurden. Selbstverständlich handelt es sich dabei um statistische Mittelergebnisse; es gibt auch Männer, deren Testosteronspiegel – sogar bis ins Alter – vergleichsweise hoch b l e i b t; das sind dann diejenigen, die gesellschaftsmoralisch die Arschkarte ziehen. Eine Moral, die derartiges nicht mit ins Auge faßt, kann mitnichten als moralisch angesehen werden, sondern besteht rundum auf zum Teil bewußt inszenierten (und internalisierten) Vorurteilen, die das Gesellschaftsinteresse, nicht aber ‚wirklich wirkende’ Dynamiken im Auge haben.]
albannikolaiherbst - Sonntag, 3. September 2006, 10:11- Rubrik: FrauenundMaenner
Die Annahme, es werde Gewalt durch diejenigen ausgelöst, die öffentlich über sie nachdenken oder ihre Erscheinungsformen gestalten, verschiebt die Gründe von Gewalt auf ihre Darstellung: Sie soll verheimlicht bleiben, Gewalt selbst, vor allem aber sollen es jene. Dabei ist es letztlich sehr ungesichert, ob ein gewaltverherrlichender Film auch nur die Bereitschaft zur Gewaltausübung lockert oder ob nicht vielmehr umgekehrt die Bereitschaft immer schon da und einerseits (Aggressivität) über die Art vererbt ist, die sich erhalten will, und andererseits aus erlittener Erfahrung scharfgemacht wurde – und unscharf, eben in der Rezeption etwa „gewaltverherrlichender“ Medien, seinen Ausgleich sucht, nämlich je nach persönlicher Bildung (die wiederum nicht vom Individuum verschuldet ist *) in Action und/oder Horror und/oder harter Pornografie oder ( und/oder auch hier!) in der Kunst. Hinzu kommt, daß ein solcher Ausgleich von gewaltkritischer Darstellung, indem sie dennoch gestaltet wird, ebenso erreicht wird wie von gewaltaffimativer. In Hinsicht auf das, was wir sehen (empfinden), spielt die Absicht der Darstellung gar keine Rolle. Wer also gewaltverherrlichende Filme verbieten lassen will, weil sie vorgeblich die aktive Gewaltbereitschaft erhöhen, muß im selben Moment j e d e Form der Gewaltdarstellung verbieten, also auch die kritische und solche, die eindeutig der Kunst zugehören. Es wird dann ein internalisiertes Schweigetabu zur gesellschaftsmoralischen und möglicherweise strafjustiziablen Norm. Dasselbe gilt für pornografische oder sonstwie an Sexualität gebundene Darstellungsformen. Der (sehr gute) von mir bereits besprochene Spielfilm >>>> „Irreversible“ ist dafür ein exquisites Beispiel. Die darin ausführlich inszenierte Vergewaltigungsszene ist zugleich erschreckend, wie sie doch eine bereite Gewaltlust befriedigen und, sollten die Verdränger recht haben, >>>> „geistig labile Menschen“ dazu bringen kann, ein solches Verbrechen zu begehen. S o gelesen, wären aber auch dezidierte Anti-Kriegsfilme letztlich Kriege befördernde Filme. Graduell abgestrichen, gälte das dann für die entsprechende Dichtung ganz genau so, zumal die der antiken Klassik, aber auch für die Bibel, die von Gewalt- und Ausrottungsfantasien gerade im Alten Teil viel weitergehender strotzt als etwa der Koran, der sich allerdings auf das Alte Testament immer wieder deutlich bezieht.
Die Alten hatten zu alledem ein klügeres Verhältnis: Sie wußten sehr wohl, daß der Schrecken „reinigend“ ( kathartisch) auf den Betrachter wirkt, daß gerade die Konfrontation mit ihm es ist, was zivilisiert. Die political correctness will das absichtsvoll vergessen machen, weil sie letztlich in j e d e r ihrer Ausformungen (das heißt auch in derjenigen einer „gender correctness“) absolut unterm Diktat eines demokratischen Kapitalismus’ steht, dem es um Mehrwertschaffung und n u r um Mehrwertschaffung geht. Wir wissen etwa unterdessen von Hans Christian Andersen und Lewis Carroll, daß sie starke pädophile Neigungen hatten; beide würden heute mit großer Sicherheit an den Publikationen ihrer Erzählungen gehindert werden, die gleichwohl zu den tiefen poetischen Schätzen der Weltliteratur gehören. Der Einwand des unmoralischen Einflusses beträfe übrigens ebenso Nabokovs berühmtes Lolita-Buch, das s o, anders auffälligerweise als in der McCarthy-Ära, heute nicht mehr erscheinen könnte. Insgesamt wirkt jetzt ein auf verteufelte Weise sich für ‚human’ erklärendes Reaktionäres in den Menschen, insbesondere in der privaten Zensur und Selbstzensur. Dem geht global die Tendenz zu Glaubenskriegen völlig parallel, sowohl hie wie da.
Insoweit eine öffentliche Auseinandersetzung mit geschädigten Moralnormen (etwa anhand von BDSM, von aggressiven/submissiven Tendenzen im Sexualleben oder zum Beispiel weiterwirkenden Instinkten und deren Bejahung) für „kinderverdebend“ erklärt wird, begibt der Kritiker sich in die Rolle eines Zahnarztes, der nicht etwa heilend eingreift, sondern der Karies moralisch v e r b i e t e t zu sein und, ist Karies ausgebrochen, den Patienten dafür vor Gericht zerrt. Die Suche nach Gründen wird durch das moralische Verdikt ersetzt, wodurch dann letztlich das objektiv begründete erst richtig, nun aber verborgen, durchgreifen kann. Dahinter steht letztlich magisches Denken: wenn ich etwas beschwöre, daß es nicht sei, dann werde es auch nicht. Und schaffe sich gleichsam religiös ab.
[*) Und zwar weder, wenn man an angeborene „Begabung“ glaubt, noch wenn man das nicht tut oder meint, b e i d e s wirke hier: Sozialisation u n d Genetik; der Genetik entspräche für Sexualität die testosteronale Verteilung, die unter Männern selbst signifikant unterschiedlich ist, ihrerseits auf eine gedämmte oder befeuerte Aggressionsbereitschaft wirkt und besonders bei jungen Männern hohe Konzentrationen aufweist: aus diesem Grund werden besonders ‚gerne’ Soldaten eingezogen und eingesetzt, die sich an der Schwelle einer beginnenden Männlichkeit befinden, zu der schließlich das Vaterwerden gehört. Dieses darf noch nicht faktisch erreicht sein, muß aber biologisch auf der Schwelle stehen; den ‚Halbstarken’ wird dann vermittels eines sie scharf kanalisierenden militärischen Apparats – verstärkt von der lebensbedrohenden Situation, in der sich aktive Kämpfer befinden – Sexualenergie in Mordbereitschaft, ja Mordwille herumgedreht. D a s ist - dieses Wort im banalen Allgemeinverständnis und nicht im erkenntnis- und kunsttheoretischen Sinn verwendet - pervers, nicht hingegen der durch pornografischen oder Action-Konsum erstrebte, wahrscheinlich sogar mildernde Versuch, die inneren Kräfte zu beruhigen. Geschweige denn die Anstrengung, sich gestalterisch und denkend den in uns wirkenden Kräften zu nähern und uns ihnen zu stellen, sowie sie dadurch zuzugeben.] albannikolaiherbst - Sonntag, 3. September 2006, 07:53- Rubrik: Krieg
Dieser Satz erklärt unabwendbar, weshalb das Glück wenn überhaupt je, so immer nur mißlingend in der Kunst aufscheinen kann oder weshalb, wenn es gelungen aufscheint, das Kunstwerk in höchster Kitschgefahr ist. Kaum je entkommt es ihr. Sondern der Wirkmechanimus aller Kunst ist, wie bereits an anderen Stellen – u. a. >>>> in dieser Diskussion - vermerkt, einer der Perversion, der „Herumdrehung“ von Leid, der es auf bewundernswerte Weise gelingt, dem Innern einen erlittenen, oft grundlegend traumatisierenden Schmerz derart umzuformen, daß ein Gegenstand des ästhetischen Genusses daraus ersteht: sei es der Warnung, sei es der Hoffnung. Die eigene Gestaltungskraft, der die Wahrnehmungshaltung des Rezipienten entspricht, übernimmt gleichsam die Kraft des Unglücks – und diese Verfügung über etwas, das bis zur Unaushaltbarkeit über einen selbst verfügte oder zu verfügen droht, schafft den Genuß.
Dies erklärt die Bedeutung der Kunst in nahezu jeder bekannten Kultur, dies erklärt aber auch ihre Ohnmacht gegenüber der tatsächlichen Welt. Denn die Anstrengung sowohl des Gefühles wie des Verstandes, die für die Aufnahme eines Kunstwerks beide entbunden werden müssen, entsprechen sehr wahrscheinlich der ursprünglichen Stärke der schädigenden Ereignisse, bzw. Kraft. Das Erhabene, das wir in Kunstwerken spüren, ist von daher in keiner Weise ein mimetisch Natürliches, sondern geradezu das Gegenteil. Da das Schädigende letztlich immer ein Unbegriffenes ist, ein Unbegreifbares sogar, bleibt in jedem Kunstwerk ein ebenso nichterklärbarer „Rest“. Dieser aber macht es ganz ungeeignet für etwa die politische Aktion. Deshalb gibt es - in funktionalem Sinn - keine politische Kunst (wohl aber Kunst mit politischem Inhalt). Wann immer hingegen Kunst versucht, faktische Mißstände zu beseitigen, scheitert sie entweder als Aktion, nämlich an ihrer eigenen 'restlosen' Funktionalität, oder aber an sich selbst und wird abermals im besten Fall Kitsch. So auch mit Gedichten an die erlangte Geliebte. Liebesgedichte brauchen Sehnsucht, Liebesromane genauso.
Daraus, daß Kunst ein - d e r - Verarbeitungsmodus des Menschen ist und als solcher einzigartig, bezieht die Kunstfreiheit ihr hohes Recht. Schränkt man sie ein, schränkt man den Menschen ein. Als einer A r t, die sich ausdrückt. Und man nimmt ihr, insgesamt, die utopische Fiktion der Erlösung, die in jedem Trauergesang mitschwingt: als hörte ihn jemand.
(CCCCXVI). albannikolaiherbst - Montag, 4. September 2006, 15:31- Rubrik: Paralipomena
Wenn man den persönlichen Schrecken überwunden und Kunst daraus gemacht hat, dann wird es Botschaft. Zitiert nach Manolova in >>>> Allan-Pettersson-Jahrbuch 1988.[ICE Berlin-Bamberg. Bei Petterssons Sechster unter Trojahn.] >>>> AP 9
AP 7 <<<<
albannikolaiherbst - Montag, 4. September 2006, 09:37- Rubrik: HOERSTUECKE
Zur Musik: Ein Leitmotiv, eine musikalische Petterson-Geste wählen, die sich ostinat durch das Hörstück zieht. Nicht aus der VII, das wär zu naheliegend, sondern etwa aus IX oder XIII wählen. Etwa: Pettersson IX, Take 8, ab 4:20.
BESETZUNG
Sprecher I alter Mann (ich hätte gern Peter Lieck).
Sprecher II alter Mann (ich hätte gern Otto Mellies).
Sprecher III Mann um die 35.
ANH als er selbst und aus den Jugend-Archiven.
Sprecherin Stimme der Sehnsucht (Antje von der Ahe?).
___________________________________________________________________
G e s t e .
Aus ihr entwickelt sich überschneidend:
Thema I
Meer, Tropen vielleicht, Vögel, Gerede von Menschen (aus den Indien-O-Tönen nehmen und sie mit den Israel-Stimmen aus dem Jerusalem-Stück mischen).
G e s t e weg.
Jemand schreitet auf Kies oder Sand. Langsame Schritte. Erst einmal nur Naturlaut, durchsetzt von dem Geplapper und vielleicht dem nicht ganz leichten Atmen des Mannes. Er steckt sich eine Zigarette an. Dann, von sehr sehr ferne, fast unhörbar:
Einspielung: Pettersson VII, 21:45.
Darüber:
Ansage: Für Allan Pettersson. Von Alban Nikolai Herbst. Ein Radio-Requiem in rhapsodischer Manier. Ton und Technik: ….. Redaktion: Bernd Leukert.
Pettersson VII leicht aufdimmen, aber es darf nur eine Ahnung werden unter den O-Tönen. Bei 22.50 werden
Thema II
die O-Töne ausgetauscht, aber schleichend alles, legato.
Treppenhaus. Jemand steigt die Stufen hinab, Anspielung (oder, falls wir ihn besorgen können, Zitat aus Berggrens Pettersson-Film). Stöhnen unterdrückten Schmerzes. Knarren. Usw.
Thema I geht in Thema II über. Wenn sich das akustisch aufgebaut hat (immer die Musik, ihren Linien folgen, nichts ‚umkomponieren’), eine ähnliche Bewegung in
Thema III
Einspielung O-Ton: U-Bahn (Berlin), laut. Man ahnt die Musik immer weiter.
Bettler (O-Ton) Entschuldigen Sie die Störung. Ich verkaufe den Straßenfeger, das ist die Zeitung eines Selbsthilfeprojektes für Obdachlose. Der Straßenfeger kostet zwei Euro, ein Euro ist für mich, ein Euro für das Projekt. Ich wäre Ihnen aber auch für eine kleine Spende dankbar. (usw.)
Schlurfen des Bettlers, vielleicht Husten, Zeitungsrascheln, akustisches Wegsehen.
>>>> AP 12
AP 10 <<<<
albannikolaiherbst - Dienstag, 5. September 2006, 18:49- Rubrik: HOERSTUECKE
albannikolaiherbst - Dienstag, 5. September 2006, 13:46- Rubrik: Arbeitsjournal
Erstaunlich ist, daß sich diese Musik durchzusetzen scheint in einer Zeit, in der – glaubt man den Verantwortlichen in den Rundfunkanstalten – die Menschen Mühe haben, mehr als einem Einzelsatz der „Kleinen Nachtmusik“ konzentrativ standzuhalten.>>>> Wiederbegegnung – (vorläufiger) Abschied von Allan Pettersson.
>>>> AP 10
AP 8 <<<<

Schönes Wort, übrigens: „k o n z e n t r a t i v“.
albannikolaiherbst - Dienstag, 5. September 2006, 07:20- Rubrik: HOERSTUECKE
Wo die Technik, die ‚Machart’ im Vordergrund steht, kann eine Komposition weder Aussage noch Kunstwerk werden.Von meiner Arbeit, zitiert nach >>>> McCredie.
Dem korrespondiert eigenwillig die Aussage >>>> Rostropovitschs in einem Interview. Seinerzeit gefragt, wie er denn (in seiner Interpretation der bachschen Cellosuiten) diese rasenden Läufe und die mit ihnen verbundene Anstrengung rein physisch verkrafte, sagte er damals:
Ach, wissen Sie, irgendwann hört Technik auf, ein Problem zu sein.
Dieser Satz beschäftigt mich bis heute immer wieder. Er stellt nämlich zwischen den Zeilen einen Anspruch auf, gegenüber dem der Einzelne sehr klein wird in seiner persönlichen Bedürfnislage: daß Kunst nämlich erst jenseits der Technik - nicht aber ohne sie - beginnen, daß sie sich erst jenseits der Verfügungskraft über die künstlerischen Mittel, die einer haben k ö n n t e, und zwar sämtlich denkbarer, entfalten könne. Alles vorher wäre dann, mit einem Wort Adornos, „kompositionsfremde Bastelei“. Dieses gilt für Kunst insgesamt, also auch für die Dichtung.
[Mit zunehmendem Alter beginne ich, strikt zwischen „Schriftsteller“ und „Dichter“ zu unterscheiden, und zwar nicht aufgrund der jeweils gewählten Ausdruckskategorien - nicht also daran betrachtet, ob jemand Lyrik oder Prosa schreibt -, sondern in der Art, w i e geschrieben wird. Und ob zu schreiben (zu komponieren/zu malen) eine Lebensform ist. Das deutsche Wort beschrieb es eigentlich genau: ob man einen B e r u f hat, worin mit Recht ‚Berufung’ schwingt. Oder ob einen Job. Dem Finanzamt gegenüber und in Lexika mag ich ein Schriftsteller sein - ich bin das gegenüber der „Welt“; es ist die funktionale Beschreibung einer Tätigkeit und ihrer Stellung gegenüber und in der Gesellschaft, also eine funktionale Bestimmung. Nicht aber gegenüber der Arbeit; in ihr bin ich Dichter, und zwar auch in den Romanen. Als solcher habe ich Rostropovitschs und >>>> Hartmanns Anspruch zu genügen. Ob dem gesellschaftlichen, der sich in eingebrachtem Mehrwert rechnet, ist dabei egal. Nicht wenige Kollegen mißachten das – ob aus gegenüber der Kunst profaniertem Pragmatismus, ob aus Nichtwissen. Sie geben das Pathos auf, das aller Kunst überhaupt erst Atem einhaucht, selbst wenn es sich - aus Scham vielleicht oder aus Angst vor mißbräuchlichen Interpretationen - in ‚verschiebenden’, widerständigen Spielarten der Groteske und Ironie versteckt.] [Poetologie.]
albannikolaiherbst - Dienstag, 5. September 2006, 06:18- Rubrik: NOTATE
Alte Frauen kommen vom Friseur
verwandelt das Haar zu lila Perücken
die Schlaufe ums Gelenk, das wehe,
der Leine, schnalzen sie Verzücken
dem letzten Liebsten, ehe
sich auch er, ihr Hund, verlör.
albannikolaiherbst - Mittwoch, 6. September 2006, 17:37- Rubrik: Gedichte
In tragischem Geschehen rauschhaft Schönheit zu fühlen. Und sich nicht pragmatisch abzufinden, sondern zu wo l l e n, daß es tragisch sei. Kunst zu empfinden bedeutet, innere Distanz aufzugeben. (Was Kunst i s t, unterläuft die demokratische Autonomie.) [Pettersson, Sechste Sinfonie.] (CCCCXVII). albannikolaiherbst - Mittwoch, 6. September 2006, 11:31- Rubrik: Paralipomena
Einspielung: Pettersson IX, aber ganz ganz vorsichtig, pp-Stelle. Von nun an den Sprechertext in THEMA I zurückführen.
| Sprecher 2 |
Wir streckten unsre danach aus
doch war der Keller lang und
immer ferner ward das Flämmchen |
|---|
| Sprecher 1 |
Da schloß ich meine Augen und |
|---|
| Sprecher 2 |
schloß m i c h, ich ließ es in mir singen. |
|---|
THEMA I
Über das Interview die Musik wegnehmen.
SPRECHER 3 (wie in einem Interview, mit stark deutschem Akzent:) I really do not know what happend. It was an early warm morning, when I awoke und went to the sea for smoking a cigarette… as I’m used to each morning, when I’m here. Ye know: to think, to dream, to enjoy this marvellous prospect of the tropical sunup. Little children were playing far around, one could smell the scent of the small nearby bakery. I was standing there on the beach and even before sunrise there came this music as of out of the waves, as of out of the palm-trees, I don’t know. And it was not only me to be fascinated by this… I am not yet sure if halluzination, if real phenomenon… ‘cause while listening and peering to the ocean, I recognized some people more to listen with me. I indead didn’t realise them to have been approached me and staring now into space as I did. For two, may be three minutes, not more. “Do you hear that, too?” I asked. But they looked at me nearly deranged as if the origin of this sounds was just me … I cannot say ‘music’, it was more than that, was a permanent tone lying on and under and in the whole environment. And when I wanted to ask the people again, they unseemly had already left.
ANH And then you started taking this music down… you started to become a composer?
SPRECHER 3 No, it was not yet, but the days after, because this music… it didn’t fade away, but came again and again, wherever I was, even in Bombay, even in Dubai, where I had a stop when flying back home… and even then in Berlin… again and again.
ANH You know that the same music was written down by people of other countries, too, in the same weeks and months, and that all of them are telling the same story?
SPRECHER 3 Yes, I know.
ANH And that nobody of them had been able to write music ever before?
SPRECHER 3 Yes, I know.
ANH And that you all are of completely different origin, coming from farmers, from employees in bank and assurance companies or even without any job…?
SPRECHER 3 Yes, I know.
ANH …even of completely different cultures?
SPRECHER 3 It is a miracle, yes. It’s t h e miracle. But also… you know? it’s a doom. There is not any possibility to escape.
Einspielung: Pettersson IX, Take 10.
führt ins THEMA II
Darüber, wie aus dem Off, sehr sachlich:*
SPRECHER 1 Da fällt mir ein, daß wir ja einen Choral im Stück haben. Das ist ein Bruch, der Übergang vom meditativen Cantus. Kurz vor der Klage kommt ein Kirchengesang in den Streichern. In vier Takten reiner Dreiklang.
>>>> AP 13
AP 11 <<<<
albannikolaiherbst - Mittwoch, 6. September 2006, 08:10- Rubrik: HOERSTUECKE
Vor >>>> dieses einschieben:
INTROITUS
SPRECHER I
Fluß ist die Zeit im Gefälle, so fällt sie durch unser Leben,  stoßend die vielen, wenige hebend, und sieht nicht, was einzeln
wartet im Keller, Kinder, gedrängte, um Licht und um Nahrung,
Frauen mit blutig geschlagenen Brauen, vor ihren Tränen
schamvoll die eigenen Hände, sehn sie bereits ihre Söhne
ebenfalls prügeln und sehen die Töchter, verschlagen, durch Betrug sich
schützen und, vor den Männern, ihre eigenen, die nächsten Kinder.
Dona eis aeternam, doch ist keiner, der sie uns gäbe,
Drohung, nicht Trost ist die Auferstehung im Fleische, dem kranken,
Tröster ist nicht, ist nicht Erlöser und ist auch nicht trauend
Aussicht auf Gerechtigkeit. Wir schwinden dahin, uns
reicht sich die Brust ganz vergebens, hat die Not sie organisch
dörr werden lassen und hängt nun erschlafft auf den heulenden Säugling.
Nein! Ein Gott ist nicht, noch wären Götter, den Schmerz dir
auszugleichen. Niemand kann helfen, noch daß er’s wollte,
Mensch nicht, nicht Schicksal, in Bios bist du und Wirtschaft geworfen.
Mächte, andere, wirken, nicht blind, sondern wissend und dennoch
selber getrieben, mitgetrieben im Zeitfluß und strömt uns
vorwärts mit allem andren; so lebt man und stirbt man, genußvoll
oder in Darbnis, niemanden schert es. Wir aber, manche,
viele warn’s nicht, erhoben uns dennoch. Wer’s wagt’, mit Gewehren,
andere konnten das, wollten’s auch nicht oder, Niedergebeugte.
Wunde, Verhärmte, erfassen kaum, daß sie’s müßten: schuldlos
selber Schuld auf sich nehmen. Sondern schuldig bleiben
schuldlos sie und beten zu dir, der nicht ist noch sein wird
jemals und haben keinen himmlischen, keinen irdischen
Tröster. So verfallen sind sie sich selbst noch. Sing denen!
Singe von ihnen, singe von dir als von dem, der es annimmt,
ihnen es abnimmt. Nimm dich als Beispiel für andre. Lasse
darin nicht nach und nicht in der Suche nach dem verlor’nen
Klang einer Unschuld, die es nie gab. Doch als Ahnung wird sie,
bitterlich erfochten, aufgegeben niemals,
bleiben: aufscheinend, kurz, immer wieder, im Glück von Momenten,
unsren Momenten, innerlichen, die wir kaum träumten.
Ruhe denn. Amen. Auferstehe im Klang uns und Frieden.
Einspielung: Ruzicka, „…das verfluchte, das gesegnete…“. Aus dem Musikmaterial (Ruzicka) abgeleitet die
G e s t e . Aus ihr entwickelt sich überschneidend:
Thema I
>>>> AP 14
AP 12 <<<<
albannikolaiherbst - Donnerstag, 7. September 2006, 10:32- Rubrik: HOERSTUECKE
Ist - in Anbetracht der gesamten Weltgeschichte d a n a c h - imgrunde das erschütterndste Symbol von Vergeblichkeit. Zugleich destilliert es aber genau daraus seine Kraft und erschafft sie damit. Ganz wie die Kunst aus Leiden kathartische und auch anderswie berührende Glückserlebnisse herausschlägt, vermag Religion, aus objektiven und auch endgültigen Niederlagen Kräfte zu ziehen, die ohne diese Niederlage keinerlei Realität bekommen hätten. Auch hier also wirkt Perversion – eine, die im christlichen Fall einen symbolischen Kannibalismus ritualisiert hat, der das Brot des Fleisches Jesu ebenso unendlich oft zu brechen vermag wie über die verstrichenen Jahrhunderte seine ursprünglich rund sieben Liter Bluts Milliarden Dürstende zu stillen vermochten und das ganz offenbar weiterhin vermögen. Hier liegen die Wurzeln der so nahe Verwandten, der Religion und der Kunst. [ICE Berlin-Bamberg.] (CCCCXVIII). albannikolaiherbst - Freitag, 8. September 2006, 17:56- Rubrik: Paralipomena
2. K y r i e
SPRECHER 2
Erbarme dich, Mädchen, meiner, daß ich dich schänden ließ.
Erbarme dich, Junge, meiner, daß ich dich vor Panzer stieß.
Erbarme dich, Mensch!
Erbarme dich, Mutter, meiner, daß ich Hure aus dir machte.
Erbarme dich, Vater, meiner, daß ich dich in die Gräben brachte.
Erbarme dich, Erde!
Erbarme dich, Frau, meiner, daß ich dich auf die Knie zwang.
Erbarme dich, Mann, meiner, daß ich zerstückt dich in Bäume hang.
Erbarme dich, Mensch!
Erbarme dich, Alte, meiner, daß ich dich einsam eingehen hieß.
Erbarme dich, Alter, meiner, daß ich dich in die Heime wies.
Erbarme dich, Erde!
Erbarme dich, Tote, meiner, daß man dich ins Massengrab deckt.
Erbarme dich, Toter, meiner, daß euch kein Paradies erweckt.
Erbarme dich, Mensch!
(„Denn es wird kein Trost sein“, später ins LUX AETERNA nehmen. Dazu Pettersson-Zitat über Kunst und Ekstase.)
G e s t e. Und Musik ff. Sie leitet über (Verwandlung) in
THEMA III
Im U-Bahn-Rattern geht die Musik weg.
ANH (wie ein innerer Monolog). Es ist der 1. Mai 2003. In Palolem, Goa, steht ein Mann am Strand, sieht aufs Meer hinaus und hört eine Musik, die er früher nicht kannte. Er heißt Vincent Herbrand, ist das, was man einen Aussteiger nennt, ein ungebundener Weltenbummler seit seinem 29. Jahr. Er liebt Madonna und Joni Mitchell, hat mit dem, was klassische Musik genannt wird, geschweige mit Neuer Musik nie etwas zu schaffen gehabt, spielt ein bißchen Gitarre, das war’s auch schon. Nun kann er sich nicht lösen, steht fast eine Stunde da, die indische Sonne prallt auf ihn drauf wie auf ein Moai, dem Mana enströmt. Deshalb, weil sie es spüren, diesen Atem so hören, starren die Inder den versunkenen Fremden derart an. Der mitsingen muß, mitsingen mit einer sehr hohen Stimme…
>>>> AP 16
AP 14<<<<
albannikolaiherbst - Freitag, 8. September 2006, 12:36- Rubrik: HOERSTUECKE
Die enorme schöpferische Kraft als direkte Folge einer Verweigerung des Realitätsprinzipes, mit allen nicht selten katastrophalen persönlichen Konsequenzen – aber schließlich einem Ergebnis in Kunst, das allein vom Umfang her riesig ist und eben dann b l e i b t, unverrückbar abgerungen. K e i n e Tändelei, k e i n Unernst, k e i n Geblödel. Und sich dennoch bisweilen sogar zur Lebzeit noch persönlich auszahlt – wohlgemerkt bisweilen und nicht etwa ‚meistens’. Das ist das Risiko, von dem man mit Recht erwarten kann, daß weiß und akzeptiert, wer sich auf so etwas einläßt. Denn daran ermißt sich die Glut, mit der man es angeht.
Übrigens hat eine solche Haltung wenig Heroisches, weil die Überzeugung leitet. Es ist konsequent, nicht aber heroisch, ihr zu folgen. Folgte man n i c h t, bliebe ein permanentes schlechtes Gewissen. Man folgt allein schon, um sich nicht einem solchen aussetzen zu müssen, also - vom narzißtischen, subjektiven Standpunkt gesehen - aus moralischem Egoismus. (Hier versteckt sich die Wahrheit über „Kunst kommt von ‚müssen’.“) [Poetologie.] albannikolaiherbst - Freitag, 8. September 2006, 11:18- Rubrik: Arbeitsjournal
Darwin verankert den Satz, das Schöne sei zugleich ein Gutes, in dem elementaren Vorteil, den sexuelle Ornamente quer durch das gesamte Tierreich für Partnerwahl und Reproduktionserfolg verschaffen. Dieser Vorteil mag zugleich das Muster aller Assoziationen von Schönheit und dauerhaftem Leben sein (…). Es macht die tiefe Ambivalenz schon des evolutionsbiologischen Modells aus, daß erhöhte Überlebenschancen direkt mit erhöhten Todesrisiken korreliert sein können.>>>> Menninghaus, Das Versprechen der Schönheit.Nämlich, weil das schöne Tier auffällt. Und zwar nicht nur den möglichen Geschlechtspartnern, sondern eben Freßfeinden ganz genauso. So auch das schöne Kunstwerk. Es wird verwundbar, weil es die Deckung aufgibt. Zur Deckung etwa, neuzeitlich, gehört >>>> Ironie als Gegenspielerin des Pathetischen; sie stellt, anders als dieses, eine >>>> Veruneigentlichung der eigentlichen Antriebe dar und hat die Funktion einer Tarnung, die psychodynamisch Abwehr ist. Wer auf sie einschlägt, schlägt immer daneben, denn er trifft ja nur das Ironische und nicht das, über was sie als Decke gezogen ist. Deshalb trifft er nicht einmal d a s.
[Manchmal führt ein Link, den Die Dschungel legt, auf einen Beitrag, dessen Zugehörigkeit zum Thema nicht sofort einleuchtet. Das ist A b s i c h t.]
albannikolaiherbst - Freitag, 8. September 2006, 09:31- Rubrik: NOTATE
Let's take Allan Pettersson. He is an awkward composer in the good sense of the term ; not a composer that would be under control until it gets too perfect: he does not care if something does not work completely fine. Part of his music is very, very difficult to listen ; and suddenly, something happens, exactly when you you were not expecting anymore : "Waow !"Le Monde, 2. August 2005
>>>> AP 15
AP 13 <<<<
albannikolaiherbst - Freitag, 8. September 2006, 08:38- Rubrik: HOERSTUECKE
Der eine war voll Blut,
der zweite ungeboren,
der dritte gut:
Der mischte die Karten.
Lange, leidgeschoren
ließ er die anderen warten
und reichte endlich dem ersten den Stoß.
Der griff in die Kinder, die harrten,
zog einen Jungen, ließ ihn ausholend los.
So knallte das Kind auf den Tisch.
Der zweite nun zog aus dem Schoß
behutsam ein Mädchen; malerisch
legt’ er’s zu ihm. Zwar war der tot,
doch als sich berührten die Glieder,
stieg von den beiden das Morgenrot
und schien auf die Engel nieder.
 albannikolaiherbst - Samstag, 9. September 2006, 23:26- Rubrik: Gedichte
Im ICE sitzt neben mir eine Frau, die eine schöne linke, aber sehr häßliche rechte Hand hat. Nicht durch Krankheit oder Unfall, sondern wie von Natur. Hände wie von zwei verschiedenen Menschen.
[Aus dem Notizbücherl..
März 2000.
Später in die Erzählung einbauen.] 6 <<<< albannikolaiherbst - Samstag, 9. September 2006, 16:22- Rubrik: PROJEKTE
Der Skandal, für den Pettersson steht, ist ein objektiver: Es genügt nicht, daß einer Musik macht, die spricht, es genügt nicht das Eigene an ihr und schon gar nicht ihr Bekenntnischaracter; er ist dem Betrieb sogar hinderlich. Sondern sie soll handwerklich dem Anspruch genügen, einem akademischen und, vor allem, kunstideologischen. Tut sie es nicht - obwohl sie unvergleichlich umfassender klingt und sehr viel direkter greift, als das meiste dessen, d a s ihm entspricht -, tut man sie mit Hinweisen auf eine Selbstmitleidigkeit des Komponisten ab, also mit einem moralischen Urteil über einen körperlich Schwächeren, der zudem keine Lobby hat – als wäre eben diese körperliche Schwäche, als wäre Krankheit ein Vergehen, das jemanden dann als nicht satisfaktionsfähig disqualifiziert, wenn er von ihr nicht absehen kann. >>>> Trojahn schreibt dazu – und fühlt damit das unterschwellige Unbehagen genau heraus: „…scheint mir (..) vieles in seinem kompositorischen Werk eine Schuldzuweisung zu enthalten an den, der gerade nicht leidet“. In der Tat. Die Musik hat den Blick der Darbenden auf dem Steg zum Grabmal Hadji Ali Dargahs in der Mahim Bay vor Bombay. Diese inszenieren ihre Versehrungen auch, aber sie h a b e n sie und haben sie nicht etwa nicht. Übersehen wird bei solch moralischer Abwehr zweierlei, eines davon ist für Künst selbstschädigend: Unterhaltende Formen, denen Komplexität und Genauigkeit egal, ja zuwider sind, scheren sich von vornherein nicht um den Akademismus und wirken deshalb unmittelbar, und zwar durch Kitsch, auf die Hörer. Der Kitsch seinerseits verrät seinen Anlaß und schändet ihn sozusagen zum zweiten Mal, weil er ihn aufs pekuniäre Interesse des Marktes erniedrigt, das Leiden also zur Ware macht. Das genau tut Pettersson nicht, seine Musik wirkt, obwohl er beim eigenen Leiden b l e i b t, und zwar t r o t z ihrer enormen Komplexität. Das gibt ihr diese besondere Wahrheit. Zum anderen, und das ist wichtiger, wird übersehen, daß es einer großen Kunst sehr wohl gelingen kann, das dennoch bestehende persönlich-Eigene - individuell eigenes Leiden, eigene Schmerzen, eigene Not - in ein Allgemeines zu transzendieren, und zwar unabhängig davon, ob das Eigene bewußt verlassen wird oder ob der Künstler sich, wie wahrscheinlich Pettersson tat, zu seinem persönlichen sekundären Krankheitsgewinn daran festklammert - dem einzigen Gewinn, den er wohl kannte. Es gehört zur einfachsten Menschlichkeit, das einem derart Geschlagenen zuzugestehen. Die Transzendenz ergibt sich (oder ergibt sich nicht) rein unabhängig davon. Sie s e t z t sich: mit jedem Hörer mehr, der bereit ist, sich einzulassen. Dafür spricht, daß man über den Komponisten überhaupt nichts wissen muß und meist auch wirklich nichts weiß, legt einem diese Musik ihre Hände - immer beide! - um die Schädelseiten und drückt sich durch diese Hände für immer hinein. Sie läßt sich fortan nicht mehr vergessen, nur noch verdrängen. Das spürt >>>> Trojahn ebenfalls und affirmiert - „vorläufig“, schreibt er - die Verdrängungsbewegung: „Mein Abschied von Pettersson ist also der Abschied des zu nahe Gekommenen, dessen, der auch eigene Unvollkommenheiten entdeckt hat an ihm und gleichsam den Auslöser des Unbehagens flieht, um noch selbst überleben zu können.“ ‚Klassischer’ läßt sich psychische Abwehr gar nicht beschreiben. „Pettersson ist nicht“, konstatiert Trojahn, „der letzte Vertreter einer großen Tradition, er ist der einzige Vertreter einer gigantischen Individualität, die den verbrennt, der sich ihr nähert.“
Angst vor dem Feuer. [Poetologie.]
>>>> AP 17
AP 15 <<<< albannikolaiherbst - Sonntag, 10. September 2006, 11:51- Rubrik: HOERSTUECKE
Wir waren alle noch in der Schule, vielleicht 10. bis 13. Klasse, und hatten einen Chor gegründet, der in kurzem sehr gefragt war wegen seines intensiven Klangs, Einladungen zu Konzerten erhielt usw. Es war eine bekannte, ja berühmte Schule, sowas wie Casimirianum, irgendwas Elitäres, vielleicht sogar ein Internat nach Art von Schulpforta oder Thomasalumnat. Jedenfalls waren wir aufgefordert, uns einen Namen zu geben, als Klangkörper; es sei sonst schwierig, wurde uns gesagt, solche Konzerte anzukündigen, was solle man denn schreiben auf den Plakaten? die Namenlosen? - Nein, da müsse was Griffiges her! Aber wir wollten nicht. Wurden ins Direktorat einbestellt. Man hatte das Interesse, unseren Klangkörper mit der Schule symbolisch zu verbinden, uns zu ihrem Label zu machen. Wir aber sagten den beiden, die uns herbestellt hatten (uns alle? 150!; die Anzahl Sänger wurde genannt; aber wie wir 150 ins Direktorenzimmer der Villa Concordia paßten, wurde nicht gezeigt; das bleibt völlig dunkel): „Wir möchten zusammen singen, wir möchten e i n e s sein in der Musik; aber wir möchten nicht benutzt werden, auch nicht als Aushängeschild. Zwar, Sie geben uns die Möglichkeit, dieser Klangkörper zu sein, Sie finanzieren es uns, und dafür sind wir dankbar, aber wir sind es nicht für den Ruhm dieser Schule.“
Was der Direktor darauf erwiderte, weiß ich nicht, weil mich der Wecker herausdrehte.
albannikolaiherbst - Montag, 11. September 2006, 06:42- Rubrik: Traumprotokolle
Am Nebensitz ein Mann, über dessen Kinn der gläserne Stein eines Piercings aus den flachen Bartstoppeln schaut, als hinge an der Unterlippe ein Speicheltropfen. Ein Tücherl möcht man ihm reichen, sich abzutupfen. Und fühlt sich hilflos, weil’s nicht geht. Und kann doch auch wieder nicht wegsehn. [Entstellungen. ICE Berlin-Bamberg.
Halt Leipzig.] albannikolaiherbst - Dienstag, 12. September 2006, 08:12- Rubrik: NOTATE
ANH (…) Das ist zugleich skandalös wie human-utopisch: weil es Ausdruck eines Unfertigen ist, der wie Narben durch diese Sinfonik zieht und immer wieder gegen sie eingewandt wurde, die sich aber nun zugleich, im Zusammenkommen des musikalischen Ausdrucks in derart vielen Menschen - daß er nur, w e n n sie zusammenkommen, sie a l l e - zu dem Symbol eines übergreifend Sozialen macht und ihrer Ähnlichkeit - der Ähnlichkeit der Art - Ausdruck verleiht. Musik wird zur Allegorie. Sie ist - und war es schon immer - deren Klang.
G e s t e. Darin THEMA III weg.
Einspielung: Pettersson, Sinfonie Nr. XXXX. Etwas stehen lassen, dann unmerklich dämpfen und darüber:
SPRECHER 3
Haben wir es aufgegeben, daß wir noch schauen?
sehen den Terror, sehn aber nicht den Schmutz unsrer eigenen
Städte und Stätte? dort wo Hilfe gerecht wär, weil möglich,
ihnen zuzulächeln nur? den Verarmenden? täglich
unter unseren Augen? denen Hilfe nah wär?
Wollten wir denn wissen, was nicht so entfernt nur uns träfe,
daß wir’s mit Spenden begleichen und es nicht ansehen müssen,
riechen nicht, noch davon kosten anders als bloß mit Bedauern,
wohlfeil wie gütig in unserem Mitleid und können so schlafen?
Aber was bleibt uns? Leid ist nicht teilbar und mitteilbar nicht ist’s:
Jedem sein eignes Erbarmen, wir können’s nur denken, nicht zahlen,
ließen das eigene Haus denn, die Kinder, die Partner zurückstehn,
opfernd sie Opfern und wäre bald keine Kultur mehr noch Wohlfahrt.
Hilft denn dem Kranken das Siechtum des Nächsten? Und w a s denn hülf es?
Gar nichts! Dennoch sieht er trostlos auf mein gutes Befinden,
neidet’s nicht, schmerzlich ist’s aber doch, wenn wir ohne Hunger
speisen können und uns speisen, indes, an Zirrhosen
krank ohne Schuld, sein Kind den Hunger auf der geschwollnen
Zunge zerkaut, weil es sonst nichts hat, sich sättigend zu kauen,
und noch den Atem drückt sie ihm weg. Da stirbt es gleich zweifach:
Hungers sowohl wie es erstickt. So hilflos sieht es der Vater,
längst ist die Mutter gegangen, aufgeschwärt am Fieber.
Doch noch immer danken sie Göttern und Gott, die barmherzig,
unerforschlich der Ratschluß, die bösen Schicksale lenkten.
(…)
>>>> AP 18
AP 16 <<<< albannikolaiherbst - Dienstag, 12. September 2006, 06:00- Rubrik: HOERSTUECKE
|
|
Für Adrian Ranjit Singh v. Ribbentrop,
meinen Sohn.
Herbst & Deters Fiktionäre:
Achtung Archive!
DIE DSCHUNGEL. ANDERSWELT wird im Rahmen eines Projektes der Universität Innsbruck beforscht und über >>>> DILIMAG, sowie durch das >>>> deutsche literatur archiv Marbach archiviert und der Öffentlichkeit auch andernorts zugänglich gemacht. Mitschreiber Der Dschungel erklären, indem sie sie mitschreiben, ihr Einverständnis.
Kontakt ANH:
fiktionaere AT gmx DOT de
E R E I G N I S S E :
# IN DER DINGLICHEN REALITÄT:
Mittwoch, den 5. April 2017
Bremen
Studie in Erdbraun
Mit Artur Becker und ANH
Moderation: Jutta Sauer
>>>> Buchhandlung Leuwer
Am Wall 171
D-28195 Bremen
19 Uhr
Sonnabend, 23. September 2017
Beethovenfest Bonn
Uraufführung
Robert HP Platz
VIERTES STREICHQUARTETT
mit zwei Gedichten von Alban Nikolai Herbst
>>>> Beethovenhaus Bonn
Bonngasse 24-26
D-53111 Bonn
16 Uhr
NEUES
Bruno Lampe - 2017/03/29 19:48
III, 280 - Bei Äskulap
Gegen zwei löste ich mich kurzentschlossen vom Schreibtisch. Es war nichts mehr abzuliefern. Aber die ... Die in einem ...
... Deckenlabyrinth sich mäandernde Inschrift...
Bruno Lampe - 2017/03/28 21:42
Vielhard, Leichtgaard:
albannikolaiherbst - 2017/03/28 07:53
Bruno Lampe - 2017/03/27 20:43
III, 279 - Oder auch nicht
Kühler Nordwind. Die Sicht ging bis zu Sant’Angelo Romano weit unten im Latium. Jedenfalls vermute ich ... Bruno Lampe - 2017/03/24 19:55
III, 278 - Einäugigkeiten und Niemande
Ein Auge fiel heraus, abends beim Zähneputzen. Es machte ‘klack’, und der Zyklop sah nur noch verschwommen. ... Danke, gesondert, an...
bei der sich in diesem Fall von einer "Übersetzerin"...
albannikolaiherbst - 2017/03/24 08:48
albannikolaiherbst - 2017/03/24 08:28
Schönheit. (Gefunden eine Zaubernacht). ...
Es juckt sie unter der Haut. Es juckt bis in die
Knochen. Nur, wie kratzt man seine Knochen?
Sein ... Bruno Lampe - 2017/03/22 19:39
III, 277 - Die Hühner picken
Irgendwas ist schiefgelaufen seit dem 9. März. Man könnte es so formulieren: die Verweigerung der Worte ... ich hör' ein heer...
ich hör’ ein heer anstürmen gegens...
parallalie - 2017/03/21 06:51
Ich höre berittene...
Ich höre berittene Landsknecht sich ballen vorm...
albannikolaiherbst - 2017/03/21 06:18
albannikolaiherbst - 2017/03/21 06:12
James Joyce, Chamber Music. In neuen ...
XXXVI.I hear an army charging upon the land,
And the thunder of horses plunging, foam about their knees: ... den ganzen tag lärmen...
den ganzen tag lärmen die wasser
ächzen schon
trist...
parallalie - 2017/03/18 09:55
Den ganzen Tag hör...
Den ganzen Tag hör ich des brandenden Meeres
Klagenden.. .
albannikolaiherbst - 2017/03/18 08:23
JPC

DIE DSCHUNGEL.ANDERSWELT ist seit 4675 Tagen online.
Zuletzt aktualisiert am 2017/04/01 07:33
IMPRESSUM
Die Dschungel. Anderswelt
Das literarische Weblog
Seit 2003/2004
Redaktion:
Herbst & Deters Fiktionäre
Dunckerstraße 68, Q3
10437 Berlin
ViSdP: Alban Nikolai Herbst
HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Der Autor diese Weblogs erklärt hiermit
ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen
Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle
und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft
der gelinkten/verknüpften Seiten hat der Autor keinerlei Einfluss.
Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten
aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung
verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb
des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für
Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Gästebüchern,
Diskussionsforen und Mailinglisten, insbesondere für Fremdeinträge
innerhalb dieses Weblogs. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen,
haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde,
nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung
lediglich verweist.
|