Andreas Zielcke zertritt für die Süddeutsche Zeitung das Selbstbestimmungsrecht einer Frau. Am 19. Oktober 2017 anstelle eines Arbeitsjournales: Entgegnung einem Feinde.

Ein Buch wird zu fünfzehn Jahren Gefängnis verurteilt.
Nach fünf Jahren wird ihm, guter Führung wegen, der
bedingte Freigang erlaubt, an dessen Einschränkungen
es sich hält.
So gehen die Jahre dahin, und endlich ist das Strafmaß
verbüßt. Das Buch kommt wieder frei.
Es öffnet die Augen, blinzelt in die zur Unvertrauten ge-
wordene wundervolle Sonne - als es vom ersten Stein all
derer getroffen wird, die unversöhnlich waren und sind.
„Verbrennt es, verbrennt es!“ schreien die Philister.
Sie tun es seit je oder, an Tauen, richten das Kreuz auf,
um es, das Buch, daranzunageln.
Burckhard Fahler, Schlechte Fabeln
Die Headline >>>> dieses Artikels ist gut: Worte, Wunden. Sie ist sogar ausgezeichnet und der Mann, der drunter schreibt, ein ausgewiesener Kenner. So wär es ehrenwert gewesen, von ihm beachtet, vielleicht sogar gewürdigt, egal, auch heftig kritisiert zu werden.
Nämlich wären von Andreas Zielcke, geboren 1943 und bis zum Jahr 2007 Feuilletonchef der Süddeutschen Zeitung, so oder so Erkenntnisse zu erwarten gewesen über ein Buch, dessen originale Gestalt der öffentlichen Zugänglichkeit lange Zeit entzogen war - Erkenntnisse literarischer Art, vielleicht sogar romanästhetischer oder, falls ihn alleine der Inhalt interessierte (für die „normale“ Leserin, den „normalen“ Leser völlig akzeptabel), über die Geworfenheiten der behandelten Helden und allgemein die Frage, wie recht zu leben sei und was es uns erschwere. Dazu das Buch hätte er nicht einmal mögen müssen, lediglich tun, was eines Kritikers ist, jedenfalls sein sollte: Sich auf es erst einmal einzulassen oder - zu schweigen.
Herr Zielcke hat beides nicht gekonnt.
Nun ist einem 74jährigen Mann, mithin einem Rentner, vielleicht nicht wirklich mehr zuzumuten, im Horte seiner Lektüren auch Obsessives zu dulden oder gar die Zeichen einer Zeit noch zu sehen, der das Private heikel wurde, geschweige ihnen zu folgen. Alles, was Internet ist, mag ihm mit allem Recht seiner Generation und also seiner Prägungen unheimlich dünken und deshalb ihm ein Dichter, der sich schon früh darauf einließ, suspekt sein. Mehr noch: daß ein solcher sein Allerprivatestes, das unumgänglicherweise Privatestes auch anderer ist, zu Material der künstlerischen Gestaltung macht, darf er mit guten Gründen für problematisch halten und deshalb eines solchen Buches Verbot nachvollziehbar begrüßen. Wenn aber der Verbotsgrund fiel, meinethalben den Kopf schütteln und igitt! oder sonstwas denken, nicht aber so tun, als stünde das Buch erst vor dem Prozeß, und er, als wäre er von dem Dichter geschädigt, schichtet nun Beweisgrund um Beweisgrund gegen ihn auf, wie um das Buch noch einmal zu verbieten.
Dies ist genau Herrn Zielckes Ziel. Zumindest will er die Verbreitung erschweren. Zu fürchten steht, es sei ihm nun gelungen.
Starke Rhetorik, fürwahr! Sein emotionsdurchbrodelter Artikel wimmelt vor Epitheta - ein deutliches Zeichen. Seine Leser:innen allerdings sollten sich fragen, welch enormer, ja „unmittelbar“ erregender Roman es sein muß, in einem gestandenen, gar altersreifen - um nicht zu sagen: „weisen“ - Mann so etwas auszulösen.
Herr Zielcke, ich habe ein Problem, das Ihnen, fürcht‘ ich, wohl bewußt, wenn nicht gar ein taktisches Mittel Ihrer Strategie ist. Denn so gerne ich Ihrem Text Satz für Satz gegenreden würde, ist‘s mir doch nicht erlaubt, ohne diesmal zwar nicht mit dem Persönlichkeits-, wohl aber Urheberrecht in Konflikt zu geraten; selbst längere Zitate sind heutzutage ohne die Genehmigung ihrer Autoren - oder derer, die ihre Rechte vertreten - nicht mehr erlaubt. Wes‘zufolge mir gar nichts anderes übrig bleibt, als ebenso rein zu behaupten, wie eben Sie es tun.
Solch eine Behauptung etwa sagte, es gehe Ihnen im eigentlichen gar nicht um dieses spezielle Buch, sondern um die Vernichtung eines Autors insgesamt, einem in meinem Fall Bedürfnis, das sie durchaus mit vielen Kritikern teilen und - wenn auch signifikant weniger - Kritikerinnen.
Sie tun es auch wirklich geschickt: etwa, indem Sie mir, dem Autor von >>>> Meere, einen Mißbrauch vorwerfen, den Sie durch Ihren eigenen noch betonen. Denn Sie nehmen den Willen der Frau, der das verbotene Buch nun befreit hat, gar nicht für eigenen Willen. Dahinter wirkt eine so rhetorische wie, im juristischen Sinn, suggestive Form von Autor-Diskriminierung. Fast muß Ihr Leser meinen, sie, diese Frau, sei zu ihrer Willensbekundung genötigt, wenn nicht gar gezwungen worden - und wenn, von wem dann wohl als von mir?
Das ist, ich gebe es zu, höchst wirksam Infamie. Wer mag denn jetzt noch erkennen, daß Sie es sind, ein Selbstbestimmungsrecht mit dem Absatz zu treten? zumal das einer Frau, um deren Wohlfahrt Ihr Text zu kämpfen sich bauscht. Hier, nicht bei mir, hat das alte und hämische Patriarchat gegen sie, diese Frau, nicht nur den Stinkefinger, sondern die Hand gehoben, die, wenn die Argumente ausgehn, halt auch gern mal zuschlägt. Auf der Buchmesse >>>> haben wir's neulich erlebt. Es wirkt hier – strukturell – ganz derselbe Ungeist.
Der Mißbraucher, nein, bin wahrlich nicht ich.
Ich war es auch zuvor nicht. Sie gehören, Herr Zielcke, zu einer Generation von Journalisten, denen an präziser Recherche noch gelegen war. So hätten Sie doch Blicke in die Prozeßakten werfen können. Genau das taten Sie offenbar nicht. Sonst wäre Ihnen zur Kenntnis gebracht, daß ich vor Drucklegung, sogar lange vor ihr, das Typoskript des Romanes der späteren Klägerin zugeschickt habe. Ihre Antwort war, wie immer man sie wertet, eindeutig: Sie wolle das Buch erst lesen, wenn es herausgekommen sei. So erklärte sie selbst es vor Gericht zu den Akten.
Tatsächlich, da gaben ihr die Richter recht, hätte man - auch ich nicht – von ihr nicht verlangen können, daß sie meinen Text auch lese; ihn aber nach dieser Bekundung veröffentlichen zu lassen, war ein Mißbrauch eben nicht - auch dann nicht, wenn das Buch Persönlichkeitsrechte der Klägerin angeblich oder tatsächlich verletzte. Hätte ich denn ohne Not darauf verzichten sollen, diesen Roman in die Welt zu bringen, ahnend, daß er eine Verletzung darstellen würde? Ich ahnte es tatsächlich nicht. Im Gegenteil ging ich davon aus, daß die Frau sehr wohl weiß, wie Kunst entsteht; wir hatten ja zusammen gelebt: Sie hatte nicht nur mich, sondern auch mein Werk geliebt. So wußte sie durchaus, wie immer wieder ich eigenes Erleben in meinen Texten fiktionalisierte. Und fiktionalisiert ist Meere von Anfang bis Ende.
Das war auch niemals strittig.
Die Frage des Prozesses spitzte sich anders zu: Inwieweit ist jemand von seinem nahsten Freundes- und Familienkreis noch erkennbar. - Nur kann man verfremden, wie man nur will, die Nahsten werden immer erkennen.
Dabei war mir bei allem die Klägerin selbst, also ihre Position, gar nicht problematisch. Ich verstand sie gut und verstehe sie noch jetzt, und aber jetzt versteh ich sie noch einmal ganz besonders. Skandal vielmehr war für mich die Reaktion der Kritik. Skandal waren die aufeinandergehäuften Falschmeldungen, die oft sehr bewußt als solche lanciert wurden. Da sind nun Sie keine Ausnahme, insofern ich einige Gründe habe, von meiner Annahme besser abzustehen, es liege Ihrem Text eine Nachlässigkeit der Recherche zugrunde, sondern daß Sie mit vollem Bewußtsein Falsches behaupten.
Interessant zum Beispiel, daß Sie Ihren Lesern erzählen, ich hätte meinen Helden, den Maler Fichte, als „erbärmlichen Realitätsverweigerer” gezeichnet. Ähm – bitte wo? Die „unbarmherzige Brennschärfe”, mit der ich die Physis – übrigens nicht nur, wie Ihr Artikel unterschiebt, der Protagonistin - beschriebe, spricht wohl eher eine andere Sprache, zumal Ihr Begriff von Barmherzigkeit angesichts erotischer Vorgänge doch recht katholisch wirkt, nur leider auf calvinistische, statt lebensfroh-mediterraner Art.
Nicht das Buch ist der Skandal, sondern für Sie der Körper selbst, und Körperliches. Sie perpetuieren die monotheistische Feindlichkeit gegen Sekrete und Sinne. Dieses, wenn ich's recht betrachte, scheint hinter Ihrer Empörtheit zu wirken. Der Anlaß selbst, wie ich oben betonte, hat sich ja aufgehoben: Die angeblich oder tatsächlich Geschädigte selbst hat es getan. Es wäre an Ihnen, das zu akzeptieren. Daß Sie es nicht tun, zeigt, woher Ihr innerer Wind weht.
Dafür spricht darüber hinaus, daß Sie – ebenfalls sehr geschickt – eine Haltung Maxim Billers mit der meinen vermischen, indem Sie Ihre Conclusio zu ihm als – freilich indirekt – auch meine Position unterstellen: „Einen als kleinbürgerlich deklarierten Willen braucht ein Künstler, heißt das wohl, nicht zu respektieren.” - Wo herrje hätte ich jemals die Klägerin kleinbürgerlich genannt? Wenn sie irgendetwas wahrlich nicht ist, dann das. Und daß ich für das Buch kämpfte, weil ich fälschlich meinte, der Begriff der Erkennbarkeit beziehe sich auf Personen des Öffentlichen Lebens, hatte schlichtweg seinen Grund darin, daß genau dieses bis damals die Grundlage der juristischen Auslegungen war.
Auch hier hätten Sie sich kundig machen können.
Erst mit Meere änderte es sich; - in Billers Fall war die Öffentlichkeit der in seinem Fall Klägerinnen gegeben. Daß beide Bücher, seines und meines, aber auch aus völlig anderen Gründen, nämlich wegen unserer geradezu gegenläufigen kunstästhetischen Ansichten, überhaupt nicht vergleichbar sind, - diesen Umstand kehren auch Sie besser unter den Tisch und wiederholen statt dessen eine Frage, die den Buchprozeß ständig begleitet hat und deren Antwort zu dem bekannten, nun aber eben aufgehobenen Ergebnis führte.
Ich habe diese Antwort akzeptiert, indessen schon lange im Vorfeld entsprechend reagiert: Es kam – auch da schon mit Einwilligung der Klägerin – zu der „persischen” Fassung des Romans. Sie hingegen tun so, als wäre alles immer noch strittig. Gewissermaßen, siehe oben das Motto, wollen Sie das Strafmaß für das Buch im nachhinein erhöhen.
Und dann der Clou Ihrer Begründungsfindung, verzeihen Sie, wenn ich lache. Doch Frankreich gegen Deutschland auszuspielen, am Beispiel des Persönlichkeitsrechts, ist von geradezu bizarrem Argumentationsdilettantismus. Nämlich weder in Frankreich wäre es zu einer Verurteilung des Romanes jemals gekommen - noch übrigens in den USA; er wäre dort nicht einmal infrage gestellt worden.
Bitte lesen Sie gelegentlich auch hierzu die juristische Fachliteratur. Wissen, Herr Zielcke, kann nicht schaden; schaden tut immer nur „Meinung”, besonders aber das Ressentiment. Dieses führt sogar dazu, daß nun, was ich zutiefst vermeiden wollte, die Frau, für die Sie angeblich streiten, erst recht und, wenn Sie so wollen, noch einmal verletzt wird.
Denn sofort, Sie können es >>>> hier in Der Dschungel furchtbar nachlesen, hängen sich die Mitläufer der „Meinung” an Sie dran und kläffen häßlichst mit, und anonym. Da wird, um mir zu schaden, durchaus nicht davor zurückgescheut, die Frau selbst zu diffamieren: Hauptsache, man kriegt den Herbst damit weg, den, wie >>>> verräterischerweise einer schrieb, „Adligen”.
Die Sippenhaftsgesinnung, mit der ich es von Kindesbeinen an genau wie Fichte, mein „Held”, zu tun gehabt habe – ein Motiv des Romans, das sehr bewußt ignoriert worden ist und das nun auch Sie ignorieren – schlägt neu auf das ekelhafteste durch, nun seinerseits „geadelt” durch Sie, ja von Ihnen neu erst angestachelt. Moralische Empörung führt zu Häme, wenn sie sich zu Volkswillen bündelt. Das Buch selbst, um das es jetzt doch gehen sollte, geht darin unter. Das, genau das, ist intendiert.
Meere „verhandelt” nicht nur eine Liebes- und obsessive Künstlergeschichte; viel entscheidender ist, daß dieser Roman sowohl den Umgang mit der sogenannten deutschen Vergangenheitsbewältigung in den Blick nimmt wie ihre Hilflosigkeit im Aufeinandertreffen mit nächsten Generationen, und er erzählt, was sich de facto mit den neuen Technologien in der Seele der Menschen vollzieht; er gibt sogar eine Erklärung dafür. Und er klagt, klagt im bisweilen Ton >>>> Jeremias'. Schon das Motto des Buches, von Kipling, schlägt ihn an. Auch dieses, das Sie „Resignation und Selbstmitleid” nennen, hat eine künstlerische Funktion. Es ist gebaut, nicht larmoyant.
Die Bewegung des Romans ist immer wieder eine fort vom Ich über das „er” zum Wir. Nach unserer Art wird gefragt: Der allgemeine Verlust ist in den personalen gespiegelt. „Horchst du nach innen, hörst du das Draußen”, schrieb Ernst Bloch. Daher das hier zum ersten Mal in meinem Werk sich derart scharf zentrierende Primat des Privaten.
Geradezu notwendigerweise geriet es in einen Konflikt mit sich selbst, der sich nicht nur juristisch austrug, das war sogar die Nebensache – einmal abgesehen davon, daß Ihr Angriff auf das „absolutistische Selbstverständnis” der Künste ihnen eine Wirkkraft nehmen will, die sie sich mit Begriffen wie Kunstautonomie und auch Genie ziemlich bitter erstritten haben: nämlich weg vom Lakaientum, in dem die heutige Gegenwart sie gerne wieder sehen möchte, nur daß die neuen Herren nicht etwa mehr feudal sind, sondern Quote und Mainstream heißen, denen „demokratisch” man sich unterwerfen solle; sprich: dem Markt.
Die Wahrheit hingegen von Meere – und anderen Büchern, auch anderer selbstverständlich, mehr – liegt davon jenseits. Auf den Punkt hat es >>>> Gerd-Peter Eigner gebracht: „Denn jede persönliche Katastrophe ist doch nur die genauere Auskunft über den Zustand der übrigen Welt.“ Die genauere, Herr Zielcke, ecco! Deshalb, nicht aus larmoyanten Gründen, ist auf der künstlerischen Darstellung des Privaten zu beharren.
Im übrigen gilt, daß es hierzulande auch dann keine Zensur gibt, wenn Sie sie gerne sähen; geschrieben und gedruckt werden darf alles, solange niemand dagegen klagt. Das ist gut so, das eine wie die Möglichkeit des anderen. Nur hat sich eben der Klagegrund gegen Meere nach fünfzehn Jahren erübrigt, und es wird Zeit, nach der Qualität dieses Buches zu fragen und darüber zu sprechen, nicht aber mehr über die Umstände seiner Entstehung, geschweige verletzter Persönlichkeitsrechte. So hat es die Frau entschieden, die alleine es war, sich verwundet fühlen zu dürfen und zu können. Es ist an Ihnen, das zu erkennen und – sich zu entschuldigen: nicht bei mir, bewahre! Sondern persönlich bei ihr.
ANH
Oktober 2017
Nämlich wären von Andreas Zielcke, geboren 1943 und bis zum Jahr 2007 Feuilletonchef der Süddeutschen Zeitung, so oder so Erkenntnisse zu erwarten gewesen über ein Buch, dessen originale Gestalt der öffentlichen Zugänglichkeit lange Zeit entzogen war - Erkenntnisse literarischer Art, vielleicht sogar romanästhetischer oder, falls ihn alleine der Inhalt interessierte (für die „normale“ Leserin, den „normalen“ Leser völlig akzeptabel), über die Geworfenheiten der behandelten Helden und allgemein die Frage, wie recht zu leben sei und was es uns erschwere. Dazu das Buch hätte er nicht einmal mögen müssen, lediglich tun, was eines Kritikers ist, jedenfalls sein sollte: Sich auf es erst einmal einzulassen oder - zu schweigen.
Herr Zielcke hat beides nicht gekonnt.
Nun ist einem 74jährigen Mann, mithin einem Rentner, vielleicht nicht wirklich mehr zuzumuten, im Horte seiner Lektüren auch Obsessives zu dulden oder gar die Zeichen einer Zeit noch zu sehen, der das Private heikel wurde, geschweige ihnen zu folgen. Alles, was Internet ist, mag ihm mit allem Recht seiner Generation und also seiner Prägungen unheimlich dünken und deshalb ihm ein Dichter, der sich schon früh darauf einließ, suspekt sein. Mehr noch: daß ein solcher sein Allerprivatestes, das unumgänglicherweise Privatestes auch anderer ist, zu Material der künstlerischen Gestaltung macht, darf er mit guten Gründen für problematisch halten und deshalb eines solchen Buches Verbot nachvollziehbar begrüßen. Wenn aber der Verbotsgrund fiel, meinethalben den Kopf schütteln und igitt! oder sonstwas denken, nicht aber so tun, als stünde das Buch erst vor dem Prozeß, und er, als wäre er von dem Dichter geschädigt, schichtet nun Beweisgrund um Beweisgrund gegen ihn auf, wie um das Buch noch einmal zu verbieten.
Dies ist genau Herrn Zielckes Ziel. Zumindest will er die Verbreitung erschweren. Zu fürchten steht, es sei ihm nun gelungen.
Starke Rhetorik, fürwahr! Sein emotionsdurchbrodelter Artikel wimmelt vor Epitheta - ein deutliches Zeichen. Seine Leser:innen allerdings sollten sich fragen, welch enormer, ja „unmittelbar“ erregender Roman es sein muß, in einem gestandenen, gar altersreifen - um nicht zu sagen: „weisen“ - Mann so etwas auszulösen.
Herr Zielcke, ich habe ein Problem, das Ihnen, fürcht‘ ich, wohl bewußt, wenn nicht gar ein taktisches Mittel Ihrer Strategie ist. Denn so gerne ich Ihrem Text Satz für Satz gegenreden würde, ist‘s mir doch nicht erlaubt, ohne diesmal zwar nicht mit dem Persönlichkeits-, wohl aber Urheberrecht in Konflikt zu geraten; selbst längere Zitate sind heutzutage ohne die Genehmigung ihrer Autoren - oder derer, die ihre Rechte vertreten - nicht mehr erlaubt. Wes‘zufolge mir gar nichts anderes übrig bleibt, als ebenso rein zu behaupten, wie eben Sie es tun.
Solch eine Behauptung etwa sagte, es gehe Ihnen im eigentlichen gar nicht um dieses spezielle Buch, sondern um die Vernichtung eines Autors insgesamt, einem in meinem Fall Bedürfnis, das sie durchaus mit vielen Kritikern teilen und - wenn auch signifikant weniger - Kritikerinnen.
Sie tun es auch wirklich geschickt: etwa, indem Sie mir, dem Autor von >>>> Meere, einen Mißbrauch vorwerfen, den Sie durch Ihren eigenen noch betonen. Denn Sie nehmen den Willen der Frau, der das verbotene Buch nun befreit hat, gar nicht für eigenen Willen. Dahinter wirkt eine so rhetorische wie, im juristischen Sinn, suggestive Form von Autor-Diskriminierung. Fast muß Ihr Leser meinen, sie, diese Frau, sei zu ihrer Willensbekundung genötigt, wenn nicht gar gezwungen worden - und wenn, von wem dann wohl als von mir?
Das ist, ich gebe es zu, höchst wirksam Infamie. Wer mag denn jetzt noch erkennen, daß Sie es sind, ein Selbstbestimmungsrecht mit dem Absatz zu treten? zumal das einer Frau, um deren Wohlfahrt Ihr Text zu kämpfen sich bauscht. Hier, nicht bei mir, hat das alte und hämische Patriarchat gegen sie, diese Frau, nicht nur den Stinkefinger, sondern die Hand gehoben, die, wenn die Argumente ausgehn, halt auch gern mal zuschlägt. Auf der Buchmesse >>>> haben wir's neulich erlebt. Es wirkt hier – strukturell – ganz derselbe Ungeist.
Der Mißbraucher, nein, bin wahrlich nicht ich.
Ich war es auch zuvor nicht. Sie gehören, Herr Zielcke, zu einer Generation von Journalisten, denen an präziser Recherche noch gelegen war. So hätten Sie doch Blicke in die Prozeßakten werfen können. Genau das taten Sie offenbar nicht. Sonst wäre Ihnen zur Kenntnis gebracht, daß ich vor Drucklegung, sogar lange vor ihr, das Typoskript des Romanes der späteren Klägerin zugeschickt habe. Ihre Antwort war, wie immer man sie wertet, eindeutig: Sie wolle das Buch erst lesen, wenn es herausgekommen sei. So erklärte sie selbst es vor Gericht zu den Akten.
Tatsächlich, da gaben ihr die Richter recht, hätte man - auch ich nicht – von ihr nicht verlangen können, daß sie meinen Text auch lese; ihn aber nach dieser Bekundung veröffentlichen zu lassen, war ein Mißbrauch eben nicht - auch dann nicht, wenn das Buch Persönlichkeitsrechte der Klägerin angeblich oder tatsächlich verletzte. Hätte ich denn ohne Not darauf verzichten sollen, diesen Roman in die Welt zu bringen, ahnend, daß er eine Verletzung darstellen würde? Ich ahnte es tatsächlich nicht. Im Gegenteil ging ich davon aus, daß die Frau sehr wohl weiß, wie Kunst entsteht; wir hatten ja zusammen gelebt: Sie hatte nicht nur mich, sondern auch mein Werk geliebt. So wußte sie durchaus, wie immer wieder ich eigenes Erleben in meinen Texten fiktionalisierte. Und fiktionalisiert ist Meere von Anfang bis Ende.
Das war auch niemals strittig.
Die Frage des Prozesses spitzte sich anders zu: Inwieweit ist jemand von seinem nahsten Freundes- und Familienkreis noch erkennbar. - Nur kann man verfremden, wie man nur will, die Nahsten werden immer erkennen.
Dabei war mir bei allem die Klägerin selbst, also ihre Position, gar nicht problematisch. Ich verstand sie gut und verstehe sie noch jetzt, und aber jetzt versteh ich sie noch einmal ganz besonders. Skandal vielmehr war für mich die Reaktion der Kritik. Skandal waren die aufeinandergehäuften Falschmeldungen, die oft sehr bewußt als solche lanciert wurden. Da sind nun Sie keine Ausnahme, insofern ich einige Gründe habe, von meiner Annahme besser abzustehen, es liege Ihrem Text eine Nachlässigkeit der Recherche zugrunde, sondern daß Sie mit vollem Bewußtsein Falsches behaupten.
Interessant zum Beispiel, daß Sie Ihren Lesern erzählen, ich hätte meinen Helden, den Maler Fichte, als „erbärmlichen Realitätsverweigerer” gezeichnet. Ähm – bitte wo? Die „unbarmherzige Brennschärfe”, mit der ich die Physis – übrigens nicht nur, wie Ihr Artikel unterschiebt, der Protagonistin - beschriebe, spricht wohl eher eine andere Sprache, zumal Ihr Begriff von Barmherzigkeit angesichts erotischer Vorgänge doch recht katholisch wirkt, nur leider auf calvinistische, statt lebensfroh-mediterraner Art.
Nicht das Buch ist der Skandal, sondern für Sie der Körper selbst, und Körperliches. Sie perpetuieren die monotheistische Feindlichkeit gegen Sekrete und Sinne. Dieses, wenn ich's recht betrachte, scheint hinter Ihrer Empörtheit zu wirken. Der Anlaß selbst, wie ich oben betonte, hat sich ja aufgehoben: Die angeblich oder tatsächlich Geschädigte selbst hat es getan. Es wäre an Ihnen, das zu akzeptieren. Daß Sie es nicht tun, zeigt, woher Ihr innerer Wind weht.
Dafür spricht darüber hinaus, daß Sie – ebenfalls sehr geschickt – eine Haltung Maxim Billers mit der meinen vermischen, indem Sie Ihre Conclusio zu ihm als – freilich indirekt – auch meine Position unterstellen: „Einen als kleinbürgerlich deklarierten Willen braucht ein Künstler, heißt das wohl, nicht zu respektieren.” - Wo herrje hätte ich jemals die Klägerin kleinbürgerlich genannt? Wenn sie irgendetwas wahrlich nicht ist, dann das. Und daß ich für das Buch kämpfte, weil ich fälschlich meinte, der Begriff der Erkennbarkeit beziehe sich auf Personen des Öffentlichen Lebens, hatte schlichtweg seinen Grund darin, daß genau dieses bis damals die Grundlage der juristischen Auslegungen war.
Auch hier hätten Sie sich kundig machen können.
Erst mit Meere änderte es sich; - in Billers Fall war die Öffentlichkeit der in seinem Fall Klägerinnen gegeben. Daß beide Bücher, seines und meines, aber auch aus völlig anderen Gründen, nämlich wegen unserer geradezu gegenläufigen kunstästhetischen Ansichten, überhaupt nicht vergleichbar sind, - diesen Umstand kehren auch Sie besser unter den Tisch und wiederholen statt dessen eine Frage, die den Buchprozeß ständig begleitet hat und deren Antwort zu dem bekannten, nun aber eben aufgehobenen Ergebnis führte.
Ich habe diese Antwort akzeptiert, indessen schon lange im Vorfeld entsprechend reagiert: Es kam – auch da schon mit Einwilligung der Klägerin – zu der „persischen” Fassung des Romans. Sie hingegen tun so, als wäre alles immer noch strittig. Gewissermaßen, siehe oben das Motto, wollen Sie das Strafmaß für das Buch im nachhinein erhöhen.
Und dann der Clou Ihrer Begründungsfindung, verzeihen Sie, wenn ich lache. Doch Frankreich gegen Deutschland auszuspielen, am Beispiel des Persönlichkeitsrechts, ist von geradezu bizarrem Argumentationsdilettantismus. Nämlich weder in Frankreich wäre es zu einer Verurteilung des Romanes jemals gekommen - noch übrigens in den USA; er wäre dort nicht einmal infrage gestellt worden.
Bitte lesen Sie gelegentlich auch hierzu die juristische Fachliteratur. Wissen, Herr Zielcke, kann nicht schaden; schaden tut immer nur „Meinung”, besonders aber das Ressentiment. Dieses führt sogar dazu, daß nun, was ich zutiefst vermeiden wollte, die Frau, für die Sie angeblich streiten, erst recht und, wenn Sie so wollen, noch einmal verletzt wird.
Denn sofort, Sie können es >>>> hier in Der Dschungel furchtbar nachlesen, hängen sich die Mitläufer der „Meinung” an Sie dran und kläffen häßlichst mit, und anonym. Da wird, um mir zu schaden, durchaus nicht davor zurückgescheut, die Frau selbst zu diffamieren: Hauptsache, man kriegt den Herbst damit weg, den, wie >>>> verräterischerweise einer schrieb, „Adligen”.
Die Sippenhaftsgesinnung, mit der ich es von Kindesbeinen an genau wie Fichte, mein „Held”, zu tun gehabt habe – ein Motiv des Romans, das sehr bewußt ignoriert worden ist und das nun auch Sie ignorieren – schlägt neu auf das ekelhafteste durch, nun seinerseits „geadelt” durch Sie, ja von Ihnen neu erst angestachelt. Moralische Empörung führt zu Häme, wenn sie sich zu Volkswillen bündelt. Das Buch selbst, um das es jetzt doch gehen sollte, geht darin unter. Das, genau das, ist intendiert.
Meere „verhandelt” nicht nur eine Liebes- und obsessive Künstlergeschichte; viel entscheidender ist, daß dieser Roman sowohl den Umgang mit der sogenannten deutschen Vergangenheitsbewältigung in den Blick nimmt wie ihre Hilflosigkeit im Aufeinandertreffen mit nächsten Generationen, und er erzählt, was sich de facto mit den neuen Technologien in der Seele der Menschen vollzieht; er gibt sogar eine Erklärung dafür. Und er klagt, klagt im bisweilen Ton >>>> Jeremias'. Schon das Motto des Buches, von Kipling, schlägt ihn an. Auch dieses, das Sie „Resignation und Selbstmitleid” nennen, hat eine künstlerische Funktion. Es ist gebaut, nicht larmoyant.
Die Bewegung des Romans ist immer wieder eine fort vom Ich über das „er” zum Wir. Nach unserer Art wird gefragt: Der allgemeine Verlust ist in den personalen gespiegelt. „Horchst du nach innen, hörst du das Draußen”, schrieb Ernst Bloch. Daher das hier zum ersten Mal in meinem Werk sich derart scharf zentrierende Primat des Privaten.
Geradezu notwendigerweise geriet es in einen Konflikt mit sich selbst, der sich nicht nur juristisch austrug, das war sogar die Nebensache – einmal abgesehen davon, daß Ihr Angriff auf das „absolutistische Selbstverständnis” der Künste ihnen eine Wirkkraft nehmen will, die sie sich mit Begriffen wie Kunstautonomie und auch Genie ziemlich bitter erstritten haben: nämlich weg vom Lakaientum, in dem die heutige Gegenwart sie gerne wieder sehen möchte, nur daß die neuen Herren nicht etwa mehr feudal sind, sondern Quote und Mainstream heißen, denen „demokratisch” man sich unterwerfen solle; sprich: dem Markt.
Die Wahrheit hingegen von Meere – und anderen Büchern, auch anderer selbstverständlich, mehr – liegt davon jenseits. Auf den Punkt hat es >>>> Gerd-Peter Eigner gebracht: „Denn jede persönliche Katastrophe ist doch nur die genauere Auskunft über den Zustand der übrigen Welt.“ Die genauere, Herr Zielcke, ecco! Deshalb, nicht aus larmoyanten Gründen, ist auf der künstlerischen Darstellung des Privaten zu beharren.
Im übrigen gilt, daß es hierzulande auch dann keine Zensur gibt, wenn Sie sie gerne sähen; geschrieben und gedruckt werden darf alles, solange niemand dagegen klagt. Das ist gut so, das eine wie die Möglichkeit des anderen. Nur hat sich eben der Klagegrund gegen Meere nach fünfzehn Jahren erübrigt, und es wird Zeit, nach der Qualität dieses Buches zu fragen und darüber zu sprechen, nicht aber mehr über die Umstände seiner Entstehung, geschweige verletzter Persönlichkeitsrechte. So hat es die Frau entschieden, die alleine es war, sich verwundet fühlen zu dürfen und zu können. Es ist an Ihnen, das zu erkennen und – sich zu entschuldigen: nicht bei mir, bewahre! Sondern persönlich bei ihr.
Oktober 2017
albannikolaiherbst - Freitag, 20. Oktober 2017, 08:04- Rubrik: Arbeitsjournal
































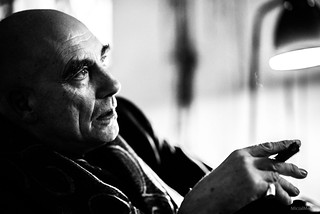







Trackback URL:
https://albannikolaiherbst.twoday.net/stories/andreas-zielcke-zertritt-fuer-die-sueddeutsche-zeitung-das-selbstbesti/modTrackback