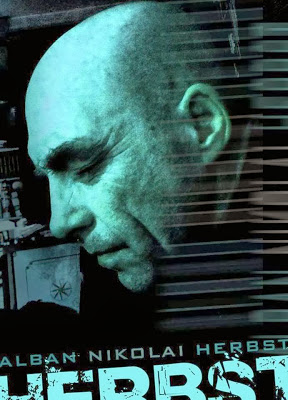Entwuerfe
Yüe-Ling (1). Verklären wollen. (Aus dem Entwurf).
Alice in Gesaraland (2): Schwäne und Häs‘chen.
...wie sich in ganz Gesaraland und auf dem Gesarameer eigentlich gar nichts richtig bewegt, sondern alles immer nur wartet und weiterwartet, bis entweder alle Menschen, die es vielleicht einst einmal gab, zu Tieren geworden sind und Gesara selbst zu einem Baum wird oder zu einer anderen Pflanze, obwohl sie manchmal auch schon selbst Tier war, zum Beispiel, wenn sie sich auszieht und dann ein richtiges Fell unter dem Kleid hat. Weil nämlich die Schwäne in Wahrheit gar nicht erlöst werden wollen, sondern sie wollen, daß auch alle anderen Menschen zu Schwänen werden. Das sind keine guten Häs‘chen, Papa, sondern die sind richtig gemein. Genau dafür haben sich die beiden auch verabredet, genau das haben sie vorgehabt, was man an den Ohren sehen kann, die Gesara da schon gewachsen waren. Das ist aber nicht das schlimmste dabei, sondern daß ich Gesara das nicht sagen konnte, weil sie mich ja einfach nicht wahrnahm. Daß ich merken mußte, es ist völlig vergeblich, wenn man sie da rausholen will. Weil das auch keine wirklichen Tiere, sondern so alte Spielzeuge sind, die man aufziehen kann, und dann tun sie eben so, als ob sie echte Tiere wären. Eigentlich war nur der kleine Eisbär echt. Darum hat er auch so geschrieen, weil er das eben gemerkt hat und wußte, daß er, wenn er aus der Kiste herausklettern würde, von den anderen Tieren ja doch nur für immer verzaubert werden würde.
Ja aber wozu?
Damit er für alle Zeit als Spielzeug leben muß und nicht etwa sich eines Tages, wenn er groß ist, eine Eisbärin suchen kann, mit der er darauf achtet, daß ihre Kinder wachsen können und nicht wie im Gesaraland für immer klein bleiben müssen. Das Gesaraland will, daß alle immer klein und hilflos bleiben, und wenn man davon berührt wird, will man das selber auch. Deshalb mußte ich da schnell weg, obwohl ich Gesara doch helfen wollte. Und das auch immer noch will.
Es ist doch nur ein Traum gewesen, Junior.
Nein, Papa. Das war nicht nur ein Traum. Guck hier, das hab ich von dort mitgebracht: -
Wölflingsthor (2).
Ich hatte überhaupt keine Lust mehr auf Frau Schneider. Außerdem wurde Rulle natürlich doch bestraft. Obwohl er gar keine Schuld hatte. Und auch an uns ging das nicht ohne Strafe vorüber.
„Ihr seid ein solches Katastrophen-Quartett!” rief Frau Klicker. Da fiel unser Name zum ersten Mal. Obwohl wir doch, wenn man Frau Schneider mitrechnet, ein Quintett sind.
Natürlich war das ungerecht. Aber als Herr Niebel mit seinen beiden toten Wellensittichen in der Hand bei sich zuhause ankam, da hatte sich schon eine riesen Menge vor seinem Haus versammelt. Die Leute starrten alle zur Garage und zeigten mit den Fingern aufs Dach. Da stand nämlich, erzählte Kaiser, der Porsche oben drauf. Das war für die Leute genau so unfaßbar wie für meinen Vater sein Klavier in dem Baum. Auch die Polizei konnte das nicht erklären. Aber sie fand das Garagenfenster ausgehakt. Und Rulle war drinnen was aus der Tasche gefallen. Das fand man jetzt auch. Außerdem hatten uns Nachbarn von Herrn Niebel gesehen, daß wir fast eine Woche lang da vorm Haus, so nannten das die Leute, ‚herumgelungert’ haben... - von wegen ‚gelungert’! Jedenfalls erkannte man uns wieder. Das war sehr unangenehm, das war sogar scheußlich. Und zwar konnte man uns mit dem Porsche natürlich nichts nachweisen, weil wir ja auch nicht wußten, wie der da raufgekommen war. Aber weil die Innentür von der Garage in das Haus von Herrn Niebel nie abgeschlossen ist und weil der Vogelkäfig immer noch aufstand, dachten jetzt alle, wir hätten die Wellensittiche rausgenommen und ermordet, um uns für die schlechten Zensuren von Herrn Niebel zu rächen. Dabei konnte das auf jeden Fall nicht für Kaiser stimmen. Außerdem war Rulle der einzige, der schmal genug war, um überhaupt durch dieses Seitenfenster zu passen. Deshalb bekam er auch den meisten Ärger. Vor allem mit seinem Zuhause. Zusätzlich kam jetzt heraus, daß wir fast die ganze Woche lang die Schule geschwänzt hatten.
Wir versuchten alles, den Leuten zu erklären, worum es in Wirklichkeit ging. Wir versuchten, ihnen die Gefahr zu erklären, die von dem KEN ausgeht und daß Herr Niebel ein Agent von KEN ist, und daß das Kommitee mit der Mafia zusammenarbeitet, die Rulles Laden abgebrannt hat. Aber keiner glaubte uns. Das Schlimmste war, daß nicht nur die Lehrer gegen uns waren, sondern jetzt auch die anderen Schüler, weil die mit den Wellensittichen alle so ein Mitleid hatten. Obwohl jetzt klarwar, daß uns Herr Niebel mit seinem Porsche betrogen hatte. Daß gar nichts von seinen Aufrufen stimmte, wir müßten auf die Umwelt achten, man dürfe kein Auto fahren wegen der Abgase und so.
Wölflingsthor 1 <<<<
Wölflingsthor (1).
„Und wenn das ein böser Geist ist?” fragte sie.
„Frau Schneider ist gar kein Geist”, sagte ich. „Frau Schneider kommt von einem Wolfsstern, sagt sie.”
„Jedenfalls ist ‚Frau Schneider’ ein ziemlich ruller Name für einen Astronauten”, sagte Rulle.
„Für eine Astronautin”, sagte Shaleh.
Daß Frau Schneider ein Mann ist, wußten wir ja noch nicht. Jedenfalls ist sie etwas anderes als eine Frau. Was daran liegt, sagt Frau Schneider, daß ihre Leute sowas wie Frau und Mann gar nicht kennen. Sie haben zwar Kinder, aber die finden sie im Thorswald. Weil sie an Bäumen wachsen. Manchmal bin ich mir nicht sicher, ob uns Frau Schneider nicht Unsinn erzählt.
>>>> Wölflingsthor 2
Yeşim. (Aus einem Entwurf, 1).
(...)
Eine trug das Kabelschloß ihres Fahrrads, das sie schob, um die Hüften, die viel zu breit warn, was man nur deshalb bemerkte. Eine war bis unters Kinn vermummt, als wäre schon Spätherbst; doch an den Füßen trug sie hohe durchbrochene Pumps, die Zehennägel leuchteten wie Himbeern über die Straße. Ihre Fersen waren schmal wie die Rücken silberner Messergriffe, beidseits die Knöchel glichen den provozierenden Versen der verlorenen Suren. Ich, Carah, folgte ihr, der vor Verlangen erblindete Sucher. (...)
Mein ist die Rache.
„Mein ist die Rache“, >>>> spricht der Herr. Da es aber keinen gibt und zugleich der Satz der Rache, indem Gott gerecht ist, eine moralische Seinsberechtigung zugespricht, geht der Racheauftrag an den von Gott verwaisten Gläubigen über. So w i r d Gott wieder, ja der Rächende Gott.
„Wenn ich nun bald vor seinen Thron trete“, sagte der angeklagte Mörder vor Gericht, „so als Gleicher, dem er sich selbst zu verdanken hat – daß er wieder wurde. Trete ich nicht vor seinen Thron, weil es ihn, wie die Atheisten behaupten, tatsächlich nicht gibt, dann habe ich so oder so nicht unrecht gehandelt, denn kein Unrecht wäre dann. Ich hätte dann nur ausgeglichen.“
Der alte, von den Spuren seiner Krankheit bereits gezeichnete Mann sprach fest. Ein Schimmern des Hinübers leuchtete durch seine Haut. Als würden tief am Grund seiner Augen Zündhölzer angerieben, traf die Richter aus ihnen von Zeit zu Zeit ein Funke, wie wenn man in einen Kerker, der ein Schlauch aus Schwärze ist, gesperrt ist und sieht weit entfernt ein erleuchtetes Fenster. Die Hände des Mannes, die er langsam und abwechselnd hob, um Bedeutungen zu unterstreichen, waren transparent wie bei Engeln. Er machte nicht den Eindruck von Wirrnis, sondern von Weisheit.
„Aber weshalb“, wurde er gefragt, „haben Sie mit der Rache gewartet, bis kurz bevor Sie selber sterben?“
„Damit nicht Gott gerichtet wird.“
Er hatte eine Liste geführt, sie führte bis siebzig Jahre zurück. Namen und Orte; Taten, die ungesühnt geblieben waren; ausgezeichnete Bürger darunter, bekannte Namen wie unbekannte, Persönlichstes mit Politischem wie unentwirrbar verschlungen; aber hinter jeder Eintragung stand ein Grund. Vor dem vierzehnten Verhandlungstag ging er im Krankenbett ungesühnt hinüber. Es war ein heller Dienstagmorgen, hoch stieg die Sonne und wärmte die Toten.
Plots.]
Erste Heidelberger Vorlesung (1). Skizze des Anfangs.
wir stehen heute ästhetisch – womit ich die Audruckshaltung der literarischen Künste meine – in einer bizarren Situation. Die Entstaubung der deutschen Sprache und Dichtung, die ungefähr in den Zwanziger Jahren, etwa mit Benn, begann und sich nach der miesen Zwischenzeit des Hitlerfaschismus noch einmal aufmachte, zugleich mit den ideologischen auch die sie verschleiernden sprachlichen Verkrustungen abzuschlagen, das falsche - ich betone bewußt: falsche - Pathos, die Bigotterie, die Selbstfeier, und die an die Leerstellen des Kahlschlags eine lebendige, dem Alltag, also der Lebenswirklichkeit der Leser zugewandte Umgangssprache setzen wollte, hat sich nunmehr derart den Interessen eines eben diese Lebenswirklichkeit bestimmenden Marktes zugeneigt, daß, was einmal, auch und gerade in den Endsechzigern, progressiv gewesen ist, regressiv geworden ist. Wer heute noch meint, möglichst profan schreiben zu müssen, trägt nicht Eulen nach Athen (versteht noch jemand den Grund dieses Sprichworts? und wir verwenden es dennoch?), sondern Kofferradios in Diskotheken, bzw. Clubs. Da schaltet man sie an und sucht, indes der Techno pulst, nach Sendern.
Die Dynamik dessen, was Adorno und Horkheimer „Dialektik der Aufklärung“ nannten, durchdringt auch die Sprache, so daß es wohl sein kann, daß der pathetische Ausdruck, der nicht profaniert und profanieren nicht länger w i l l, die rebellische Funktion der Sprachentstauber übernommen hat und nunmehr gerade dasjenige für Widerstand steht, was vor vierzig, bzw. neunzig Jahren plakativste Affirmation gewesen wäre. Hätte Ezra Pound seine „Frauen von Trachis“ wie ein Hölderlin nachgedichtet, wäre das Stück im Faltenwurf bürgerlich-repräsentativer Roben erstickt und hätte keinerlei Kraft entfaltet; schriebe es aber heute einer in diesem energisch-laxen Jargon des Alltags, es fügte sich ganz ebenso in Verkrustung. „Verkustung“ ist eben heute nicht mehr das, was mit so hohlem wie hohem Ton repräsentiert, sondern was sich umstandslos an den Konsumenten bringen läßt – wozu es die Allgemeinverständlichkeit braucht, das leicht Inhalierbare, leicht Verstoffwechselbare und das Flüchtige eines Artikels, der sich für – um es in der bezeichnenderweise US-amerikanisierten Sprache dieses Marktes auszudrücken – product placement eignet. Denn die repräsentative Funktion der Kunst ist nach wie vor in Kraft; nur eben dient sie nicht länger Eliten oder gar Oligarchen als Spiegel, sondern der demokratischen Menge; aus der ermittelt man ein arithmetisches Mittelideal und schmirgelt die Kunst darauf ab. Auf diese Weise entsteht der gewollte, kalkulierte Bestseller, wie wir ihn vor allem aus den Produktionen Hollywoods, unterdessen aber eben auch des Buchmarktes kennen. Wenn man nicht, wie es aber den Anschein hat, die Kategorie des Widerstands als eines grundwirkenden Elements aller Kunst aufgeben will, bleibt den Künsten gar nichts anderes übrig, als auf die deutliche Gefahr ihres Untergangs hin sich gegen die leichte Konsumierbarkeit zu stemmen.
Aber sie machte überall hin.
D a s erst, nichts anderes, öffnete mir Planck und Berkeley. Doch kaum begaben wir uns auf den Begrüßungsempfang... und nicht etwa verstohlen in die Ecke, nein: immer, auch jedesmal später, machte sie mitten in den Raum. Jemand will eine Rede halten, Sie stehen beisammen, und plötzlich flüstert Ihnen Ihre Frau ins Ohr: Ich muß mal eben... hebt den Rock und hockt sich hin.
Da fragen Sie mich ernsthaft, weshalb ich wieder allein bin? Und weshalb ich hier hinten eingesetzt wurde? So fleißig, aber geduckt bin? Eine solche Karriere verlor? Ah, ob ich mich sehne? Ich w e i n e, Frau Christians, ich weine im Innern von früh bis spät. Wie glücklich hätten wir werden können! Wäre das nicht gewesen.
Kleinsterzählungen/Divertimenti.]
Die schöne Elisabeth Schneider. Entwurf. (1).
Verwirrt lenkte er den Blick zur Seite; er war ganz matt, als wäre etwas Trübes in die normalerweise ausgesprochen harten Augen geraten.
“Das kann nicht sein”, sagte Manfred.
“Also komm schon, w a s kann nicht sein?”
“Erinnerst du dich an Betty?”
“Betty? – Momentan…”
“Elisabeth Schneider.”
Dämmerig kam mir eine Kommilitonin in den Kopf, mit der wir die ersten paar Semester studiert hatten; sie war dann aber nicht mehr zur Uni gekommen, mit Beginn des Sommersemesters vor anderthalb Jahren, wenn ich mich jetzt richtig erinnerte. Eine hochintelligente, in ihren Repliken wohl ein bißchen zu spitze, körperlich ziemlich unauffällige Frau; indessen machte ihr Ehrgeiz auf sich aufmerksam, zumal sie sich mit hoher Aggressivität in sämtliche gender-Diskussionen mischte, die sie zudem in unsere juristischen Seminare trug. Das hatte etwas ebenso Gequältes, wie es ausgesprochen lästig gewesen war. Insgesamt hatte Betty wie die Vertreterin längst erstrittener Frauenrechte gewirkt; ihre zotteligen Kleider hatten selbst dann noch eine Tendenz zum Violetten, waren sie knallegrün. Dazu dann sommers die unvermeidlichen dicken Sandalen und im Haar bunte Schnüre, die durch Holzperlen und, glaube ich, einigen esoterischen Billigschmuck gefädelt waren. Ebenso zottelige Tücher waren meist, auch wenn es sehr warm war, um ihren Hals geschlungen und über die Schultern geworfen.
Ich habe Betty nie in Begleitung gesehen, fällt mir noch ein, auch nicht in Begleitung anderer Frauen. Sie hatte bloß immer diesen Cipboard bei sich, vierfünf Blatt eingespannt, am Band einen Kuli, so schrieb sie mit; über der Schulter eine Art Jutesack, aber das setzt wahrscheinlich meine Fantasie jetzt hinzu.
“Und was i s t mit Betty?”
“Ich habe sie eben, glaube ich, gesehen.”
“Ja und?”
“Sie ist wunderschön.”
Ich hätte fast meinen Bissen über den Tisch gespuckt. Zum einen paßte eine solche Bemerkung absolut nicht zu meinem sonst so