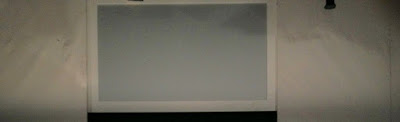|
|
Oper
[Fotografien (c.): >>>> Matthias Baus]
Wir sollten uns ausmalen, welch furchtbarer Zauber – ein Teufelszauber fürwahr – diese Inszenierung gewesen wäre, hätte sie bereits auf die einzigartige Bühnenmechanik der noch im letzten Umbau befindlichen tatsächlichen Staatsoper Unter den Linden stattfinden können und nicht unter den nicht nur klanglich, sondern eben auch opern technisch eingeschränkten Bedingungen des Schillertheaters. Ein Höllenzauber wurde Terry Gilliams Interpretation gleichwohl, selbstverständlich ohne Zauber, schon gar nettkommensurable quasi Comic-Ironie – wenn man von Fausti Frisur einmal absieht: eine Anspielung wohl auf die pädagogischen Sadismen gleichermaßen >>>> Heinrich Hoffmanns wie >>>> Wilhelm Buschs. Denn weniger wie ein Burschenschaftler kommt dieser Faust daher als mehr wie ein Primaner oder Oberprimaner vor der vorletzten Jahrhundertwende oder von noch früher.
Jedenfalls haben wir es bei Gilliam und aber auch Berlioz von Anfang an mit der Hölle zu tun und ihrem verklärten Gegenbild: dem, wovon sie ihren Ausgang nahm, der ins Erhabene idealisierten Natur. Genau dies stellt auch Rattles Dirigat klar: Nirgendwo habe ich so sehr die genial komponierte Gemeinheit einiger Schlüsselmusiken Berlioz‘ deutlicher gehört wie gestern abend in der Staatsoper. Sei es, daß zum vulgären ungarischen – ecco! – Marsch ins Nationalbewußtsein nicht passende Menschen erschossen werden, sei‘s, daß das studentische Gaudeamus igitur zu einer von Haß und Widerwärtigkeit nur so berstenden Gesangsnummer wird: Gruppen„geist“ wird zum Grölen der Meute.
Besonders widerlich wird es aber schon bei des Branders Hohnlied in Auerbachs Keller („Im Ofen glaubte die arme Seele,/sich verbergen zu können./Aber sie irrte sich/- und noch schlimmer-/zu guter Letzt wurde sie dort gegrillt“), das von choralem Aufgrölen und dieses durch ein fugiertes, von dumpfem Schlagwerk ausgehöhltes „Amen“ abgeschlossen wird. 
Nein, angenehm ist das alles nicht. Sondern es dreht uns den Magen um. Es führt uns vor Ohren, was war und aber, steht zu befürchten, weiterhin ist. Genau das mag die, nachdem der letzte Vorhang fiel, extremen Buh!s erklären, die vor allem aus den hinteren Reihen zu vernehmen waren. Man läßt sich den Spiegel nicht so gerne vorhalten, schon gar nicht derart intensiv in der Oper.
Gegen den herausgeschleuderten Unmut stellten sich freilich auch Bravi, unter einigen anderen auch meine. Und dies, obwohl auch ich meistens genervt bin, wenn „mal wieder“ Nazi-Szenarien auf einer Bühne bemüht werden. Aus Überdruß freilich, und weil es in aller Regel bei puren Behauptungen oder Aufstülpungen bleibt.
Genau das ist in Gilliams Inszenierung nicht der Fall. Sondern er entwickelt sein Szenario direkt aus Libretto und Partitur und aus der Verklemmungs- und Nationalfindungsgeschichte Deutschlands seit dem Biedermeier. Es läßt sich ja durchaus von der Geburt des deutschen Faschismus aus dem Ungeist der Restauration sprechen – anders als für Frankreich oder gar England, wo das schließliche Nationalverständnis revolutionäre Quellen hatte, die im Volk selbst (zumindest mit)entsprangen.
Diesem, dem Volk, ist der berliozsche Faust allerdings fremd, anders als Goethes. Hier ist es gerade die Flucht in „reine“ Innenwelten, die schließlich seine Hinwendung zum Faschismus begründet.
Dieser Faust ist im Wortsinn ein innerlicher Mitläufer: Die säkular ritualisierten Regeln scheinen ihm die Differenz abzuheben, die er zum „einfachen“ Volk immer gespürt hat; zunehmend fühlt er sich im Volkstum und in seinem Streben aufgehoben, ohne daß er doch sein Eigenes verraten müßte. Nicht grundlos zitiert das Programmheft Klaus Manns auf der Karrieregeschichte Gustav Gründgens‘ basierenden Mephistoroman: Der „deutsche Künstler“, vordem bestenfalls Lakai und vom Volk in aller Regel verlacht, erhält nicht nur gesellschaftliche Reputation, sondern wird zur zentralen Idealfigur.
Daß er dabei an „wesentliche“ Ideologeme des Regimes gar nicht glaubt, ist die dem berlioz‘schen Faust inneliegende Tragik, bzw. die vom Teufel ausgelegte Rute, auf dessen Leim er tritt. Fausts Seele wird von Mephistofele geholt, weil er, Faust, sich ihm verschreibt, um die als Jüdin deportierte Marguerite zu befreien. Da auch erst zeichnet er den Vertrag – also indem er Gutes tun will.
Böser, in der Tat, lassen sich des Teufels berühmte Worte bei Goethe überhaupt nicht deuten: „Ich bin ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft.“ Daß dieser Satz umkehrbar ist, beschreibt das sich gegen Faust wendende Verhängnis.
Man muß fast mit Kant argumentieren: Weil er an Marguerites Befreiung ein persönliches Interesse hat, ist sein Wille und Handeln nicht moralisch. Und zwar hat er selbst keine Untaten begangen, aber tatenlos ihnen zugesehen. In die Hölle kommt er nicht als Täter, sondern als Mitläufer. Dazu, ein solcher zu sein, genügt schon, daß man nicht aktiv im Widerstand war, auch wenn man, so Erich Kästner, die Faust in der Tasche ballte.
Härter, zugleich aktueller und darum provokanter kann die Botschaft eines Regisseurs gar nicht sein. Nix mit >>>> Jabberwocky, meine Damen und Herren, den einiges Publikum wahrscheinlich erwartet hatte. Also nicht die Spur verspielter und angeblich postmoderner Beliebigkeit – auch dann nicht, wenn sich Gilliam meisterhaft postmoderner Formen bedient.
Es ist absolut schlagend, mit welcher Meisterschaft er sich, obwohl an die Bühnenwirklichkeit immer wieder zurückgebunden, filmischer Mittel bedient. Dazu gehört nicht nur der Trick, vermittels aufprojezierter, sich zunehmend schneller bewegender Bäume ein rasendes Dahinfahren vorzuführen, derweil die Akteure tatsächlich auf der Stelle bleiben; dazu gehört vor allem auch >>>> Hildegard Bechtlers sozusagen bühnenbildnerischer Hyperlink auf der Wachowskis >>>> The Matrix. Aber auch schon Fausts Studierzimmer als einen über >>>> Berchtesgarden - bzw. Motiven nach Caspar David Friedrich - quasi frei im All schwebenden Minimundus zu zeigen, ist postmodernen Bildwelten verdankt. Manches erinnert auch an Arbeiten >>>> Hans Jürgen Syberbergs. 
Geradezu genial auch, daß Faust Marguerite in ihrem Zimmer die Füße wäscht; hier rückt der christlicher Ritus die tatsächlichen Verhältnisse ins Bild, die Faust auch spürt, sich aber nicht bewußt machen kann oder will. Sonst wäre er da schon aufgebrochen, mit ihr, um dem Unheil zu entkommen. Bei Gilliam wird diese Fußwaschung quasi zum Judeskuß. Wenig später erscheinen die Schergen.
Überhaupt ist eine – notwendige - Besonderheit dieser Inszenierung die Rollenauffassung Marguerites. Gilliam gelingt mit Magdalena Kožená eine Befreiung. Ihr Gretchen ist nämlich alles andere als naiv; ihr wird auch nicht ein Baby „angehängt“. Die Frage, weshalb ein, sagen wir mal, Intellektueller ausgerechnet von einem Backfisch erotisch attrahiert wird – etwas, das mir den Stoff von Faust I immer absurd und lähmend hat erscheinen lassen -, erledigt sich bei Gilliam von selbst. Als Naivchen verkleidet sich diese Marguerite nämlich nur: um als dunkelhaarige Jüdin nicht aufzufallen. Deshalb trägt sie, wenn sie ihr Zimmer verläßt, blonde Zöpfeperücke und Dirndl. 
Wobei Faust selbst davon spätestens nach dem ersten Stelldichein nicht mehr getäuscht ist; um ihr hochgradiges Gefährdetsein weiß er also. Und zeigt sie selbstverständlich nicht an. Sondern das tut der Teufel, der es auch war, Faust zum ersten Mal in die nationalsozialistische Gesellschaft einzuführen.
Gerade, daß Faust solch ein Sinnsucher, darum vereinsamt und voll melancholischer Liebessehnsucht, also empfänglich für gesellschaftliche Anerkennung ist, macht ihn für Mepho so schmackhaft. Er wird über seine innere, die objektive Wahrheit verdrängende Wahrhaftigkeit stolpern und dann in die Hölle im Wortsinn hinab jagen, derweil er doch glaubt oder sich vormacht, hinauf auf dem Wege zu Marguerites Befreiung zu sein. Mit einer deutlichen Anspielung auf den Weltenbrand am Ende von Wagners Götterdämmerung geht er in Flammen auf.
Auch dieses Bild zeigt, wie genau Gilliam konstruiert hat. Im ersten Teil des Abends imaginiert sich Faust nämlich als Siegfried, der sich in dem gleichnamigen Bühnendrama, abermals Wagners, neben Brünnhilde in den Flammenring legt, treue(!!)halber Notung zwischen sich und ihr. In der perfiden Logik des Nationalsozialismus ist der Künstler – oder sagen wir: das Genie – zum Helden geworden.
Hält man sich vor Augen, daß der Geniebegriff ein emanzipatorischer war, der die Künstler aus dem Lakaientum holte, wird die politische Perversion an dieser Stelle eklatant: als Held ist der Künster nicht wieder nurmehr Lakai, sondern soldatisch geworden; freiwillig und widerspruchslos Befehlsketten unterworfen, egal was die Befehle verlangen.
Genau das nicht gesehen oder zu sehen gewollt zu haben, wird zurecht mit der Hölle bestraft.
Nun ist das Problem dieses Musikstücks wie schon bei Goethe der Teufel. Theologisch gesprochen ist er unsres aber sowieso. Denn letztlich ist alleine er es, der die Dynamiken bloßlegt. Fast möchte man meinen, er ersehne, daß jemand seinen Leim auch sieht. Als würde ihn das erlösen. Daß es niemand tut – das wird bei ihm zu Zynismus. Deshalb kann er bei jedem Gemeuchelten nur noch lauter lachen. So gesehen, ist seine Einsamkeit die einzig echte. Von Gott ist außer ihm nichts zu hören – der, wenn überhaupt, taucht allenfalls wie weiland der Sonnenkönig bei Moliere auf: ex machina und süßlich in Marguerites Himmelfahrt. Das Gold, in das sie hier gebettet wird, ist nichts als tander Schein. Wär es nicht noch böser, man wollte >>>> H.C.Artmann zitieren:
durch den schornstein
geht es ins himmelreich
bedenks
durch den schornstein
da zieht der rauch
so leicht -
komm mit ...
(...)In diese Apotheose (Artmann: „verbrannt/wird deine hand/und zu rauch/und zu aschen auch“) ruft Mino Kinoshitas Stimme: „Komm, Margarita!“ /und dein haar
und dein kopf
und dein leib
und dein fuß
wird zu schönem
wirklich
schwarzen ruß -
komm mit ...
 *
>>>> Florian Boesch singt und spielt den Méphistophélès mit am Unheil geradezu schon verzweifelter Lust. Deshalb hat sein Triumph am Ende einiges Bittere, gegen das er sich nur wieder in neue Schale, neuen falschen Vorschein werfen kann. Es mag ein utopisches Element sein, daß Gilliam ihn, nachdem Faust in Flammen aufgegangen ist, auch den Vertrag verbrennen läßt. Der im Sekundenbruchteil verzischt. Nur einen Menschen endlich sehen, der ihm, dem Verführer, widersteht – ja nur versuchte, es zu tun! Er wäre dann erlöst wie >>>> Stokers Dracula, „da im Augenblick der endlichen Auflösung ein Schimmer von Glück über des Grafen Anlitz huschte, das ich eines solchen Ausdrucks gar nicht für fähig gehalten hätte“. Vielleicht, daß wir dann in ihm – Gott erkennten? Der ohne das abwesend bliebe.
Vergleichsweise einfältig dagegen – weil unbegriffen eindimensional – >>>> Charles Castronovos Faust, dessen lyrische Inbrunst freilich – goethetreu darin – von Werther hergenommen wirkt. Was allerdings wollte eine Frau wie der gnadenlos guten >>>> Magdalena Koženás Marguerite von einem sentimentalen Hampelmann wie Faust? - Seltsam, wie sich hier die Attraktionen für mich umkehrten und nicht mehr Gretchen die langweilige Person des Stückes war. Allein die tumbe Ungelenkheit, mit der sich Faust in ihrem Zimmer auf sie legt, noch die Knobelbecher an den Füßen... - Wäre wohl Mephisto ihr gewachsen gewesen?
So sind sie alle also - trotz oder gerade wegen seines Witzes auch Méphistofélès - v e r f a l l e n --- geworfen, um es mit Heidegger zu sagen. Was in diesem Zusammenhang schmerzhaft pikant ist, vielleicht auch unlauter. Der ja gerade wäre für den Faust eine ideale Figurbesetzung gewesen – so, wie man in einer französischen Inszenierung den Teufel vielleicht nicht, wie hier zuweilen im Mittelteil, in eine Wehrmachtsuniform stecken, sondern als >>>> Petain kleiden sollte.
Wie nun auch immer, Simon Rattles Dirigat läßt dieses Geworfene, Verfallene, Böse wirklich Klang werden; es geht ihm dankenswerterweise nicht um Schönklang, sondern vor allem um eines: Ausdruck, Ausdruck und nochmals Ausdruck. Das darf nicht nur, sondern soll oft scharf klingen – und muß es. Vergleichbar Radikales habe ich bislang nur auf >>>> Igor Markevitschs Einspielung aus dem Jahr 1959 gehört. Ich wäre ausgesprochen gespannt darauf gewesen, wie sich diese Inszenierung am Teatro Massimo in Palermo angehört haben wird, mit dem sie – und mit der English National und der Vlaamse Opera – coproduziert wurde. Daß sie erst fünf Jahre nachher in Berlin aufgeführt wurde, ist ein Rätsel, das ich noch nicht lösen kann. Immerhin finden sich Auszüge aus Palermo auf Youtube:
Jedenfalls... wer diese Inszenierung verpaßt, nun jà, was soll man zu der und dem sagen? Nur das schreckliche Brodeln ihrer großen Flammenseen und das Zähneknirschen ihrer Folterknechte beim Martern der Seelen war noch zu hören. (Berlioz, Damnation, Auf der Erde.)
*
Hector Berlioz
LA DAMNATION DE FAUST
Légende dramatique en quatre scènes
Inszenierung Terry Gilliam – Bühne Hildegard Bechtler – Kostüme Katrina Lindsay
Licht Peter Mumford – Video Finn Ross – Regiemitarbeit/Choreografie Leah Hausmann
Magdalena Kožená – Charles Castronovo – Florian Boesch
Jan Martiník – Mitho Kinoshito
Chor: Martin Wright
Staatskapelle Berlin
Simon Rattle
Die nächsten Vorstellungen:
1., 4., 9., 11 Juni, je 19 Uhr
>>>> Karten albannikolaiherbst - Sonntag, 28. Mai 2017, 15:26- Rubrik: Oper
 Ich hatte, wann immer ich diese Oper hörte, ein Unbehagen. Ich las das Textbuch, das Unbehagen wurde größer. Gesehen hatte ich Brittens letzte Oper nie. - Ein ‚Zufall‘? Denn dem speziellen Melos all seiner anderen Stücke für Gesang und Orchester bin ich geradezu verfallen, seien sie nun kurz oder abendfüllend.
Wurde das Stück in meiner Nähe nur nie gespielt?
Was war hier anders, ist anders? An Brittens Homosexualität konnte es nicht liegen; sie liegt nackt auf der Hand. Er hat sie auch niemals, anders als Thomas Mann, verstellt oder – um ein bißchen >>>> Heinrich Detering zu travestieren – camoufliert. Britten lebte bis zu seinem Tod in Gemeinschaft mit Peter Pears, für den er nahezu alle Tenorstimmen schrieb. Selbst in der prüden englischen Gesellschaft waren die beiden öffentlich ein Paar. Das zeugt von einem ebensolch radikalen Mut wie sein Pazifismus. Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs verweigerte er den Wehrdienst, floh in die USA, kam aber noch während des Krieges zurück, um seine Entscheidung vor Gericht durchzufechten. Die Berufungsinstanz gab ihm recht.
Er hatte auch künstlerisch vieles auszuhalten.
Zu weiten Teilen sah ihn die europäische Avantgarde als musikästhetischen Reaktionär; tatsächlich lag sein kompositorischer Beginn im Neoklassizismus - ein Umstand, den Britten in seiner letzten Oper auch thematisiert. Anders als aber Britten ist Aschenbach, ihr Zentrum, den wertkonservativen Weg weitergeschritten. Es besteht ein deutlicher Unterschied zu den eigenwilligen Formen der Tonsprache, die Britten seit der Simple Symphony so weitgehend entwickelt hat, daß man von einem „Brittensound“ sprechen muß – einem melodischen Klang, der zuvor unerhört war und für ihn alleine charakteristisch ist. Einen Britten erkennt man wie Beethoven, Wagner, Bach; es reichen ein paar Takte.
Gustav von Aschenbach, der es als klassizistischer Dichter zu Ruhm und Ansehen gebracht hat – was er auf das unangenehmste immer wieder betont –, doch seine Schaffenskraft ist erlahmt --- Aschenbach also reist nach Venedig, um im Süden neue Inspiration zu finden. Zumal will er nicht, daß die bürgerliche Gesellschaft, deren Kunstregeln er strikt wie all ihre anderen Konventionen befolgt, seine Schwächung bemerkt. Er kann sie nämlich nicht in weiterer Kunst sublimieren, schon gar nicht offen thematisieren. Wir schreiben das Jahr 1911, im (Groß)Bürgertum blüht der soziale Darwinismus. 
Da Sublimation das Handelsgesetz dieser verstaubt konservativen Gesellschaft ist, kann Aschenbach als Künstler des Establishments kein Wüterich sein, schon gar kein Revolutionär. Statt dessen teilt er dessen bei ihm durch und durch formgewordene Verklemmtheit – als persongewordene Sublimation sozusagen selbst.
Es ist die drückende Hitze der venezianischen Sonne, was dies aufweicht. >>>> Stuart Nunn zeigt es im Gelb des Bühnenbildes. Es gibt aber auch belebte Zeichen, die Aschenbach begegnen – allesamt Figurationen, die meist als Symbole des Todes interpretiert werden, gerade auch in >>>> Graham Vicks Inszenierung, sowie in den Programmheftbeiträgen, etwa >>>> Norbert Abels‘. Sei es der düstre Gondoliere, sei es ein als Geck verkleideter Greis, sei es der zwölfjährige Tadzio selbst, auf den sich zunehmend Aschenbachs Begehren richtet. 
Aus einem anderen Verständnis ließen sich alledie aber auch als Boten einer Befreiung zur Weltlichkeit verstehen – einen Weg, den weder Thomas Mann noch leider Britten gegangen sind, noch seine Interpreten gehen.
Da muß man sich fragen, weshalb. Daß Befreiung in den Tod führt, ist ja gerade die üble Ideologie der, mit Marx gesprochen, Bourgeoisie.
Ich fürchte, die Antwort ist auch darauf eine, weshalb schon Thomas Manns Der Tod in Venedig, also die Vorlage für >>>> Myfanwy Pipers Libretto, als ein erster moderner Schlüsseltext homoerotischer Literatur gelesen wurde – und bis heute wird – anstelle als das, was er tatsächlich ist: eine bei Mann fast unerträglich schwüle Verklärung der Pädophilie mit allerdings homosexueller Ausrichtung. Dieses vor Augen, wird einem die Notwendigkeit des Sublimierens auf das erschreckendste klar. Nicht gleichgeschlechtliche Liebe muß „umgedeutet“ werden, eine Form jenseits ihrer Realisierung bekommen, sondern die Knabenliebe ( Pädophilie kommt gr. Παῖς, Knabe, Kind“ und φιλία, Liebe). „Mortal child“, sagt Aschenbach, „with more than mortal grace.“ Er assoziiert das Kind mit dem Tod. Perverser geht‘s imgrunde nicht. Auch wenn Aschenbachs Projektion an die Huris des Paradieses erinnert, so sind diese zwar Jungfrauen, doch eben Frauen und nicht etwa Kinder.
Nicht grundlos beruft sich Pipers Libretto auf Platons >>>> Phaidros, der nicht nur der Liebe alter Männer zu Knaben die philosophische Basis gibt, sondern insgesamt der seinerzeit gesellschaftlichen Praxis. Man glaubte, ein Junge werde in dem Moment zum Mann, in dem sein Samen in den Mentor fließe; dafür fließe von jenem die Weisheit in jenen zurück.
Entsprechend fragt Aschenbach den kleinen Tadzio: Does your look to me for guidance?Und bestärkt ins zweideutig Eindeutige: Do you look to me?Mehr aber noch, so Platon, begründe sich die erotische, also von Begehren geschürte Liebe der alten Männer zu den Jungen darin, daß Schönheit die einzige sinnliche Manifestation des Wahren, ja des Göttlichen sei: Beauty is the only form
Of spirit that our eyes can see
So brings to the outcast soul
Reflections of Divinity.Auf diese Weise wird das sexuelle Begehren zu einem Knaben zum Begehren nach dem Wahren idolisiert, was nunmehr unsere Gegenwart in, sagen wir, Musikgenuß zurücksublimieren muß, andernfalls die Deutsche Oper Berlin von einem Proteststurm sondergleichen dem Erdboden gleichgemacht würde.
Dabei verdeckt Graham Vick den lauernden Skandal überhaupt nicht – wahrscheinlich die Stärke der Inzenierung. Er legt ihn vielmehr bloß. Kein Bild hier ist uneindeutig.
Aber die Sublimation - in diesem Fall eine Maskierung, darin der König nackt geht - vollzieht sich dennoch, nämlich in der vorgeprägten Übereinkunft, mit der Zuschauerinnen und Zuschauer die teils ausgesprochen stickige Lüsternheit Aschenbachs verfolgen: Es gehe alleine um homoerotisches Begehren.
Niemand, erst recht nicht das Programmheft, rührt an diesem „Mißverständnis“. Homosexualität-selbst ist ja in unserer Gegenwart kein moralisch belastetes Thema mehr, jedenfalls im westlichen Kulturkreis, der längst die – nicht abwertend gemeint – Schwulenehe kennt.
Genau diese Sublimation als Übereinkunft entspricht den Regeln des zumindest damaligen Establishments und macht Vicks Inszenierung streckenweise beklemmend, ja bisweilen ist sie nicht zum Aushalten. Sofern man sich des Grundproblems bewußt ist. Wir alle starren doch begehrend auf den Knabenkörper m i t, wollen wir das Bühnengeschehen verfolgen. „So, my little beauty“, sagt Aschenbach, als er zu dem Jungen hinüberschaut. „You noticed when you‘re noticed, do you?“ - Wobei die Regieanweisung direkt zuvor erst recht keinen Zweifel mehr aufkommen läßt:
Tadzio joins the children again.
They acknowledge him as their leader.
He walks back zu his mother.Da sind die über die Bretter tobenden jugendlichen Testosteronschleudern sozusagen nichts als Alibis, ganz zu schweigen von den jungen Frauen, die den Lido ebenfalls beleben. Alle sie sind lebende Staffagen, lebendige Spanische Wände, hinter denen immer der kleine Tadzio glost. Auch nur für den hat Aschenbach Blicke. Was der Junge aber nicht versteht. Sein Stummsein in der Oper entspricht ziemlich exakt der späteren Schweigenot früh mißbrauchter Kinder. Noch hat es aber nur die Gestalt des Verwundertseins, des Nichtverstehens.
Tatsächlich ist er noch viel zu behütet, um gefährdet zu sein. Daran läßt die Inszenierung keinen Zweifel, die seine Mutter zu einer fast allgegenwärtigen, übrigens hocheleganten Dame macht, unter deren Arroganz die Kinder wie unter Fittichen gehen.
Das freilich steht schon so im Libretto: daß Tadzio – der Junge als Aschenbachs Projektion – keine Stimme hat. Aschenbachs verklemmte Kommunikationslosigkeit ist einkomponiert. Er kann sich und darf sich eben auch nicht von ihr befreien.
Die Logik unüberwindbarer Verklemmung heißt Todessehnsucht. Denn die Rückkehr in das bürgerlich geregelte, scheinbar apollinische Leben des gefeierten Neoklassizisten ist nach dem Eingeständnis des pädophilen Begehrens undenkbar: (...) This 'I love you' must
Be accepted; ridicoulous and sacred too (...)Da rinnt auch Aschenbachs unerträgliche Selbstheroisierung wie nichts als Asche von ihm ab. ( Asche: Daß Thomas Mann in der Namensgebung seines selbstmitleidigen Helden Edgar Poes House of Usher wiederholt, muß ich wahrscheinlich nicht schreiben).
Das Eingeständnis ist die, wenn man so will, Tragik des Stücks. Denn die Erlahmung seiner Schaffenskraft, die Aschenbach, anders als Platon meinte, durch die Vereinigung mit einem Knaben keineswegs zurückgewinnen kann, verschließt die einzig akzeptable und fruchtbare Umgangsform mit Pädophilie - den einzigen Ausweg, den vor ihm etwa Lewis Carroll und Hans Christian Andersen gingen: die Kunst. Der, der die Oper geschrieben, kann ihn, indem er es tat, aber noch wählen, Britten also selbst.
Die Verbindung älterer, mindestens sehr erwachsener Männer mit Kindern, bzw. Jungen ist bei ihm auch gar nicht neu. Wie hier seine letzte, so hatte sie schon seine erste Oper, den >>>> Peter Grimes, geprägt, mit dem er Weltruhm errang; insonderheit die vier Sea Interludes werden im Death in Venice einige Male als Klangraum zitiert, vor allem in den orchestralen Aufbäumungen. Donald Runnicles läßt dies deutlich betonen.
Doch auch mit einer späteren Oper Brittens ist die Thematik verwandt.
Unüberhörbar klingt im zweiten Akt, Szene 13, ein Miles-Motiv aus >>>> The Turn of the Screw an. Darin ging es um einen - aus Sicht der aus sexueller Verklemmung hysterischen Gouvernante - seltsam bis, im Wortsinn, unheimlich frühreifen Jungen, den sein früheres Erzieherpaar „verdorben“ hat (oder angeblich habe). „Peter Quint – you devil!“ ruft schließlich der Junge selbst aus, in der Gouvernante Armen – und stirbt in ihnen.
Ein Peter Quint kann und will Aschenbach nicht werden. Also stirbt er selbst (ißt die infizierte Frucht). Das musikalische The Turn of the Screw-Motiv erscheint im Death in Venice genau dort, wo Apoll (also in Aschenbachs Welt die Gouvernante) gegen Dionysos (Peter Quint) die Niederlage eingestehen muß. „I go now“, sagt er da, distant, wie das Textbuch will. Also quasi schon weg.
Anders als in vielen anderen Inszenierungen, anders auch als in >>>> Viscontis Verfilmung der thomasmannschen Vorlage, läßt Vick >>>> Paul Nilons Aschenbach keinen Elegant sein. In scharfem Gegensatz zu Tadzios polnischer Mutter hat er imgrunde keine Form, sondern wirkt wie ein Dr. Watson in schlechten Sherlock-Holmes-Verfilmungen: zwar nicht unbedingt däppert, aber moralisch ausgesprochen begrenzt. Er scheint viel weniger zur High Society der polnischen Mutter zu gehören, als der Vorsteher in der Kanzlei eines ihrer Rechtsvertreter zu sein. Auch deshalb nahm ich ihm die von mir so genannte Selbstheroisierung nicht ab. Schon daß er sie mehrmals wiederholt, zeugt nicht von Selbstbewußtsein, sondern Mangel:
Famous as master writer
Successful, honoured,
Self-discipline my strength,
Routine the order of my days
(...)Deshalb kann er auch zur Mutter des Knaben keinen Kontakt herstellen, um sein Begehren auf diesem Weg in gute, zum Beispiel väterliche Bahnen zu lenken; er ist dieser Frau schlichtweg nicht gewachsen. Statt dessen verklärt er Tadzio zu Apolls Ehrenknaben, der, siehe oben, in Aschenbachs Fantasien denn auch erscheint. „He who loves beauty / Worships me“, ruft er aus, wie um dessen Ideologie beizuspringen und ihm dennoch die Knabenliebe zu gönnen. Ja, er bringt es sogar auf Platons Punkt:
Love that beauty causes
Is frenzy god inspired
Nearer to the gods
Then sanity.
Ausgesprochen geschickt, wie die Librettistin hier „sanity“, „Gesundheit“, einsetzt – einerseits als, sagen wir, sexual„hygienischen“ Begriff, zum anderen verweist er bereits in dieser den Ersten Akt beschließenden Szene auf die Cholera, die den Zweiten beherrschen wird. Und hier schon gesteht Apollo sich ein, Dionysos nicht gewachsen zu sein. Ebenso wird Aschenbach sein Begehren nicht mehr in den bürgerlichen Griff bekommen. Daß dessen hier sogar Freitod – ein indirekter allerdings – keine erwachsene Lösung ist, sondern unreif, darüber muß, denke ich, nicht diskutiert werden. Bis zum Schluß bleibt Aschenbach in seiner falschen Selbstheroisierung gefangen; nur daß er – indem er sich endlich, in seinen Worten, Dionysos und also seiner, der eigenen, Neigung ergibt – jetzt auch noch seine künstlerische Schwäche heroisiert. 
Angenehm ist dieser Aschenbach, jedenfalls in Vicks Inszenierung, nicht. Er ist sogar klebrig... nein, das Wort ist zu hell: Er ist backig. Schon die Vorlage, Thomas Manns Novelle, hatte diese käsige Note, wenn auch in Form eines schwül aufpompösten Stils. Nicht anders hat Visconti seine Verfilmung mit Mahlers Adagietto aus der Fünften tapeziert: in der Sinfonie selbst folgt ihr ein formstrenges Rondo, das sich am Kontrapunkt abarbeitet (dessen schließlichen Jubel Adorno aber auch schon „falsch“ genannt hat); bei Visconti wird das Stück zu komplettem Kitsch.
Brittens Musik ist davon frei. Deshalb lohnt es sich, sie sich mehrmals anzuhören, bevor man in eine Inszenierung geht. Das ist mir gerade hier extrem deutlich geworden. Allein ein allzu grelles oder auch nur farbiges Bühnenbild kann sich restlos über Brittens ausgesprochen vornehme Details legen, vor allem über die Meisterschaft der Faktur. Er gehört ja zu den Komponisten, die ihre Einfälle nicht feiern, sondern sie diskret ausführen. Selbst das, was ich oben „Aufwallungen“ genannt habe, bricht oft mitten im Pathos weg. Deshalb stellt sich Ergriffenheit erst ein, wenn man die eigene Arbeit des ästhetischen Durchdringens geleistet hat. Hat man es, dann wird der Death in Venice geradezu sinfonisch. Nur ist dem jegliche Herumhampelei abträglich, auch wenn das Libretto sie vorschreibt. Sonst gerät die Fantasie in Konflikt mit der Bühnenrealität, etwa bei Rangeleien der Jugendlichen, ganz besonders bei Wettläufen, für die grad mal eine Bühnenbreite zur Verfügung steht. Und und und.
Gerade in dieser Inszenierung machten es mir die lebhaften Strandszenen ziemlich schwer, mich auf die Musik zu konzentrieren – und auf ihre berückenden Schönheiten, die Runnicles sein Orchester Laut werden ließ. Immer wieder schloß ich deshalb minutenlang die Augen. Man sollte dergleichen, die „action“ also, wohl eher andeuten, anstatt sie auszuführen – wie, nun das ist ja eben eine Aufgabe der Regie. Ob die im ersten Akt durchgängige Bühnenbildandeutung tragfähig ist, es spiele die Oper imgrunde in einer Totenkapelle, zu der wohl Aschenbachs Kopf geworden, läßt sich mit einigen Gründen bezweifeln.
Das inszenatorische Problem ist eh, daß diese Oper fast durchweg aus Aschenbachs Augen gesehen ist. Wenn manchmal der Eindruck entstand, einem brechtschen Lehrstück zu folgen, verfängt Distanz hier eben nicht. Das liegt am Pädophilie-Tabu. Denn etwas, das tabu ist, darf nicht angesehen werden; Distanz ist also nicht möglich.
So ist diese Oper imgrunde ein durchgehaltener Monolog, in den immer wieder Außenreize hineinfahren. Daß Tadzios elegante Mutter so unnahbar wirkt, liegt weniger an ihr als an Aschenbach selbst. Es ist sehr wahrscheinlich nicht ihr tatsächlicher Ausdruck, sondern der des stockigen Verklemmtseins Aschenbachs, mit dem er diese Frau wahrnimmt. Und natürlich ist der Bub selbst, also Tadzio, nicht die männliche Lolita, zu der ihn Thomas Mann hat vielleicht machen wollen. Sondern ein immer mal wieder aufgeregt um Speiseeis hüpfender Knabe, der von Apoll so weit entfernt ist wie ein ABC-Schütze von einer Promotion in Volkswirtschaftslehre. Von der Totenkapelle sowieso. Und von den Grabesblumen Aschenbachs – riesigen lilanen Tulpen hier, die auch als Felsbuhnen herhalten müssen, auf denen am Lido die Jugend sich sonnt.
Benjamin Britten
DEATH IN VENICE
Libretto von Myfanwy Piper nach Thomas Mann
Graham Vick Regie – Stuart Nunn Ausstattung – Wolfgang Göbbel Licht
Ron Howell Choreografie – Curt A. Roesler Dramaturgie
>>>> Paul Nilon – >>>> Seth Carico – >>>> Tai Oney
und viele, viele weitere
Pianistin auf der Bühne Adelle Eslinger
Chor und Orchester der Deutschen Oper Berlin
Sir Donald Runnicles
Die nächsten Vorstellungen der Britten-Reihe:
>>>> BILLY BUDD
24. und 26. Mai, 2. Juni,
je 19.30 Uhr
>>>> Karten albannikolaiherbst - Sonntag, 30. April 2017, 09:42- Rubrik: Oper

Eine Interdisziplinäre Komposition für sechs Instrumentalisten, Schattentheater, Video und Lautsprecher nennt die 1980 geborene griechische Komponistin >>>> Irini Amargianaki ihr Stück, das allein an diesem „Interdisziplinären“ krankt, jedenfalls so, wie es >>>> in der Werkstatt der Berliner Staatsoper in Szene gesetzt wurde. Nicht weniger, doch anders wäre mehr gewesen. Hier indes überfitzelten Firlefanz und Bildkitsch die Kunst, der ich mich hörend dennoch nicht entziehen konnte – sofern ich denn die Augen schloß. Was wiederum schade war, weil mich allein das Ensemble und die hohe Konzentration seines Spiels den extrem physischen, ja physiologischen Klangsog auch bildlich spüren ließ.
Für den Kitsch stehe das folgende Foto (die hinter die Figur projezierten kommunizierenden Röhren von Nervenbahnen, bzw. -enden unterstreichen noch die scheinkosmisch wohlfeile Weltbild-Esoterik):

Dagegen beweist, wie anders so etwas bildnerisch aussehen könnte, eindrücklich dieser frühe Collage Paulus Böhmers:  Paulus Böhmer, Selbst, 1983 Paulus Böhmer, Selbst, 1983
Statt dessen hat Stephan von Wedel auf ein Art Fantasy-Comicstil gesetzt, der aber anders als dieser obendrein prüde ist: die primären Geschlechtsteile sind hinter feigenblattartigem Neongrün verborgen; bisweilen glüht es geheimnisvoll. Und selbstverständlich ist wandgegenüber dem unsäglichen Kitschbild „der“ Frau das ebenso geschmacklose eines Mannes gehängt – sozusagen Adam und Eva fürs >>>> Creation Museum in den Augen eines bekehrten Gunther von Hagens. Wie schmuck doch die Organe hängen und drunter, da, das Gedärm! Dazu läuft, wenn wir den ohnedies kleinen, doch vermittels weißer Stellwände noch weiter verengten Raum betreten, eine mehr oder minder (eher minder) gut gesprochene Vorlesung zur Weiterleitung von Tonimpulsen ins Gehirn.
Den Hintergrund der Installation wie der Musik hat in der nmz Peter P. Pachl so gut beschrieben, daß ich es nicht wiederholen mag, sondern Ihnen informationshalber >>>> verlinke. Sowieso besteht das Problem darin, daß eine solche „Erklärung“ der Musik ihre Kraft nimmt; sie reduziert sie aufs Konzept. Ich bin also recht froh, der theoretischen Einführung in das Stück nicht beigewohnt zu haben, die jeweils vor der Aufführung stattfindet. Zwar im Nachhinein stellen Erklärungen einiges klar, vorher indessen hätten sie dem musikalischen Erleben noch mehr im Weg gestanden, als es schon genug die Installations, nun jà,‚geschehen‘ taten.
Bei Adam und Eva blieb es nicht. Vor den Sitzreihen über dem Orchester eine deutlich erkennbare Projektionsfläche 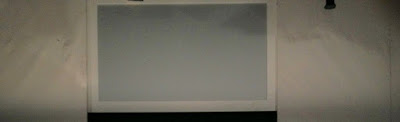 , ,auf der sich zur Musik, als eine Art röhrig-naiven Schattentheaters, bisweilen ungelenke Grafiken bewegten – was prinzipiell hätte reizvoll sein können, aber zum einen wegen der erhöhten rahmen-, bzw. leinwandartigen Präsentation etwas von einem vergilbten Zeichtentrickfilm der Zwanziger bekam, also die Aufführung auf ungewollte Weise historisierte; vor allem aber war das ausgedachte Konzept als eben ausgedacht ständig zu spüren und lenkte deshalb von der, ich möchte sagen:, Essenz dieser Musik Amargianakis grob ab, vor allem von ihrer großen Sinnlichkeit. Möge sie auch, die Musik, die Nervenwege und inneren Klangräume nachzeichnen wollen, die Laute durch unsere Körper zurückzulegen haben und bilden, wäre dieses allein doch bloß illustrativ und bliebe in einer „Übersetzung“ stecken, die ebenso hinkte wie ein mauer Vergleich. Gerade dies geschieht aber n i c h t, auch wenn die Verbildlichungsversuche der Installation es nahelegen. Vielmehr ist das Erlebnis dieses Stücks -als-Klangwelt ein so geradezu rein musikalisches, daß es erklärend sowieso nicht einholbar ist. Hier liegt ja gerade die Stärke dieser Musik: Sie erzählte etwas anderes und sehr, sehr viel mehr als ihre „reale“ Funktionalität und vielleicht sogar die Komponistin wahrhaben will.
Das Hörerleben selbst ist enorm. Was wir wahrnehmen, erinnert nicht von ungefähr, und zwar gerade zu Anfang, an >>>> Scelsi. Tatsächlich hat sich Amargianaki mit Mikrotonalitäten beschäftigt, sie um Fragmente von Melodien allerdings erweitert; besonders das Cembalo ließ mich ein wenig an >>>> Alfred Schnittkes Concerti grossi denken ließ; wie bei ihm stehen diese Momente für den Klang von Erinnerungen – hier, anders als bei ihm, melodiethematisch aber nicht aus- bzw. durchgeführt. Amargianaki erfaßt vielmehr etwas, das sich der bewußten Bearbeitung entzieht, ein quasi Vorsprachliches. Genau dies dringt in die Hörer:innen tief ein, und zwar weil es sich nicht fassen, schon gar nicht als verschubladet-erledigt beiseitestellen läßt. Deshalb führt diese Musik, ohne eben Kisch zu werden, in Zustände geradezu religiöser Versenkung; zumindest wirkt ie hochgradig meditativ.
Die latente Religiösität, sagen wir Spiritualität, wird denn auch unversehens manifest - am Ende nämlich, als eine auf Griechisch aus dem Off gesprochene Rede von den „idealen und geliebten Stimmen“ laut ward – Gestorbener und/oder all jener, „die für uns verloren sind“. So wird das naturwissenschaftlich-funktional nach dem autonomen Nervensystem des Menschen benannte „ANS“ zu einem Musiktheater über die Präsenz das Jenseits im Diesseits und ist damit zugleich Beschwörung der Wahrheit des Traums. Hier auch funktionierte die Schattentheater-Projektionsfläche endlich, indem sie zu nichts anderem mehr herhielt, als in Gestalt von Übertiteln die gesprochenen Sätze – waren es Verse? - ins Deutsche zu bringen, doch die Anmutung war eine andere, indem sie Sprachlichkeit eben unterstrich: als (Klang)sprache des Un- und Überbewußten. Ähnlich hat Godard oft in seinen Filmen gearbeitet. In diesem, seinem, Sinn ist diese Aufführung ein ganz ganz großes Klangtheater, das vorgeführte Kino aber, die Illustration der Musik, nicht nur ungelenk und überflüssig, sondern sogar – selbstverständlich ohne sowas zu beabsichtigen – diffamierend; nämlich einerseits das Stück als, was es aber musikalisch nicht ist, Kitsch, andererseits als, sagen wir, „Konzept“kunst – die schon für sich genommen Oxymoron ist, und zwar in einem mehrfachen Sinn, weil nicht als Unsinn intendiert.
Nimmt man die „Bebilderung“ weg (schließt man also die Augen), beginnen sogar die zuweilen über Schnarr- und Scharrgeräuschen eingesprochenen wissenschaftlichen Sätze etwas brennend Abgetrenntes, nahezu Psychotisches zu bekommen, etwas, das die schiefe Tonalität des Cembalos und besonders auch der Harfe geradezu drängen macht; die Musik wird quasi selbst psychotisch, indem das, was Wissenschaft will, faßbar erklären, ihren Gegenstand nun besonders weit von uns wegrückt: Die wirkende, aber bewußt nicht mehr gespürte Entfremdung wird zu empfundenem Klang. Dagegen kann schließlich nur noch ein Allgemein-Religiöses gestemmt werden. Mir scheint genau dies Amargianakis Stück abermals mit Scelsi zu verbinden, namentlich mit seinem Brahma, eigentlich aber wohl dem Brahman gewidmeten Aiòn: ein gestalt- und eigenschaftsloses, damit unerkennbares und nicht mehr der Zeit unterworfenes Klangkontinuum, in dem eben deshalb die Toten, weil es sich hören läßt, sehr wohl zu den Lebenden sprechen können.
Radikaler kann sich kein Stück von seinem gedachten Entwurf entfernen – oder aber, wenn wir einen beliebigen Ansatz konsequentest verfolgen, heben wir ihn auf. So daß er undefinierbar allgemeingültig wird. Dies ist Amargianakis großer Musik hier gelungen. Um mit Scelsi zu sprechen: „Der Klang ist die erste Bewegung des Unbeweglichen, (nämlich) der Anfang der Schöpfung.“
Unbedingt hingehen also, heute abend. Und aber wirklich die Augen schließen. Danach können Sie sie mit allem Grund wieder öffnen:  Irini Amargianaki
Irini Amargianaki
A N S
Interdisziplinäre Komposition für sechs Instrumentalisten,
Schattentheater, Video und Lautsprecher
Raum Stephan von Wedel Video Maryna Shuklina
Ton Sébastien Alazet Schattentheaterfiguren Lisa Haucke
Baßklarinetten Vincent Burkowitz, Joshua Löhrer – Harfe Katharina Harstedt – Violoncello Xin Shi – Schlagzeug Alexandros Giovanos – Cembalo Mutsumi Shimamaru
Musikalische Leitung Róbert Farkas
Nur noch eine Vorstellung:
16. Juli 2016, Werkstatt, 21 Uhr
>>>> Karten
albannikolaiherbst - Samstag, 16. Juli 2016, 08:35- Rubrik: Oper
(Fotografien (©): Clärchen und Matthias Baus)
Die helle Bühne ist klar geschnitten: ein lichtdurchflutetes salonhaftes Wohnimmer mit (spät)bürgerlichem Interieur. Es bewahrt noch eine Ahnung an die feudalen Zeiten, in denen die Grundgeschichte sich zutrug: die Ermordung von Gattin und Liebhaber durch den nachmals weltberühmten Komponisten >>>> Carlo Gesualdo di Venosa. Das Geschehen war ein mit den südeuropäischen Ehrbegriffen des späten 16. Jahrhunderts eng verbundenes und wohl auch nur aus ihnen zu erklärendes Eifersuchtsdrama. >>>> Salvatore Sciarrinos im Jahr 1998 uraufgeführte Oper überträgt es allerdings auf eine quasi stehende, wenn nicht ewige Zeit. Dennoch basiert sein Libretto auf dem Stück Il tradimento per l‘onore (etwa „Verrat für Ehre“) >>>> Andrea Cicogninis, eines Gesualdo geradezu unmittelbar nachgeborenen Dramatikers und vor allem Librettisten. Er war vermutlich der erste einer bis heute anhaltenden Reihe von Autoren, denen diese Morde zum Stoff wurden. Allerdings hat ihn Sciarrino Sciarrino ... ja, man muß sagen: kondensiert, nämlich den Text auf extrem kurzsätzige Dialoge reduziert, um, so ist seinen eigenen Äußerungen zu entnehmen, die Situation auf eine nicht mehr spezielle, also Gesualdos personale, sondern allgemeinmenschliche einzukreisen. Dies hat zweifellos den Vorteil sehr freier Gestaltungsmöglichkeiten für die Regie, denn die „Story“ selbst schrumpft einerseits zusammen, andererseits wird jeder Satz metaphorisch enorm aufgeladen. Das geht bei den Namen los (Gesualdo als Il Malaspina, der Bösdorn, seine Frau als La Malaspina, die Bösdorn) und endet nicht bei den Geschehen: Er überreicht ihr eine Rose, deren einer Dorn sie, die später von ihm Erstochene, sticht – woraufhin er – einer, der kein Blut sehen kann! – in Ohnmacht fällt. Das ist nicht ohne unfreiwillige Komik bereits in der Vorlage. Sciarriono fängt sie in seiner Musik allerdings auf.
Das ist auch nötig, sonst wäre das Stück, gerade als ein modernes, unerträglich. Imgrunde ist ausschließlich sie, die Musik, der Grund für den unterdessen Welterfolg dieser Oper; die Handlung selbst ist aus heutiger, jedenfalls meiner Sicht Schmonzette, ja schon Eifersucht selbst, wenn in Mord und Totschlag ausartend, nichts als lächerlich – doch, so gesehen, in einem psychiatrischen Sinn, tatsächlich tragisch. Insofern wäre um so weniger klar, wieso hier „Allgemeinmenschliches“ verhandelt werde, bräche nicht >>>> Flimms Inszenierung das Phänomen auf grundsätzliches Begehren und sein Scheitern herunter, in diesem Fall auf die frühkindliche Sehnsucht nach heiler Identität und Verschmelzung mit einem/r anderen, also auf in uns allen latent weiterwirkende Sehnsüchte der unmittelbaren Zeit nach der Geburt.
Genau dieser Sehnsüchte nämlich versichert sich das Paar in den ersten beiden Szenen, und zwar als bleibend erfüllte. Doch in der Gestalt des Dieners, der zu seiner Herrin in heimlicher Liebe entbrannt ist, bekommt die Illusion schon Risse – erst recht aber, als ein Gast das Haus betritt, der die Malaspina nur anzusehen braucht, und sie sieht ihn an, um in das feste Ehegefüge ein Außen erst einsickern, dann -strömen zu lassen. Die Frau mag sich anfangs noch wehren („zieren“ hätte man heute gesagt; siehe dazu mal >>>> die aktuelle Neufassung des § StGB); schließlich wird sie von ihrem unmittelbaren Begehren d o c h überwältigt. Wobei der Gast sie durchaus, mit Worten und Gesten freilich, verführt: 
Der völligen Einheit mit dem „nur Einen“, „Einzigen“ steht Amor entgegen; er verschießt seine Pfeile, wohin er will, auch mitten in intakte Beziehungen; etwas moderner ausgedrückt, stehen ihr die Pheromone entgegen, mit denen ihre, der Pfeile Spitzen, bestrichen worden sind.
Er muß also nur eintreten, der Gast, und die hintere Wand des Salons bekommt einen riesig klaffenden Riß – und zwar dort, wo die Tür ins Schlafzimmer führt – ein im zweiten Akt gerade auch in der Ausführung bühnenbildnerisch mitreißender Einfall Annette Murschetz‘, den ich hier nicht verraten möchte. Es ist ein Effekt ganz großer Theaterzauberkunst. Sie müssen ihn einfach selber sehen.
Jedenfalls ist der Diener nun derart eifersüchtig, daß er die Liebenden beim Herrn verpetzt. Der mit quasi derselben Unerbittlichkeit sofort die Konsequenzen zieht, die schon die Vorstellung einer unantastbaren Einheit zu zweit bestimmt. Imgrunde handelt es sich um die Imagination des Säuglings, eines mit der Mutter zu sein – als hätte die Geburt und also eine Trennung von ihr gar nicht stattgefunden; sprich: es ist niemals zur Reifung, geschweige denn der schließlich erwachsenen Individuation gekommen. Dem entspricht bei Sciarinno der Ohnmachtsanfall Il Malespinas, mit dem er auf seine sich am Dorn gestochene Frau reagiert, auf kaum ein Blutströpfchen also. So ist seine krankhafte Eifersucht nicht etwa Ausdruck der Überführung von Beziehungsstrukuren in Eigentumsverhältnisse („meine“ Frau, „mein“ Mann), sondern eben der einer schwer gestörten Persönlichkeitsentwicklung.
Genau so agiert Sciarrinos Musik: Sie bleibt in der ständig ungefähren Wahrnehmung, liegt wie ein unbewußter Teppich unter den Geschehen – was ihr etwas ungemein sowohl Bedrohliches als eben auch Heimatliches, Gebärmutterartiges gibt. Dem läßt es sich bei aller Hysterie der Szene nicht entziehen – zumal dann nicht, wenn Sciarrino überdies zum Zitat greift, das etwas Verlorenes anruft – bzw. ruft das Verlorene, Vergangene zu uns – : die harmonische Tonalität einer madrigalhaften Elegie >>>> Claude Le Jeunes Sie leitet die Oper sogar ein, wird zwar danach zunehmend verfremdet, doch bleibt im Ohr permanent zugegen. Dabei verblaßt der Elegientext gleichsam, der anfangs „heil“ die Bühne überschrieb, und zwar in doppelter Projektion. Er zersetzt sich in Versfragmente, und eine Figurierung La Malespinas zu Anfang der siebten Szene zeigt die Frau in geradezu derselben Haltung, wie wir sie ganz am Beginn sahen:  Imgrunde ist der einzig erwachsene Satz, den Il Malaspina spricht, ein geradezu kleistscher: „Ich wäre nicht entehrt, wenn du geschwiegen hättest“, sagt er zum Diener. Um die „Schande“ gänzlich abzuwehren, muß deshalb auch er, ihr Zeuge, umgebracht werden.
Daß nach den Morden Il Malaspina freilich nicht erlöst ist, sondern erst recht verdammt, erklärt sich aus dem symbolischen Muttermord; die Trennung ist zementiert, das Kind bleibt einsam zurück. „Lebt wohl, lebt wohl“, ruft er ganz am Ende, „ich werde auf ewig in Qualen leben!“ Die Reifung wird über den Tod hinaus verweigert.
Dabei ist hochinteressant, daß die Figur Il Malaspinas erst mit dem Mordentschluß überhaupt Kontur gewinnt; ein erstes Anzeichen von Reifung, das die Tat selbst wieder durchstreicht. Zuvor war der Mann ein so winselndes Etwas, daß mir leicht widerlich zumute war; doch ließ sich eben genau deshalb begreifen, daß seine Frau schon beim Erscheinen des Gastes, ihres nachherigen Liebhabers, völlig von ihm berückt wird: kein Kind nämlich, sondern ein Mann mit eigenem Willen trat ihr gegenüber. Da konnte sie gar nicht anders, als sich ihm hinzugeben. Sich auf diese Liebschaft einzulassen, ist der Beginn ihrer eigenen Reifung; mit anderen Worten: Die Mutter anerkennt die Trennung vom Kind.
Witzig ist daran, daß Sciarrino die Rolle des Liebhabers mit einem Counter besetzt hat, was für die „eigentliche“ Zeit der Handlung, dem späten 17. Jahrhundert, – vor allem in der weltlichen Oper >>>> gefeierter Usus war. Von heute aus betrachtet, wäre ein Kastrat aber eben einer, der sich als Liebhaber gar nicht eignet; insofern wäre auch hier Vergeblichkeit im Blick. Allerdings haben Regisseur Jürgen Flimm und Dirigent David Robert Coleman den Gast als Hosenrolle besetzt, hinreißend von Lena Haselmann gestaltet, einem Bilderbuch- >>>>Octavian. Mag jedenfalls sein, daß nicht nur besetzungspraktische Gründe zu dieser Inszenierungsentscheidung geführt haben.
Man kann darüber streiten, ob es szenisch nicht überinterpretiert ist oder Eulen nach Athen getragen, wenn Il Malespina im zweiten Akt als Racheengel erscheint, tatsächlich mit dunklen Schwingen: 
Ergreifend allerdings sind hier die textlichen Wiederholungen und szenischen Dopplungen, die das Unheil gleichsam mehrfach festklopfen, auch das Ausgeliefertsein der Personen unterstreichen, keinerlei Ausweg lassen. Ebenso eindrucksvoll ist, wie nach dem ersten Riß in der Hinterwand der Salon nach und nach verwüstet wird. Anfangs trampelt man nur auf den Blüten der heruntergefallenen Rosen herum, schließlich werden die Bilder von der Wand genommen, eine alte Weltkarte überdies zerrissen: der heile, helle Salon war als Repräsentation der „einzigen Liebe“ eingerichtet. Wenn sie zerbricht, muß auch er aufgelöst werden. So viel Wahrheit ist an der Regression, daß sie kein Hohles zulassen kann. Dennoch versichert sich das Paar abermals seiner ausschließlichen Liebe, schon aber auch, denn ihre stattgehabte Störung läßt sich nicht leugnen, des kommenden Todes. Il Malespina wird zur Unheilsrose selbst: Euch gehört dieser Dorn, ich will Euch stechen.
Symbolisch desexualisiert, also praktisch tödlich, werden Rose und Phallus eines: In gotischen Kapellen wies das Rosettenfenster nach Westen und war Maria geweiht, als der Frau; es lag gegenüber der Ostapsis, in dem sich das männliche Kreuz aufrichtete. „Fünf war die marianische Zahl, weil die Rose fünf Blütenblätter aufweist, genau wie die Apfelblüte (…), aus der die fünf Kerngehäuse des reifen Apfels hervorgehen, das entsprechende Symbol für Mutterschaft, Fruchtbarkeit, Wiedergeburt und das ewige Leben“ (>>>> Barbara Walker). „Ich werde aus dem Unmöglichen das Mögliche machen,“ sagt die Frau. Und der Mann antwortet: „Und ich aus dem Möglichen das Unmögliche.“ Prägnanter läßt sich die Weigerung, erwachsen zu werden, in Worte nicht fassen. Lieber bringt man die Liebe um. 
Salvatore Sciarrino
LUCI MIE TRADITRICI
Oper in zwei Akten
Libretto von Salvatore Sciarrino
nach dem Drama Il tradimento per l‘onore von Giacinto Andrea Cicognini
Inszenierung Jürgen Flimm Bühnenbild Annette Murschetz Kostüme Birgit Wentsch
Licht Irene Selka Dramaturgie Detlef Giese
Katharina Kammerloher, Otto Katzameier, Lena Haselmann, Christian Oldenburg
Staatskapelle Berlin
David Robert Coleman
__________________
Die nächsten Aufführungen:
13., 15. und 16. Juli 2016, jeweils um 19.30 Uhr
>>>> Karten albannikolaiherbst - Donnerstag, 14. Juli 2016, 06:31- Rubrik: Oper

Der Raum ist weiß, wir sitzen auf weißen Bänken; es gibt eine dunkle Empore, auch auf der, wie unten, zwei einander diagonal gegenüber, ein Perkussionsaufbau mit je großer Marimba, mit scharf zu schlagender Trommel, mit Pauke und Glocken; unten, symmetrisch, einander Klarinette und Cello gegenüber, dazu eine Trompete sowie Lautsprecher, die die Klänge syntheziserverändert, bisweilen unortbar, wiedergeben. Auf einer glasartigen Platte, die sie erst am Schluß verläßt, kauert vor den wenigen Bankreihen des Mittelpublikums >>>> Ulrike Meinhof; andere von uns sitzen an den Wänden oder auf erhöhten seitlichen Bänken oder mit oben auf der Empore. Neben mir, wie sich bald ergibt, sitzt Thomas Wittmann als >>>> Ossip Mandelstam, im Stück Der Dichter genannt. Sein Platz ist mit einem roten Kreuz reserviert, aber als ich kam, saß er da schon drauf. Er ähnelt ein wenig, auch in Haltung und Gesten später, >>>> Leander Sukov.
Wir Zuschauer:innen sind fortan wie Beobachter, jenen ähnlich vielleicht, die von 1971 bis 1974 im Hamburg-Eppenheimer Sonderforschungsbereich 115, >>>> Isolation und Aggression, ihre Aufzeichnungen über die (freiwilligen) Probanden machten, die einem nach außen schallisolierten, nach innen schallschluckenden Raum ausgesetzt wurden. Das Programm-Faltheft der Staatsoper zitiert den seinerzeiten Leiter, Jan Gross: „... eine positive Rolle in der Pönologie (Bestrafungskunde) (…), und zwar dort, wo es um die Umerziehung des einzelnen oder einer Gruppe“ sic! „geht (...)“ Ab 1972 saß Meinhof im sogenannten Toten Trakt der Haftanstalt Köln-Ossendorfs ein.
Von dort sind Briefe überliefert, die sie, ihre eigenen Isolationswahrnehmungen protokollierend, an ihren Anwalt schrieb. Auszüge dieser Briefe sind ein tragender Teil des Librettos - neben Aufzeichnungen und Gedichten eben Ossip Mandelstams, der 1938 wegen „kontrarevolutionärer Aktivitäten“ in ein sibirisches Arbeitslager verbracht wurde, in dem er am Ende desselben Jahrs umkam. Außerdem gibt es einen „Dschinn“, der in Hans-Werner Kroesingers Inszenierung leider weniger ein, wie >>>> das Programmheft meint, „fantastisches Wesen, das nie faßbar wird“, ist, sondern als grobkomödiantischer Harlekin daherkommt, zumal mit bisweilen (künstlich verhallten) Geisterbahn-“Uaaahh!“-Rufen und was dergleichen Faxen mehr sind. Obendrein ist er wie ein Geck der Zwanziger gekleidet; weshalb er für, so in dem Programmheft >>>> der Komponist selbst, „Kreativität, Erfindungs- und Manipulationslust“ stehe, bleibt völlig unerfindlich. Anstelle also auf etwas der beklemmenden Szenerie Jenseitiges zu verweisen, nimmt diese Figur der Oper den Ernst, bei welchem Unternehmen ihm drei hier als gemütlos typisierte Laborhelferinnen kostümierte Frauen auch noch assistieren.
Mithin verliert sich das Stück mehr und mehr in einer Groteske – möglicherweise, weil man eben die Zuschauer:innen zu Laborbeobachtern machen wollte, die dann für das Phänomen eines Geistwesens ebenso wenig mehr empfänglich sein können wie für die (als flirrende Erinnerung an Kinderlieder imaginierten) selbst schon depersonalisierten Flashbacks der Meinhof. Zuviel brechtsches Theater also, als daß die Möglichkeit wäre, sich auf die Angst einzulassen: sprich:: auf die Depersonalisierung, der Meinhofs Briefe in möglichst analytischer Distanz den beschreibenden Ausdruck zu geben versuchten. Als sich diese Distanz nicht mehr halten ließ, 1976, nahm sie den Strick -
Olivia Stahn gestaltet Meinhofs vergeblichen Versuch ausgesprochen intensiv – aber gerade darum wäre es geraten gewesen, das Publikum die Distanz verlieren zu lassen - es also empathisch mitempfinden zu lassen. Dann wäre vielleicht auch zu begreifen gewesen, weshalb es gegen Ende des Stückes zu dieser Nähe Mandelstams zu dem Dschinn kommt, der er, Mandelstam, allezeit verloren, wie in sich selbst emigriert, durch die Szene schlurft, imgrunde im Gespräch nur mit sich selbst oder dem, was er einmal gewesen: Genommen habt ihr mir: die Meere, Lauf und Flug,
Und gebt den Schritten Zwang der Erde, ihrer Lehme
(Ossip Mandelstam, Kama, 1935) Ihn, anders als Meinhof, erreichen die Klänge nicht; statt dessen schreibt er in sich Gedichte – und eine Art Gedicht an die Wand: 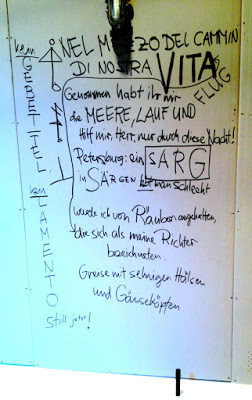
Dies, in der Tat, mag ihn mit dem das Kreative, wenn der‘s denn täte, verkörpernden Dschinn verbinden, dessen Erscheinung der um Distanz bemühten Meinhof fremd bleiben muß. Deshalb kann e r auch, Mandelstam und nicht die Meinhof, sagen: Und was habt ihr erreicht? Erfolg und Glanz genug:
Die Lippen rühren sich, ihr könnt sie mir nicht nehmen.Auch die Schwestern, übrigens, bekritzeln die Wände, erst mit (wohl Versuchsschritte bezeichnenden) Numerierungsstrichen, dann, als Strichmännchen, eine Ge/ Erhängte: In diesen Momenten kippt die Inszenierung aus dem Behaupteten sogar ins unwillentlich Peinliche. Hätte man sich auf die Musik verlassen, zu der auch die Geräusche gehören (wirklich beklemmend war, daß einmal, von der Bismarckstraße draußen, ein Martinshorn durch die Aufführung dopplerjaulte), - hätte man ihr getraut, es wäre dergleichen nicht unterlaufen.
Tatsächlich ist die Musik selbst wie depersonalisiert; ein wenig Halt, aber oft schockgleich, gibt das Schlagwerk; die Marimbas schürzen eine Vertraulichkeit vor, auf die doch die Trommel scharf immer wieder einschlägt. Nur in der kurzen Ouverture und den Zwischenmusiken der sieben Szenen läßt sich so etwas wie ein kompositorischer Fortgang – eine Entwicklung – verfolgen; die Klänge erscheinen, nicht selten quasi unverbunden, und oft dann nimmt Meinhof sie auf oder versucht es: Sie antwortet auf die wenigen Außenreize, die außen aber gar nicht sind, sondern offenbar aus ihr selbst kommen: [D]ie ganze Widerstandsenergie [hat] in der absoluten, absolut nicht wahrnehmbare[n) Stille schließlich kein anderes Objekt, als einen Selbst.So zitiert das Programmheft einen der Briefe aus dem „Toten Trakt“. - Die Inszenierung indessen mißachtet‘s. Wahrscheinlich wird die Oper aber schon von der szenischen Konkretisierung -an-sich, der Schwestern und des Dschinns, konterkariert. Es gibt kein Bild des Bildlosen; eines herzustellen, verfälscht es. Statt dessen wären die Innenfiguren ins Innen der Zuhörer:innen zu heben gewesen, anstelle sie also leiblich-wirklich vor sie hinzustellen mit zumal ihren bizarren und/oder typisierenden Faxen. Doch insgesamt vergleichen Sie bitte mit Janáčeks Dostojewski-Vertonung >>>> Z mrtvého domu (Aus einem Totenhaus) oder, zeitnäher, Dallapiccolas >>>> Il prigioniero.
Insofern liegt, bei jedenfalls dieser Inszenierung, das eigentlich Spannende der Oper Matthias Hermanns im – im Wortsinn: – Nachdenken über sie. Freilich dieses | lohnt sich allemal. Und im so wagewilligen wie präzisen Engagement der Musiker - den, neben Olivia Stahn und Thomas Wittmann, eigentlichen Akteuren.  DIE LUFT HIER: SCHARFGESCHLIFFEN DIE LUFT HIER: SCHARFGESCHLIFFEN
Musiktheater von >>>> Matthias HermannInszenierung Hans-Werner Kroesinger Bühne Stefan Britze Kostüme Julia Hartung Live-Elektronik/Tontechnik Sébastien Alazet Licht Sebastian Alphons Dramaturgie Regine DuraOlivia Stahn, Martin Gerke, Stelina Apostolopoulou, Jelena Banković, Ivi Karnezi, Thomas Wittmann
Klarinette: Matthias Glander, Sylvia Schmückle-Wagner Violoncello: Alexander Kovalev Trompete: Peter Schubert Schlagzeug: Matthias Marckardt, Martin Barth, Johannes Graner
Musikalische Leitung Max Renne
Die nächsten Vorstellungen:
8. Juli 2016 20 Uhr | 10. Juli 2016 19 Uhr
>>>> Karten WERKSTATT WERKSTATT
albannikolaiherbst - Donnerstag, 7. Juli 2016, 15:55- Rubrik: Oper
Wie konnte mir das entgehen? So fragte ich mich immer wieder, nachdem ich am 18. Juni endlich Graham Vicks Inszenierung gesehen hatte, „reines“ Repertoire unterdessen, mehr als fünf Jahre nach der Premiere. Dennoch von bis zum Durchhängen eingeschliffener Routine absolut keine Spur. - Also wie?
Nun ja, ich erinnerte mich endlich, vom damaligen Pressechef des Hauses gesperrt worden zu sein; nicht einmal die Intervention der zurecht hochgeachteten Eleonora Büning hatte etwas geholfen, zu sehr offenbar war der Herr S.-H. ins >>>> Tiefland verklebt gewesen und ist's wahrscheinlich noch. Daß ich das unsägliche Stück zumal >>>> in der FAS nicht nur verrissen, sondern vor allem moniert hatte, daß man für solchen Schmock Gelder hinauswirft, die für andere, wirklich gute Stücke, auch solche neuer Komponisten, ums Tausendfache besser angelegt wäre, verzieh er mir nicht. Da spielte es auch keine Rolle mehr, daß ich vordem für die Deutsche Oper ohne Honorar auf Podien mitgesessen hatte, freilich in der Zeit seines klugen wie freisinnigen Vorgängers >>>> Busche. Nun ja, der Herr Esnochwas verließ das Haus, und unmittelbar war ich wieder „ratifiziert“. Doch diesen Tristan hatte ich verpaßt. Ärgerlicherweise. Denn die Grundidee des Inszenierung ist fast genial zu nennen.
Es stellt sich bei Tristan-Modernisierungen ja immer die Frage, wie sich der mittelalterliche Lehens- und Ehrkatalog, ohne den dieses Stück imgrunde nicht zu verstehen ist, auf eine Gegenwart übertragen läßt, in der Begriffe wie Treue und Ehre längst desavouiert worden und durchs Ideal eines sagen wir pragmatistischen Durchlavierens ersetzt worden sind. Nur dann auch wird klar, wie persönlich gerade dieses Musiktheater ist, wie sehr Wagner hier ein eigenes Verhalten umdeutet. Ich meine seine Liebe – sie eine „Affaire“ oder „Liaison“ zu nennen, wäre falsch - zu Mathilde Wesendonk, der Frau seines Mäzens, zumal während seines Aufenthaltes als Gast in dessen Haus. Die Begegnung mit ihr muß ihn wie der Blitz getroffen haben; dieses beiderseitige SichErkennen, diese, nennt es Bloch, ἀναγνώρισις entspricht furchtbar genau Isoldens und Tristans erstem Blick ineinander nach Einnahme des Liebestranks: „Aber sehe ich Dein Auge, dann kann ich doch nicht mehr reden; dann wird doch alles niedrig, was ich sagen könnte“, schreibt er in dem Morgenbeichte überschriebenen Brief vom 7. April 1858 . „Sieh, dann ist mir alles so unbestreitbar wahr, dann bin ich mir meiner so sicher, wenn dieses wunderbare, heilige Auge auf mir ruht und ich mich hinein versenke!“ So heißt es denn am Ende der Oper: versinken / ertrinken / unbewußt /höchste Lust. „Dann gibt es eben kein Objekt und kein Subjekt mehr; da ist alles eines und einig, tiefe, unermeßliche Harmonie!“ (Richard Wagner, >>>> Mein Leben, Anm. 576). Verkompliziert wurde diese Leidenschaft noch dadurch, daß Wagners Ehefrau >>>> Minna mit ihm bei den Wesendonks war; der zitierte Brief aber führte zwar nicht sofort zur Trennung, legte aber deren Grund.
Wie also das gebrochene Treueverhältnis des Künstlers zu seinem Mäzen auf der Bühne erklären, das gebrochene Teueverhältnis des Ritters zu seinem Lehensherrn? Der Liebestrank, der eigentlich als Todestrank genommen werden soll, soll doch zugleich nicht Hexenstück sein, sondern symbolisch Zusammenhänge erklären, die auch in der Gegenwart Gültigkeit haben. Genau das gelingt Graham Vick auf schlagende Weise.
Er siedelt die Erzählung zwischen zwei verfeindeten Mafia- oder Camorraclans an, denn dort, tatsächlich, bis heute, sind diese innerstrukturellen Treue- und Gehorsamsgebote unangetastet verpflichtend. Aber nicht nur dies, sondern indem quasi auch der Anlaß als Ergebnis eines „Familien“kriegs allgegenwärtig auf der Bühne steht, nämlich der Sarg des von Tristan erschlagenen Morolds, Isoldens Verlobtem, ist auch ständig das Sühnethema präsent, und präsent sind gerade im Ersten Aufzug alle wichtigen Personen sichtbar, über die das Geschehen hinwegströmt.
Das ist einfach nur großartig, und der Mann, der am Ende Aufzug I zur Bühne „Große Scheiße!“ hinaufbrüllte, hat damit rundum bezeugt, weder Wagners Stück-selbst begriffen noch überhaupt eine aller anderen Inszenierungen, die er vielleicht gesehen, kapiert zu haben. Daß sich niemand ohne weiteres mit Mafiafamilien identifizieren möchte, ist davon unbenommen. Ja eben diese Zumutung ist ein notwendiger distanzierender Akt; so etwas muß ausgehalten sein, wenn man einem Geschehen wirklich auf den Grund gehen – und fühlen – können will. Eine moderne, aufgeklärte Haltung würde heutzutage ja eher sagen: DumeineGüte, fremdgegangen halt; is' nich' schön, stimmt schon, aber passiert. Nur kann, wer diesen Blick auf den Tristan hat, auch das Elend des hintergangenen Königs Marke nicht verstehen – indessen schon Otto Wesendonk großzügiger sein konnte und war; seiner Frau und Wagners Leidenschaft ließ er keine Trennung, auch nicht von dem Komponisten, folgen, sondern hielt an Freundschaft und Förderung fest. So spielte sich denn das Treubruchsdrama in Wagner selbst ab; in gewissem Sinn sind die beiden großen Arien Markes sein Sühnedank an den Gönner, und zwar ein ewiger – solange jedenfalls der Tristan noch aufgeführt und gehört werden wird. Für diesen nun, Graham Vicks, sei meine Besprechung der >>>> Schwanengesang und Nachruf, nämlich eine ... Hommage.
Schwanengesang? Nun jà. Wie ich >>>> eben sah, wird der Tristan in der nächsten Spielzeit leider nicht wieder aufgenommen werden; dafür dürfen wir allerdings einer anderen, neuen Arbeit Vicks entgegensehen: Brittens hierzulande selten aufgeführter später Oper >>>> The Death in Venice, ebenfalls unter der Stabführung Donald Runnicles'.
Doch zum Tristan zurück. 
Fotografie (©): >>>> Matthias Horn
Vicks, bzw. seines Bühnenbildners Paul Brown Grundansatz ähnelt Goetz Friedrichs' hinreißender >>>> Rosenkavalierarbeit des Jahres 1993, nicht tatsächlich bildlich, aber in der leichthändigen Eleganz, mit der seinerzeit ein Geschehen aus der Maria-Theresia-Ära ins Art Deco projeziert wurde. „Damals“,peccato!, schrieb ich noch nicht übers Musiktheater, doch immer noch hängt das Plakat an meiner Bilderwand: 
Bitte? Ja, zu Vicks und Runnicles' Tristan zurück.
Es ist ein bißchen schade, daß Stephen Goulds Tristan ein bißchen sehr zu... nun, sagen wir: zu vollschlank ist; freilich rückt sein hinreißender Wagnertenor diesen Eindruck schnell in den Hintergrund; es gibt bei diesem Sänger kein Knödeln, kein Drücken, vor allem kein Jammern. Die Stimme strahlt einfach; zuletzt habe ich das so unangestrengt von Peter Seiffert gehört, der tatsächlich die Premiere und erste Saison dieser Inszenierung sang. Was mir halt entgangen ist.
Dennoch hätte ich, als sich die mit einem Mal schicksalhaft Liebenden als solche fassungslos in die Augen sehen, auf eine Umarmungsszene verzichtet, es statt dessen bei dem Blicken belassen, in dem doch schon alles darinnen ist („Der Blinde, so hätte er Dein Auge nicht erkannt und seine Seele nicht in ihm gefunden!“ Wagner, a.a.O.). Und Isolde müßte auch nicht unbedingt auf den Tisch klettern. Die Szene ist als stehende - damit unendliche - klar für sich, Bewegung ihr abträglich. Und Nina Stemmes Stimmlage ist vielleicht eine Spur zu tief für Isolode, zumal sie dadurch sehr nahe an Brangäne gerät - vollendet von Tanja Ariane Baumgartner gesungen.
Aber das sind ebensolche kleinlichen Einwände, wie daß des großen Matti Salminens, dessen Abschiedsvorstellung es war, Stimme mittlerweile tatsächlich altersschwächelte; er machte das allemal durch seine mimische Präsenz wett. Die Tragik war hier ständig spürbar, auch wenn Salminen als Marke nun deutlich zu alt ist. Wenn er als künftiger Bräutigam der jungen Frau erstmals entgegentritt, steht eine Unmöglichkeit im Saal, die die Oper gar nicht meint. Sondern Wagners Marke steht ja nun ebenso im Saft wie Tristan; seine Verbindung mit Isolde wäre in keinem Fall eine unangebrachte gewesen; alter Knacker/junge Frau führt eben vom Grundkonflikt ganz weg.
Doch wir können abstrahieren.
Die großer Schauspielerin, schrieb Kierkegaard, sei eben eine, die als alte Frau uns noch so glaubhaft eine junge darzustellen vermöge, daß wir tatsächlich diese, nicht aber jene spüren. Für einen Paten indes, im Mafiazusammenhang, wirkte Salminens Marke zu gebrochen; man stelle sich statt dessen Brandos Rolle in Coppolas berühmtem Spielfilm vor; in der Tat dann kann man ein Gefühl für den mittelalterlichen Marke bekommen: „Brandos Pate war ein vielschichtiger Charakter: ein erbarmungslos mordendes Monster, ein Mann mit bürgerlichen Werten, ein liebevoller Großvater, ein sterblicher alter Mann in einer harten Schale aus Macht und Kontrolle“ (Peter Manso: Brando, The Biography, New York 1994; zit.n. >>>>wikipedia). Man muß nur „bürgerlichen“ durch „feudalen“ ersetzen. Aber eben dies, wie sehr sich die feudalen auf die bürgerlichen Werte spiegeln lassen, jedenfalls diejenigen der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts und für die Mafiastrukturen bis in unsere Gegenwart, macht Vicks Inszenierung so atemberaubend.
Aber nicht nur dies, sie gewinnt auch im Detail enorme Bilder, etwa, wenn sich in der Liebesnacht ein nackter junger Mann auf einen Spaten stützt, mit dem er zu Brangänes „Habet acht!“ ein Grab aushebt, der aber vor allem eine Transformation des Schwertes ist, auf das sich allezeit Kurwenal stützt, Tristans vertrauter Kampfgefährte. Schwert, Spaten und Grab. Dazu Morolds Sarg; in der Liebesnacht lehnt er aufrecht an der Wand. Und die beiden nackten Statisten, weil zu dem jungen Mann eine junge Frau hinzukommt: für das eben a u c h, eigentlich, junge Paar Isolde & Tristan stehend, geradezu unschuldig, ja rein im besten Sinn – und entkleidet eben, weil es ums Innerste geht, das keine Kleidung mehr verdeckt. Ohne es zu wissen, sind sie ausgesetzt, und können gar nichts wenden. Imgrunde strömt das Geschehen über a l l e Beteiligten hinweg, im Rhythmus des Meeres, der an die Küste wellenden Wogen. Keine zweite Musik, die jemals dieses so sehr zu ihrer eigentlichen Essenz gemacht hätte; man hört es nach wie vor >>>> bei Carlos Kleiber am eindrücklichsten.
Ja, zugegeben: Anfangs zuckte auch ich zusammen, als der Liebestrank hier nicht etwa getrunken wird, sondern gespritzt – was selbstverständlich zum Mafiaszenario paßt und dennoch gegen die Fabel zu verstoßen scheint:
Doch Wagners eigener Text begründet den Eingriff: Ew'ger Trauer
einz'ger Trost:
Vergessens güt'ger TrankGar kein Zweifel: eine Droge. So will sich letztlich in dieser wagemutigen Inszenierung nur eines nicht wirklich herstellen: daß gegen Ende Tristan zum erschlagenen Morold werde, einem Ander-Morold, wenn man so will. Der Gedanke ist gleichermaßen beklemmend wie hinreißend, doch in der szenischen Umsetzung nur behauptet. Hingegen grandios, wie gegen Ende eine Person nach der anderen aus der Szene genommen wird, so daß Isolde schließlich völlig alleine ist – was sie „wirklich“ ist: „die nichts um sich her vernommen“ schreibt Wagner als Regieanweisung. Deshalb kommt es, anders als dort vorgeschrieben, nicht zu „Rührung und Entrücktheit unter den Umstehenden“ und auch zu Markes Segen nicht, und weil es sich eben um die Tragödie einer Mafiafamilie handelt, hier, kann auch das Publikum sich ein ungebrochenes Gerührtsein nicht gestatten; das möglicherweise hatte den GroßeScheißeRufer so erhitzt – wohl aber anhaltenden, brausenden Jubel für Inszenierung und Akteure. Der Fäkalist indessen hatte die Oper da wahrscheinlich schon verlassen.
Donald Runnicles leitet und das Orchester spielt die Musik präzis und in großer Durchschaubarkeit; es gibt keinen Klangmatsch, vor allem werden die Sänger getragen, nicht übertönt; sie sollen sich nicht „durchsetzen“ müssen, sondern sie schmiegt sich ihnen an, schmiegt sich unter sie. Deshalb gab es an diesem letzten Aufführungstag kein Klangloch, in dem jemandes Gesang verschwunden wäre, obwohl der Mund sich öffnet; nur ein einziges Mal verließ Nina Stemma die Stimme, einen Ton lang im Liebsduett des zweiten Aufzugs. Sie fand sie umgehend wieder, ohne sich zu schonen. So etwas ist ein enormes Erlebnis, wenn danach die Hörer:innen um ihre Sängerin nicht bangen müssen. Die denn auch ihren langen Auftritt in einen so elenden wie im Hohlkörper des kaum vibrierenden Klangtunnels rasend verklärten Triumph hinaufführt, der das Nahtodlicht schon sieht und in es eingeht. In dem kurzen neuen An-, dann schon, nun aber langen Abschwellen der Musik senkt sich der Vorhang.
Es sah aus, als Frau Stemme dann vors Publikum trat, daß sie selbst gar nicht begreifen konnte, wie ihr geschah, ja ein wenig auch, was sie vollbracht: was ihr geschehen. Solchen Jubel hör ich nicht oft. Dennoch sind für mich die Entdeckungen des Abends die Stimme Stephen Goulds und Tanja Baumgartners Brangäne gewesen, eine Pietà aus Klang. Makellos dazu Ryan McKinnys Kurwenal und die tiefe Menschlichkeit im Ausdruck Matti Salminens, ob Pate nun her, ob Brando nun hin. ***
Richard Wagner
TRISTAN UND ISOLDE
Eine Handlung in drei Aufzügen
Inszenierung Graham Vick – Bühnenbild Paul Brown - Licht Wolfgang Göbbel
Spielleitung Claudia Gotta – Chöre Thomas Richter
Stephen Gould – Matti Salminen – Nina Stemme – Ryan McKinny
Jörg Schörner – Tanja Ariane Baumgartner – Peter Maus – Attilio
Glaser – Seth Carico
Chor der Deutschen Oper Berlin
Orchester der Deutschen Oper Berlin
Sir Donald Runnicles
(Keine weitere Vorstellung)
>>>> Deutsche Oper Berlinalbannikolaiherbst - Montag, 27. Juni 2016, 09:31- Rubrik: Oper
Imgrunde kehrt Claus Guths Bohuslav Martinůs nach einer Erzählung >>>> Georges Neveux‘ komponierte Oper Juliette um, nämlich gibt ihr einen von den Surrealisten gerade gemiedenen realistischen Boden. Denn der Mord (juristisch eher, da aus dem Affekt, Totschlag) geht hier nun der Fabel voran, so daß die surrealistische, sagen wir, Allegorie zu einer Art Studie über Verdrängung wird. Ich möchte sie eine Schuldflucht nennen. Die nun aber gerade nicht im Sinne Neveux‘ war.
Die „eigentliche“ Geschichte geht so: Der Pariser Kunsthändler Michel kommt in eine kleine Stadt, weiß sich kaum zu erinnern, hat aber die Sehnsucht nach einer Frau, die er dort einmal in einem Fenster sah, woraufhin er sich bleibend in sie verliebte. In sich nannte er sie Juliette und sucht sie also nun. Dabei begegnet er verschiedenen Menschen, die sich alle nicht, an nichts, erinnern können. Dennoch findet er Juliette, aber sie entspricht nicht seiner Imagination; das nimmt seiner Liebe aber nichts.
Die beiden kommen tatsächlich zusammen. In einem Wald aber, anläßlich ihrer beider in Streit übergehenden Rendezvous‘, erschießt er sie. Die Leute strömen zusammen, wollen ihn richten, doch er weiß es abzuwenden, indem er ihnen von etwas erzählt, das sie ja alle nicht mehr haben: eine Erinnerung. In der indes löst er sich selbst auf und kommt im dritten Akt aus dieser seinen Fantasie in einem „Zentralbüro für Träume“ wieder zu sich, wo sich zeigt, daß imgrunde alle männlichen Liebesprojektionen Juliette heißen: Der Name (aber nicht die Person!) steht für die idée fixe Berlioz‘ oder sagen wir für die erotische Anima- an- sich. Doch da man ihr „tatsächlich“ nur im Traum begegnen, erst recht sich mit ihr nur in einem solchen vereinigen kann, ist für Neveux‘ wie für den Surrealismus insgesamt der Dauerzustand somnischer Entrückung, den ein „normale“ Mensch Wahnsinn nennte, erlösend. „Entsprechend ist das Ende keine Katastrophe,sondern ein surrealistischer Glücksfall“, schreibt im Programmheft Ivana Rentsch.
Guth indes sieht Eskapismus darin. 
Darf man das, die Aussage einer Fabel derart verkehren?
Sicher. Denn was ist ‚verkehrt‘? Es geht bei Regie um Interpretation, nicht ums Affirmieren, bzw. bloßes Durchexekutieren von Handlungsanweisungen. Freilich sollte vorausgesetzt werden, daß das Publikum die Grundgeschichte kennt und die Umwertung also verstehen kann – und eben auch, weshalb Guth die Pistole, die bei Neveux/Martinů erst im zweiten Akt auftaucht (was in Träumen ja geht: plötzlich hat man sowas in der Hand), von Anfang an zu einem bildlichen Leitmotiv macht; es wird im Lauf des dritten Aktes geradezu bedrohlich inflationär, aus der einen Waffe werden zunehmend mehr: Permanent fallen da diese Pistolen aus den kassettenartigen Tafeln, die den Raum tapezieren, der die Stadt vorstellen soll. Diese wird imgrunde als eine (Anstalts?) Zelle gezeigt; allerdings läßt sich das Bild auch konzeptuell verstehen, was dem rationalistischen Regieansatz entspräche und dennoch die andere Lesart nicht ausschließt. Erst der dritte Akt verungefährt sich in ein surreal Unkonkretes, indem die Stadt sich so weit nach links zurückrückt, als schaute man umgekehrt durch ein Fernrohr, und in ganzer Breite und Tiefe davor in wallendem Nebel gespielt und gesungen wird. 
Interessanterweise bekommt dieser Einfall etwas viel Realistischeres, gerade in seinem Schwebenden, als die konkrete Zelle hatte, in der sich die Protagonisten auch noch sehr seltsam bewegen. Oft zucken sie, nicht selten haben sie etwas spastisch Zappelndes wie in >>>> triadischen Balletten, was den Eindruck des Traumhaften verstärken soll, aber eher bizarr wirkt. Zumal es auch, und sogar besonders, für Michael gilt, der doch anfangs fremd in dieser Stadt ist – also als ob auch er seine Erinnerungen längst verloren habe, deren eine er aber doch hinterjagt. An diesem Widersprich krankt die Glaubwürdigkeit der Interpretation ein bißchen, weil so die psychologische, bzw psychiatrische Studie zur technoiden Gesamtgroteske wird: Es hampeln Marionetten. Insofern ist eine wirkliche persönlich-identifizierende Empathie nicht eigentlich möglich.
Das wird durch Rolando Villazóns Neigung zur mimischen (komödiantischen) Übertreibung noch verstärkt; für meinen Geschmack hätte es gutgetan, ihn im Interesse der Rolle hie und da nachdrücklich an die Kandare zu nehmen; sie, die Übertreibung, mag zwar anschaulich machen, stört aber doch sehr die Glaubwürdigkeit.
Entsprechend übertrieben showhaft war nachher seine Entgegennahme des Applauses; und wie er die grandiose Magdalena Kožená immer wieder nach vorne schob, als wollte er auch ihr einen besonderen Anteil gönnen, abgesehen von seiner permanenten Handküsserei, hatte etwas unangemessen Gönnerhaftes, auch wenn er‘s in so gespielt jugendlicher wie freundschaftlicher Burschikosität tat. Bescheidenheit ist seine Sache offensichtlich nicht, mußte es allerdings auch nicht sein, gab ihm „sein“ Publikum fanhaft jubelnd zu verstehen. Da störte es auch nicht, daß Villazón, wenigstens in der von mir gesehenen Premiere, sogar das Orchester dominierte – was an seinem äußerst präsenten, wenn auch nicht immer klangschönen, hin und wieder sogar jammernden, weil scharf gepreßten Tenor liegt; die Stimme war quasi tiefenlos – völlig anders als Kožená, deren Klangweite ihre surreale Partie mehr als nur füllte, in der direkten Begegnung mit Michel aber ebenso notwendig eng wird: wie die Rolle es da braucht, nämlich mädchenverschwärmt oder, als sie auf Widerstand stößt, so zickig, daß sich der Träumer Michael nur noch mit diesem verhängnivollen Schuß zu „wehren“ weiß – wobei Martinů und Niveux offenlassen, ob nicht auch er eigentlich nur imaginiert ist. 
Es stellt sich für Guths Interpretation noch eine andere, „eigentliche“ Frage: Indem er die Geschichte zum konkreten Fallbeispiel einer Schuldverdrängung macht (entsprechend zitiert das aufwendig gemachte, wieder einmal ausgezeichnete Programm„heft“auf dem unteren Fünftel einige Seiten aus Dostojweskis Rodion Raskolnikov), wird die sozusagen allgemeine Frage entschärft, inwieweit nicht immer, oder doch mindestens oft, das Liebesobjekt ein projeziertes ist, das mit der tatsächlichen Person „nur“ in Teilmengen übereinstimmt – woraus sich dann, ohne freilich gleich mit einer Erschießung zu enden, notwendigerweise Konflikte ergeben. Ich meinerseits hätte, dem nachzugehen, favorisiert, zumal durch die gestisch outrierende Überzeichnung „der Mensch“ Michel von Anfang an nicht wie ein konkreter wirkt, sondern eben wie ein triadischer Typos - eine Vorführpuppe, mit der sich nicht mitfühlen läßt. Auch wenn in den letzten Jahren Martinůs nach ihrer Uraufführung höchst selten gegebene Oper auf einigen Spielplänen auffällig oft aufgetaucht ist, eine „wirklich“ Chance, in die lebendige Musikgeschichte einzugehen, hätte sie meines Dafürhaltens nur dann. Das Zeug dafür bringt sie mit – gerade im leitmotivischen Sehnsuchtsthema, das sich freilich von Szene zu Szene immer wieder anders gestaltet – und nicht zuletzt auch in den traum-, bzw. erinnerungshaften Akkordeonpartien, die etwas von einem Licht am aber nicht Ende des Tunnels haben, sondern es leuchtet fern, doch mittendrin.
In jedem Fall gut war, daß sich Barenboim und Guth – nach im vergangenen Jahr Zürich - für die französische Fassung entschieden haben, die die ursprüngliche war; die tschechische entstand erst nachher, als es zur geplanten Pariser Uraufführung nicht gekommen war. Ich selbst habe hier auch noch einen deutschsprachigen Mitschnitt der Salzburger aus den Achtzigern, unter Pinchas Steinberg, die tatsächlich noch ergreifender ist. Überhaupt fällt gerade an der Juliette, bzw. in den anderen Fassungen Juliett a, der Einfluß des sprachlichen Idioms auf den Melos extrem auf; ein ähnlicher „Fall“ ist, für mich, >>>> Verdis Don Carlos. 
Martinůs Musik nimmt Tendenzen der Dreißiger auf und führt sie in ein weniger impressionistisch als expressonistisch wirkendes, rhythmisch von heller Trommel und bisweilen dem Xylophon angetriebenes Laufrad, aus dem niemand mehr herausspringen kann – bei Guth eine endlose Wiederholung psychischer Gefangenschaft; um so mehr, als die große Traumzszene des Dritten Aktes, im Zentralbüro für Träume, nun wie die eigentliche Realität wirkt. Die Entscheidung aufzuwachen, dann aber das Objekt des eben nicht nur libidinösen Begehrens für alle Zeiten zu verlieren, ist indes eine nur scheinbar mögliche. So bleibt Michel bei Guth eben in i h r hängen, nicht etwa in seiner Traumwelt-selbst – die sich zwar szenisch wiederholt, aber entfernt in der zum Guckkasten gewordenen Zelle und betrachtet von ihm selbst, der sich insofern nun, im Nebel (!!) stehend, in ein zweites Ich abgespalten hat und ohne Kontakt selbst zu seinem Traum bleibt – das imgrunde fürchterlichste Ergebnis, das sich hier denken läßt. Überdies erweist er sich als nur einer von Hunderten, ja Tausenden, die alle um ihre Eine Julietta flehen.
Barenboim läßt sein Orchester diese expressiven Momente der Musik deutlich betonen, ohne aber dabei exzessiv zu werden; gleichsam geht er vornehm damit um. Das formt das un|terlaufende Melancholische (oder, besser, Lyrische) – völlig anders als das aufs Groteske ausgerichtete Spiel. Bisweilen erinnern die musikalischen Phrasen und besonders das Sehnsuchtsthema an Motivgesten, Barenboim wird es nicht gerne lesen, Othmar Schoecks, manchmal auch an, das wird ihm wieder gefallen, Janácek. Und es bestehen Verwandtschaften zum Frank Martin des >>>> Vin herbés. Eine größere Entfernung zur handfesten Melodie-, ja Gassenhauerorientierung etwa Puccinis ist jedenfalls im Feld der Tonalität kaum denkbar. Dabei liegen zwischen dessen, Puccinis, letzten Arbeiten und der Julietta keine zwanzig Jahre, ganz wie zu Bretons Surrealistischem Manifest; auch läßt sich Martinůs Oper wie schon der Surrealismus selbst als, bei Martinů zeitversetzte, Antwort auf die >>>> Neue Sachlichkeit begreifen, auch wenn sie eben, wie diese, auf Schmelz weitgehend – und bewußt wohl – verzichtet. In der Premiere jedenfalls war dieser Schmelz Tenorgeplärr. Zur Rolle freilich eines tatsächlichen Mörders, oder cholerisch ausgerasteten Totschlägers, paßt das; insofern hätte Guth für den Michel einen besseren Sängerdarsteller als Villazón gar nicht finden können, indes die Flexibilität der großen Stimme Koženás sich jeder Interpretation einzuschmiegen wüßte – ja in jeder für das Traumobjekt stünde, das Julietta i s t – die Anima der in Schlaf- und Halbschlaf träumenden Männer, der keine konkrete Frau jemals zu entsprechen vermag.

J U L I E T T E
Lyrische Oper in drei Akten von Bohuslav Martinů H. 253
Text von Bohuslav Martinů nach Georges Neveux
Inszenierung Claus Guth Bühnenbild Alfred Peter Kostüme Eva Dessecker
Choreographie Ramses Sigl Licht Olaf Freese Dramaturgie Yvonne Gebauer und Roman Reeger
Magdalena Kožená - Rolando Villazón - Richard Croft - Thomas Lichtenecker - Wolfgang Schöne - Elsa Dreisig - Adriane Queiroz - Arttu Kataja - Jan Martiník - Natalia Skrycka - Florian Hoffmann
Staatskapelle Berlin
Staatsopernchor
Daniel Barenboim
Die nächsten Vorstellungen:
05. Jun 2016 | 19:30 UHR
07. Jun 2016 | 19:30 UHR
10. Jun 2016 | 19:30 UHR
14. Jun 2016 | 19:30 UHR
18. Jun 2016 | 19:30 UHR
>>>> Kartenalbannikolaiherbst - Sonntag, 5. Juni 2016, 10:35- Rubrik: Oper
Musik ist der Weg, auf dem der Mensch selbst zum Engel wird.
>>>> Günter Peters Marco Blaauw Marco Blaauw
(Fotografie (©): Kai Bienert)
Wiewohl von Stockhausen als Teil eines monumentalen, auf sieben „Tage aus Licht“ angelegten monumentalen Musiktheaters geschrieben, dürfte „Michaels Reise um die Erde“ das Trompetenkonzert des Zwanzigsten Jahrhunderts sein – eine Sichtweise, die es probehalber erlaubt, von den esoterischen oder sagen wir religionsphilosophischen Ideologemen abzusehen, die nicht nur den Lichtzyklus, sondern das gesamte Werk Stockhausens bestimmen. Das zu tun ist insofern hilfreich, als diese Musik dann sehr wohl auch von nichtreligiösen Menschen erfüllend in sich aufgenommen werden kann; außerdem verstellt dann nicht des Komponisten – der sich auch in seinen Auftritten spürbar als Missionar, wenn nicht sogar Gesegneter gab – höchst synthesistisches Glaubens- und Erlösungssystem den Blick auf seine gerade heutzutage schlagende Modernität. Wohl kein zweiter hat die Möglichkeiten der elektronischen Musik und ihr Zusammenspiel mit akustischen Instrumenten derart ausgereizt und weiter entwickelt wie er; hört man sich im Unterhaltungsbereich Techno und ähnliches an, wird der Regreß für die Ohren geradezu schmerzhaft.
In der Berliner Aufführung vom vergangenen Freitag war der Raum auf ein glänzendes Schwarzweiß gestellt, mit Farbflecken durch die (wenigen) Kostüme, bzw. Acceçoirs, die den Zuschauern bedeuten sollten, wo man sich im Akt jeweils befand. Musikalisch erzählt wird – mit den Stationen Köln-NewYork-Japan-Bali-Indien-Zentralafrika-Jerusalem – eine spirituelle Reise; da indes die Stationen schon über Instrumentierung und gewählten Tonraum musikalisch ausgewiesen sind, war es ziemlich unnötig, wenn nicht unfreiwillig naiv, sie noch zusätzlich vermittels Nippeszeugs zu bedeuten. Es ist auf bizarre Weise eher komisch als sinnvoll, Michaels Trompete ein Modell des Kölner Doms anblasen oder für Japan ein Bonsaibäumchen hochhalten zu lassen. Mehr noch ist es ärgerlich, weil allzu deutlich zu spüren, daß hier jemand schlichtweg keine Bildidee hatte. Eine Ausnahme machte eigentlich nur der rückprojezierte, nur fast erkennbare Elefant der Indienstation.
Aber die Inszenierung von Stockhausenopern sind generell ein Problem, was auch damit zusammenhängt, daß der Komponist in vielen Werken die Bewegungen der Akteure quasi-choreografisch mitnotiert hat. Das gibt ihnen nicht selten etwas puppenhaft-Bewegungsoutriertes, ja Faxiges (von fickfacken), das den intendierten Ritus nicht wirklich repräsentieren kann. Nun läßt sich zwar sagen, die oft auf Slapsticks hinauslaufende Personennotierung sei ein angehmer Gegenpart zu Stockhausens durchweg pathosgeladener Musik, moderiere sie gleichsam und verbürge sich für so etwas wie Leichtigkeit. Tatsächlich jedoch wirken die Figuren eher starr, marionettenhaft eben auch dann, wenn wir ans No-Theater und ähnlich fernöstliche Inszenierungen denken. Wir schauen ja mit unseren europäischen Augen, und insbesondere auf weltliche junge Leute wirkt dergleichen ulkig bis wenig erträglich. So sah denn mein fünfzehnjähriger Sohn, der mich begleitet hatte, fortwährend in seinen Schoß, wohl um nicht lachen zu müssen. Was er nicht wollte, denn „die Musik war absolut toll!“
Das lag selbstverständlich vor allem an den Musikern, vor allem den Solisten, deren Instrumente gerade in „Michaels Reise um die Erde“ eine (quasi) unerhörte Lebendigkeit erreichen können und auch erreichten - - allen voran die von Marco Blaauw grandios weniger gespielte als leidenschaftlich jubelnde, jammernde, trauernde Trompete. Deshalb wäre insgesamt für Stockhausens Musiktheater ein Regisseur vom Schlage >>>> Peter Sellars‘ zu wünschen, der so fantasiereich wie strukturierend aus den allegorischen Popanzen Menschen machte. Dabei spielte keine Rolle, wie die Figuren „eigentlich“ gemeint sind; sie würden ihr, sagen wir, esoterisch-Sektisches los, das nahezu allen Stockhausen-Inszenierungen, die ich gesehen habe, wie feuchtgewordenes Mehl angebackt hat. Da muß einfach mal jemand kommen, der weder in Stockhausens postmorter noch in eine serielle Entourage gehört, und gewaltig mehrmals durchpusten – genau so lebensprall wie Blaauw geblasen hat. Ich sag‘s ja selten, aber hier wünscht‘ ich mir ein Regietheater mit Mut und Willen, von der Heiligkeit dieser Stücke einige Bißchen wegzukratzen; es bliebe von Stockhausens privatistisch umgebautem Katholizismus immer noch genug. Denn anders als Bachs, ja anders selbst als Richard Wagners, mit dem er nicht nur das senderisch-Missionarische teilt, kann sich seine Botschaft nicht wirklich auf eine Communio stützten, die sie empfangen zu wollen (und zu können) bereit ist. Zur Grundlage seiner Spiritualität (und aber auch, das ist wichtig, seiner immensen Schöpferkraft) hat er eben nicht einen bereits, im Sinne >>>> Jungs, kollektiv gewordenen Mythos gewählt, in den er führend mit eingehen würde, sondern das >>>> seinen Denk- und Fühlorganismus seit ungefähr 1973 leitende Buch gehört wie das knapp einhundert Jahre früher erschienene Buch Mormon und mehr noch Hubbards Dianetics in die spezielle Sektengeschichte der USA. Wenn ein Dirigent wie Michael Gielen äußert, als Stockhausen gesagt habe, er wisse, was auf Sirius passiere, habe er (Gielen) sich mit Grausen von ihm abgewandt, zeigt das sehr deutlich das Problem..
Was nämlich möglich wäre, war in der Aufführung vom 18. September direkt zu erleben; nicht zuletzt die fast Privatheit des Saals der Berliner Festspiele trug dazu bei. Er erlaubte nämlich dem wundervollen Duo Trompete & Baß eine aus der Weltformelstarre sich herauslösende Intimität; für mich überhaupt eines der schönsten Passagen dieses hochsinnlichen Musikwerks. Blaauw und Florentin Ginot hätten stundenlang so weiterspielen können, ich wäre glücklich gewesen. Doch trat das Sternenmädchen wieder auf und lockte aus ihrem Bassetthorn Michael hinweg; es läßt sich durchaus von einer Verführung sprechen. Wobei es Stockhausen um sie – letzlich und leider – nicht geht, sondern um Erlösung im Paradiese >>>> Orvontons. Dabei stünde, daß der Lichtzyklus als Erleuchtungsmusik geschrieben wurde, auch bei einem „weltlicheren“ Zugriff außer Frage. Man muß dafür nicht einmal wissen, daß Stockhausens Michaelfigur als eine Erscheinungsform(el) Jesus von Nazareths gemeint ist.
Viele, sehr viele Momente dieser Musik erinnern an die HochZeit des Freejazz. Deshalb klingt das gesamte Stück wie aus einer Vergangenheit her, an die sich das Ohr grad noch erinnert; zugleich verströmt es aber sinnlichste Gegenwärtigkeit. Außer Scelsi gibt es für mich keinen Komponisten, der eine derart mythische Musik geschrieben hätte wie eben - in seinen besten Momenten, in denen er sich aus der starren Ritualisierung zu lösen scheint – Stockhausen. Der Unterschied besteht „bloß“ darin, daß Scelsi nichts wollte; er ließ nur klingen – etwas, das den fernöstlich meditativen Mythologien tatsächlich nahe steht, anders als Stockhausens westlicher Missionarismus, der zumal nicht ohne Eifer ist. Andererseits muß man sich, um den den Grad der Freiheit zu erfassen, die seine Musik in ihren hohen Augenblicken ausfüllt, die Situation der Neuen Musik während der Siebziger Jahre ins Gedächtnis rufen. Die spätere Wendung zur Tonalität und durchaus auch zum handfesten Kitsch (1997 >>>> Penderecki, heute etwa >>>> Widmann) fing erst im Gefolge der postmodernen Ästhetiken in den achtziger Jahren an, die eben nicht nur die Lockerung, ja Befreiung von Doktrinen brachten, sondern gleichzeitig auch einen enormen künstlerischen Regreß bedeutet haben und bis heute weiterbedeuten. Das läßt sich durchaus, fast marxistisch, mit den politischen Entwicklungen dieser Jahre parallelisieren, also mit den „Erfordernissen“, bzw. Bedürfnissen einer sich totalkapitalistisch durchökonomisierenden Gesellschaft. Unversehens stehen Pop und Neue Musik Hand in Hand. Hiergegen sperrt sich Stockhausens neureligiöse Musik nach wie vor genauso wie Rihms säkulare, der sich aus seiner Studienzeit daran erinnert, daß Stockhausen seinen strengen Formeln zwar folgte; machte es aber eine Aufführungspraxis nötig, habe er Probleme durchaus mit eigenmächtigen, „mutwilligen“, also künstlerautonomen Strichen erledigt. Genau das ist es, was ich auch von einem Stockhausenregisseur, und zwar grundsätzlich, erwarten würde.
So hingegen, mein Junge hatte ganz recht, wollte man lieber die Augen schließen, nur die Musik wirken lassen. Doch der leuchtende Lackglanz des Podiums lockte mich, immer weiter hinzusehen. In ihm war mehr von Stockhausens kosmischer Imagination als in dem ganzen Firlefanz leitmotivisch fungierender Dinger, um von den aufgemalten Maskeraden zu schweigen. Leider erlaubte es wohl der Saal nicht, Stockhausens Vorstellung eines uns körperlich umkreisenden Klanges zu realisieren; das betrifft vor allem die Levitation am Schluß, von der der Komponist gewollt hat, daß (aus dem Programmheft zitiert) „die Melodien (…) ‚langsam und ruhig am Himmel‘ in ein mystisch-blaues Licht (fliegen), um sich schließlich zu einem Triller zu verdichten“, der im Unhörbaren verklingt.
Gelungen allerdings, rundum, und damit der wirklich gewordene Höhepunkt der Oper war „Michaels Abschied“: Wie sich die auf dem seitlichen Vordach des Festspielhauses positionierten Trompeter mit den Sprechgeräuschen des hinausströmenden Publikums únd den Klängen der städtischen Nacht amalgamierten, gehört zum Schönsten, das ich seit Jahren bei einem Konzertbesuch erlebt habe. Wir standen nur da und lauschten. „Schließ mal die Augen“, sagte ich meinem Sohn, „und höre auf alles zusammen“:
Michaels Abschied am 18. September 2015
***
Karlheinz Stockhausen
MICHAELS REISE UM DIE ERDE
II. Akt der Oper DONNERSTAG aus LICHT (1977–1980)
Marco Blaauw Trompete, Merve Kazokoğlu Bassetthorn, Fie Schouten Klarinette Bassetthorn, Carl Rosman Klarinette, Bruce Collings Posaune, Kevin Austin Posaune, Melvyn Poore Tuba
Ensemble Musikfabrik
Paul Jeukendrup Klangregie, Alain Louafi Bewegungsregie, Lukas Becker Licht, Florence von Gerkan, Hwan Kim Kostüme
Leitung: Ilan Volkov 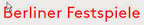 MUSIKFEST BERLIN 2015 MUSIKFEST BERLIN 201518. und 19. September 2015 albannikolaiherbst - Dienstag, 22. September 2015, 10:08- Rubrik: Oper
Nein, es geht im Rosenkavalier nicht um das Sterben, sondern ums Vergehen, dessen extremster F a l l allein das Sterben und schließlich der Tod ist. Dennoch kann man ihn anders sehen, kann ihn auf den Tod hin interpretieren, und dies hat >>>> Claus Guth in Frankfurt getan. Bereits mit dem ersten Bild macht er es klar. Da liegt, nicht nur entfernt an Millais‘s Ophelia erinnernd, die Marschallin vor dem als Abschluß des Grabplatzes imaginierten Aufzug, durch den sich die Auf- und Abtritte der Personen vollziehen, und in ihm, bzw. direkt davor steht die Trauergemeinde - Ophelia auch deshalb, weil die Frankfurtmainer Marschallin noch jung ist – genau so, wie Hofmannsthal sie sich vorgestellt hat. In keiner meiner bisherigen Rosenkavaliere, und es waren einige, war sie derart ideal: Amanda Majeski. Der junge Octavian sei nicht, notiert der Dichter, der erste Liebhaber der Marschallin gewesen und werde gewiß nicht der letzte sein. Schon gar nicht, so möchte ich hinzufügen, steht sie auch nur am Beginn des Klimakteriums. Deshalb meint das Wort „ideal“ hier nicht nur Majeskis Erscheinung, sondern die junge Sängerin füllt ihre Rolle mit von der Zeit noch völlig unangetasteter Stimmpräsenz. Um so beklemmender, mit dieser in körperlicher und stimmlicher Schönheit idealen Marschallin, wirkt nun aber Guths Interpretation.
Er läßt die Oper, so führt er im Programmheft aus, „in einer Art Hotel oder Sanatorium“ spielen, und es gibt Indizien, daß er diese wahrscheinlich, an Reife und an Haltung, größte Frauenfigur der Musikgeschichte, die jedenfalls weltlich größte, an der Modekrankheit des fin de siècle, der Schwindsucht nämlich, erkrankt sein läßt – was abermals auf Millais zurückweisen würde, also auf die Präraffaeliten, was sich in Hofmannsthals Textbuch aber nirgendwo findet. Es nähme der Geschichte, die eine von Erkenntnis und Loslassen ist, von Loslassen-können und -wollen, auch ihre Kraft, nämlich die der sowohl personalen Würde wie Einfühlung. So scheint mir meine Sicht auf Guths Interpretation schlüssiger als seine eigene dieses „Hotels oder Sanatoriums“ zu sein, nämlich daß der Rosenkavalier in einem Altersheim spielt, vielleicht sogar einem Hospiz, und als Erinnerung der Marschallin an eine Zeit erzählt wird, in der sie die noch war, als die sie uns vor die Augen tritt. Hierfür sprechen auch die vielen Alten und schwer Gebrechlichen, die immer wieder durch Guths Szenen tapern, sich mühen, sich schwer in die nebeneinander gereihten Betten legen. Da ist die blühende Erscheinung der Marschallin geradezu schockierend und erfüllt auf fast schon beängstigende Weise Hofmannsthals Dichtung: Aber wie kann das sein, daß ich die kleine Resi war und daß ich auch einmal die alte Frau sein werd? Die alte Frau, dei alte Marschallin? (…) Wie macht denn das der liebe Gott? Und wenn er‘s schon so macht, warum laßt er mich zuschaun dabei mit gar so klarem Sinn?
Also gerade, daß ihm, Guth, das Wunder dieser idealen Marschallin widerfährt, macht seinen Regieansatz derart schlagend. Und es ist nicht nur dieses allein, denn der Octavian ist mit Paula Murrihy nicht minder gut besetzt, ja perfekt auch er – man möcht‘ gar nicht glauben, daß er „in Wirklichkeit“ Frau ist, ja nimmt ihm, wenn er die Hose schalkhaft gegen den Rock tauscht, die Wahrheit des Geschlechts kaum mehr ab. Schließlich Sophie, halb Backfisch, halb Ware zum Tausch gegen Dünkel und doch, wenn auch vor Leere noch, rein: in wie geträumter, beinahe animahafter Reine, „engelsgleich“ hätte man früher gesagt, dabei kindlich durchaus, aber doch schon Geschlecht, nur ohne dessen Ambivalenzen.
So auch singt sie, Christiane Karg, und so auch läßt sie Octavian – der Marschallins, egal ob ihr Liebhaber, Bub - sie beschützen: an dem Mädchen, nicht an der Frau kann er patriarch Mann sein. Das ist vorgezeichnet, faszinierenderweise gerade an seiner Androgynität.
Ein Altersheim also, und immer wieder wird drin gestorben, immer wieder fällt jemand um und wird fortgetragen, im dritten Aufzug, der im Keller spielt, sogar auf rollbaren Bahren. Das absolute Meisterstück, das Guth hier vollbringt, ist, daß er die Geschichte trotzdem w a h r t; gleichsam erzählt er die seine neben Hofmannsthals/Straussens, ohne daß er deren reduziert oder sogar, wie oft im Regietheater, denunziert. Es ist immer wieder, als würde ein Schalter umgelegt, und wir sehen die Marschallin als alte Frau mit bisweilen tatsächlich Gesten und Spuren einer TB-erkrankten jungen Blassen; er legt sich abermals um, und sie steht in wenn auch leicht melancholischer, so dennoch sinnlichen Blüte. Genau dies dürfte das inszenatorische Wunder dieser Frankfurtmainer Inszenierung sein, neben dem der wie stimmlich so physisch perfekten Frauentriade-insgesamt, der außerdem noch ein, im burlesken Halbfalstaffsinn dieser Rolle, makelloser Ochs zur Seite steht - und szenisch gegen sie. Jedenfalls ist es verblüffend, wie organisch bereits im ersten Aufzug die Szenen aus- und ineinanderklappen, vor unseren inneren Augen, auch wenn das Bühnenbild sich gar nicht ändert: Wir sind zugleich im Hospiz und in der Fürstin Werdenberg Schlafzimmer, sind im Speisesaal des Altersheims und in der halböffentlichen Chambre.  Daß der Bühnenbildner, Christian Schmidt, sich, wie er im Pogrammheft, schreibt, von einem der typischerweise eben auch als halbe Privaträume genutzten Wiener Kaffeehäuser hat inspirieren lassen, erlaubt dies ebenso wie die – architektonisch gesehen – Verlagerung der Opernhandlung vom mittleren 18. Jahrhundert ins ausgehende 19.; die Kostüme entsprechen dem mit einer sozusagen idealtypischen Zeitlosigkeit – worum es vor allem Hofmannsthal eben auch ging: „Es könnte scheinen, als wäre hier mit Fleiß und Mühe das Bild einer vergangenen Zeit gemalt, doch ist dies nur Täuschung und hält nicht länger dran als auf den ersten flüchtigen Blick.“ Ungeschriebenes Nachwort Hofmannsthals, 1911 (dem Todesjahr, übrigens, Gustav Mahlers). Genau dieses „scheinen“ ist das Mißverständnis, auf dem der Popularerfolg dieser in Wahrheit fragilsten aller Opern beruht, und zwar bis heute; es ist dasselbe wie die Rede von der vorgeblichen Walzerseligkeit, die den Rosenkavalier durchwehe: Die Seligkeit, wo sie wird, ist im Moment, nicht im 3/4taktigen Tanz, den der Regisseur fast schaurig, namentlich im Dritten Aufzug, unversehens in einen Totentanz ausfließen läßt – auch das nur halbminutenkurz. Hier deckt sich Guths Sterbeansatz mit Hofmannsthals Bewußtsein des Verwehens, worin, in diesem Wort, eben das Weh steht – wie seine Warnung: „Wehe, wehe!“ Und die bisweilige Derbheit des Stücks ist der Garant für eine Erdung, die etwa bei Wagner immer wieder verloren geht und zu ideologischer Überhebung führt: einer ins quasi-Religiöse hinaufgelogenen, eigentlich brachialen Brutalität. Es ist erstaunlich, wie sich sowohl Strauss als auch Hofmannsthal geradezu kritiklos davon blenden ließen, in ihren eigenen Kunstwerken aber, namentlich der Dichter, von dergleichen völlig geschützt geblieben sind – da hat Thomas Manns Abfälligkeit, mit der er Wagner gegen Strauss hält, schon etwas Bizarres, weil unsensibel, man kann es anders nicht sagen, Dämliches. In dem von Norbert Abels sehr klug zusammengestellten Progammheft findet sich davon ein Exempel. Jedenfalls gibt es bei Wagner nicht eine einzige Person, die auch nur den Feinsinn Sophies hätte, die ja selbst noch auf fast plakative Weise naiv ist, um von der Persönlichkeit der Fürstin Werdenberg ganz zu schweigen – da wär allein das Vergleichen blasphemisch. Das Unverhältnis kompositorischen Genies zu der Mordlüsternheit der wagnerschen... es sind ja nicht einmal Figuren, sondern nur Puppen, solche, die für Machtgier stehen – dieses Unverhältnis wird von Hofmansthal/Strauss in humane Verhältnisse überführt. Man mag zu Straussens Geldhudelei stehen wie man will, zu seinem musikalischen, sagen wir, Parfum und kann sich von seiner späteren Rolle in der Reichsmusikkammer mit allem Recht abgestoßen fühlen, aber daß ausgerechnet Glenn Gould ihn den bedeutendsten Komponisten des Zwanzigsten Jahrhunderts nannte, bleibt eine höchste Empfehlung. Im Frankurtmainer Rosenkavalier überdies schützt Guths Inszenierung ihn vor seinem Parfum: die Gefährdung des Stücks durch vorgebliche Rückwendung ins gefällig Kostümierte ist hier rundweg ausgeschlossen; allenthalben wirkt Brüchigkeit, wiewohl zugleich Innigkeit und Intensität, also das Recht des Gefühls, nicht nur nicht angetastet werden, sondern sich gerade auf der zugluftartig wehenden Folie des Zergehens realisieren. Dazu gehört auch, daß die „kleine Resi“, also die Marschallin als kleines Mädchen, im Stück erscheint – ein psycho/logisch völlig logischer Vorgang, wenn Guth das Stück als Retrospektion anlegt. Nur am Ende, wirklich ganz am Ende, wird der Einfall übertrieben, wenn sich die Marschallin, wieder als alte Frau, zum Sterben legt, und sie als kleines Mädchen sich quasi selbst die Stirn berührt, die bereits erkaltete, so daß sie gestisch zum Fallen des Vorhangs erschrickt. Das ist in seinem Überbedeuten nicht nur mit der Speckseite nach den Affen geworfen, sondern geht tatsächlich wider Hofmannsthals Haltung. Es gehört zu Reife und Wesen der Fürstin Werdenberg, daß man, um mit Niebelschützens Grafen Godoitis zu sprechen, Katastrophen mit sich selbst ausmacht – sie also nicht ausstellt. Hier wird es getan - gegen der Marschallin Willen... ja man kann und muß vielleicht sagen, daß ihre Gebrechlichkeit hier nicht nur in ein Licht gezerrt wird, das sie aus Würde scheut, sondern, die Schlußszene naturalistisch weiterdenkend, ist sie nun geradezu in die Erbärmlichkeit der durch sachliche Verfahrenszwänge in die wie abgeschoben verwaltete Todesverdrängung geraten – sie wird nicht mehr als Frau gezeigt, die sich ihrer selbst ermächtigt, sondern als – existenzphilosophisch ausgedrückt – entmächtigt Geworfene.  Das aber ist das genaue Gegenteil dessen, was vor allem Hofmannsthal zeigen wollte: unser aller Möglichkeit zur Freiheit, und sei es die oder g e r a d e die eines reifen Verzichts.
Hier muß ich mäkeln. Aber nur hier. Darüber, ob es sinnvoll ist oder nicht sogar ein bißchen die Dramaturgie dieser Szene auseinanderreißt, der Marschallin Satz zu ihrem Friseur „Mein lieber Hippolyte, heut haben Sie ein altes Weib aus mir gemacht!“ von dem Ensemble ganz zu separieren, so daß die Betonung fast plakativ wird – darüber kann man ebenso streiten, wie ob es nicht der tot Umfallenden manchmal ein bißchen viel wird. Wir wissen doch längst und müssen nicht dauernd aufs neue vorgeführt bekommen. Da war ich bisweilen an Adornos Satz zu Wagners Leitmotivtechnik erinnert, man fühle sich dauernd am Ärmel gezupft. Doch das sind meine vielleicht zu persönlichen Idiosynkrasien und deshalb Beckmessereien gegenüber der ansonsten bis in die feinsten Details reichenden Klasse dieser Inszenierung, zum Beispiel wenn Octavian den unbekleideten Fuß seiner Geliebten faßt und sie daran zart an sich heranzieht – eine ausgesprochen sinnliche Parallele zu Akt II, wenn Sophie aus ihren Schuhen schlüpft und barfuß zum Fenster rennt, um aufgeregt vom Sessel aus, auf den sie geklettert, die Ankunft des Rosenkavaliers zu erspähen. Man sieht bereits, wie zärtlich er bald auch dieser Füße einen ergreift. - Guths Inszenierung ist voll von so etwas: unendlich sinnlicher Reichtum.
Und Guth stellt Gerechtigkeit her. Das begibt sich allein aus der Logik des Rückschaus, aber transzendiert sich moralisch. An sich tritt die Marschallin in Akt II nicht auf, worin schon vom ersten Blicken an Sophies und Octavians Liebe zur Welt kommt: ἀναγνώρισις. Es ist dies ein mythischer Vorgang. Darauf liegt die Betonung und läßt uns eigentlich die Marschallin schon wieder vergessen. Es herrscht ein Primat des neuen, ganz jungen Glücks. Bei Guth indes, anders als von Hofmannsthal/Strauss vorgesehen, wird die Marschallin Zeugin, so daß nur bei ihm, Guth, Octavian ein Gefühl für die Verletzung bekommt, die er ihr zufügt. Das läßt ihn hier bereits spüren, was Reifung heißt, so daß sein im Dritten Auzug in das große Terzett führende „Marie-Theres, wie gut sie ist“ ein weitaus umfassenderes Herzenswissen vermittelt, als es das pure Gemisch aus Dankbarkeit, Verliebtheit und Scham könnte, das es, das Terzett, ohne diese Erscheinungsmomente eingeleitet hätte. So gibt Guth dem ohnedies schon unfaßbaren Gesang noch eine unterlaufende Dimension hinzu. Einmal sogar, in Aufzug II, schreitet Octavian der Erscheinung auf der Treppe halb nach – ein enorm schmerzlicher Moment, vielleicht der schmerzlichste dieser Inszenierung. Denn nun können die Zuschauer das Glücksgefühl, das sie rührt und mit dem sie sich identifizieren möchten, nicht ungebrochen genießen, sondern auch sie werden in den Schuldzusammenhang mit einbezogen, der das Glück der einen immer auch das Unglück anderer sein läßt. Uneingeschränkt läßt es sich nicht haben, allenfalls in dem M o m e n t, von dem Benjamin als Wahrheit schrieb, daß sie nur aufschieße und schon wieder fort sei. Dauer ist nicht gewährt. Auch dies wird in der Erscheinung der Marschallin reflektiert: da, im Zweiten Aufzug, ist sie eben Erscheinung, und zwar moralische – gleichermaßen für uns wie für Octavian.
Dies alles wäre, in dem so nahen Beieinanderliegen von Beglückung und Beklemmung gar nicht richtig auszuhalten, und auch die junge, sehr sehr naive Liebe würde von solcher Last erdrückt, wenn das Stück nicht seinen Faun kennte: So charakterisiert Hofmannsthal den Ochs von Lerchenau selbst. Auf eine gewisse Weise ist er, der trieb-, aber - gaunerisch - auch witzgesteuerte Edelmannsrüpel, der freieste aller Personen des Rosenkavaliers; bis zum Schluß begreift er nicht ganz, und Guth zeigt das vorzüglich, wieso sich die anderen so moralisch beengen. „Muß halt ein Heu in der Nähe dabei sein“: und ist es immer für ihn. Daß solch ein Naturgeist dann wieder abhaut auf sein Land, den Feldern und den Wäldern zu, ist nur artgemäß; daß sich allerdings auch der Ehemann der Marschallin derzeit dort aufhält, um zu jagen nämlich, ist eine der feinen Bosheiten, die Hofmannsthal uns, ohne daß wir‘s recht merken, ganz im Nebenbei ebenso mit unterjubelt wie daß auch die Marschallin selbst ihre venerischen Jagdgründe kennt. In dem ganzen Spiel von Liebe und Verzicht sollte nicht vergessen werden, daß ihre und Octavians Liaison nichts für das Licht ihres Stands war, weder privat des ehelichen noch öffentlich ihrer repräsentierenden Stellung. Da ist Ochsens, wie gerissen auch immer, offenherzig bekannter Lust-Egoismus durchaus befreiend. Bjarni Kristinsson spielt und singt das furios. Daß solche Buffopartien eigentlich die dankbarsten und imgrunde einfachsten sind – ein Ochs kann kaum fehlgehen –, legt den Finger auf die Wunde: So sehen wir sie nicht. 
Sebastian Weigle dirigiert den Rosenkavalier durchsichtig, frisch, nicht analytisch, aber sehr darauf bedacht, die Stimmen zu tragen. Wenn Thomas Mann sich beklagte, der Text gehe in Straussens Farbklangsbrei unter, zeigt das Frankfurter Opernhaus- und Museumsorchester, daß dem so nicht sein muß. Selbstverständlich tun die Übertitel ein ihres dazu, wahren das Recht dieser in der Operngeschichte wahrscheinlich einzigartigen Dichtung. Und nur am Anfang, nur in den ersten zehn/zwanzig Takten dachte ich, ein wenig mehr Tempo bekäme der musikalischen Sache gut, auch ein wenig mehr Lärm, der ja eigentümlich dissonierend in den Glanz der Oberfläche einführt, wie eine Warnung quasi, die mich immer an die Steigerungen von Ravels La Valse erinnert – die Warnung nämlich, daß diese Oberfläche brüchig ist, gerade w e i l sie später so selig wirkt. Es ist verkleidete Unseligkeit: genau das erzählen die ersten Takte der, wenn man so will, Ouvertüre. Wann immer ich diesen Anfang höre, denke ich, er sei noch nicht erreicht – nicht einmal von Carlos Kleiber. Der Rosenkavalier hebt mit der Wunde schon an. Weigle, denke ich heute, hat sie leicht auseinandergezogen. Denn damit betont er den Schmerz.
Es gibt musikalisch wunderbare Momente, viele, sehr viele, und zwar hören wir Meistersinger und Il Nozze immer mit, aber als, wie Hofmannsthal schreibt, „eines von den Geheimnissen, aus denen sich die Form unserer Zeit zusammensetzt: daß in ihr alles zugleich da ist und nicht da ist. Sie ist voll von Dingen, die lebendig scheinen und tot sind, und voll von solchen, die für tot gelten und höchst lebendig sind.“ (Hofmansthal, Der Dichter und diese Zeit, 1906/07, zit.n.d.Programmheft). Wer, deshalb, einen wirklich zeitgenössischen Rosenkavalier sehen möchte, und vor allem hören, und dies in idealer Besetzung, der muß – nach Frankfurt reisen. Denn dort ist wirklich einmal wieder die Oper das Kunstwerk der Zukunft.  *
Richard Strauss
DER ROSENKAVALIER
Komödie für Musik in drei Aufzügen
Text von Hugo von Hofmannsthal
Regie Claus Guth - Bühnenbild und Kostüme Christian Schmidt - Licht Olaf Winter - *
Richard Strauss
DER ROSENKAVALIER
Komödie für Musik in drei Aufzügen
Text von Hugo von Hofmannsthal
Regie Claus Guth - Bühnenbild und Kostüme Christian Schmidt - Licht Olaf Winter -
Choreografie Ramses Sigl - Dramaturgie Norbert Abels - Chor Tilman Michael
Amanda Majeski - Bjarni Thor Kristinsson - Paula Murrihy - Dietrich Volle - Christiane Karg - Barbara Zechmeister - Peter Marsh / Michael McCown - Sharon Carty - Kihwan Sim / Thomas Faulkner - Michael McCown / Beau Gibson - Franz Mayer - Hans-Jürgen Lazar - Mario Chang
Chor der Oper Frankfurt, Frankfurter Opern- und Museumsorchester
Sebastian Weigle
Die nächsten Vorstellungen:
14.06.2015 | 20.06.2015 | 24.06.2015 |
02.07.2015 | 05.07.2015 | 11.07.2015
>>>> Karten (Online-Buchung) albannikolaiherbst - Mittwoch, 10. Juni 2015, 08:49- Rubrik: Oper
Neue Kinderopern haben an der Komischen Oper eine lange Tradition; Dschungelleser wissen das: Ich habe immer wieder von ihnen erzählt. Diesmal tue ich‘s besonders gerne. Denn nicht nur szenisch, auch musikalisch wartet >>>> die sowohl erweiterte als auch modernisierte Musiktheater-Variante auf Oscar Wildes berühmte frühe Erzählung mit quasi einem Höhepunkt nach dem anderen auf, ja, die Szenen jagen einander, so daß selbst ganz junge Zuschauerhörer gar nicht auf die Idee kommen, Langeweile zu empfinden. Das geht schon mit einer, zur kurzen Ouvertüre, quasi Kamerafahrt los, die unter anderem über einen Friedhof hinwegführt – eine pfiffige Formklammer für das Stück. Selbstverständlich kommt es nicht ohne Klamauk aus, aber der ist nahezu immer intelligent und in den meisten Fällen tatsächlich witzig. Sogar als musikdramaturgisch Gebildeter denkt man hier höchst selten: Na jà. Vielleicht wird das Stück am Ende ein bißchen arg kitschig. Das aber ist kindgerecht und fällt imgrunde nur deshalb auf, weil von Anfang an das mythische Element des Stoffes zugunsten profaner, sagen wir: betont weltlicher Fragen in den Hintergrund gerät. Deshalb bleibt ein wirkliches Schaudern in dieser Gruseloper aus – wenn man von der allerersten Szene absieht, die sofort mit allem nur denkbaren Theaterdonner daherkommt, vor allem aber das Gespenst noch als Unhold vorführt und nicht schon als einen seiner Jahrhunderte eigentlich längst müden und von der neuen Familie permanent verulkten, ja verhöhnten alten untoten Mann einer vergessenen oder zur Jahrmarktsbelustigung aufbereiteten Zeit. 
Wildes Erzählung wird dahin uminterpretiert, daß ein Berliner Immobilienhändler das Schloß der Cantervilles kaufen und von Grund auf sanieren will. Für so etwas wie einen Hausgeist hat er schon berufshalber keinen Sinn, erschrickt auch nicht vor ihm, sondern weist ihn schon bei ihrer ersten Begegnung zurecht, nicht dauernd solchen Lärm zu machen: Hart arbeitende Menschen brauchten ihren Schlaf. Und geradezu sofort eröffnen seine beiden halbwüchsigen Söhne die Jagd auf das schließlich nur noch gepieksakte Gespenst. Indessen die ausgesprochen ambitionierte Sekretärin – über den Kopf des von ihr ziemlich gegängelten Mannes hinweg – aus dem Anwesen sogar ein Disneyland machen will, für das ihr ein echtes Gespenst gerade recht kommt. Sie ist die bereits im Libretto am stärksten typisierte Figur und nicht ohne einige Misogynie in Szene gesetzt; zum Ausgleich wird die Tochter des Immobilienhändlers zur eigentlich moralischen Instanz. Es ist ein allerdings wohl nur Erwachsenen auffallender Hintertreppenwitz dieser Fabel, daß die junge Dame mit dem sich schließlich als Erben des Schlosses entpuppenden Haushälterinnensohn ein nicht minder schwaches Männchen bekommen wird, als ihn die Sekretärin in ihrem Chef hat. Den führt sie quasi an ihren Strapsen. Freilich sieht man derart elegante lange Beine auf einer Bühne selten; ihre Darstellerin hat durchaus nicht unrecht, sie derart präsentieren zu lassen. Allerdings sind die jungen Zuhörer:innen mehr auf die menschengroße Ratte und ihre glühenden Augen fokussiert, besonders, wenn sie in der Pause träge auf der Brüstung zwischen Saal und Orchestergraben fläzt und sich die Ohren kaulen läßt. ***Marius Felix Langes Musik changiert zwischen zeitgenössischem Musical US-amerikanischer Prägung und freitonaler europäischer Oper mit stark rhythmischem Drive einerseits, elegischen halb Traum-, halb Sehnsuchtspassagen andererseits. Es spricht für sie, daß der Komponist auch an gefährlichen Stellen einer gewissen Tendenz zur Schnulze nicht völlig erliegt; er ist kein abgebuffter Andrew Lloyd Webber. Vielmehr hebt er seine Melodien immer wieder in die Uneindeutigkeit, beispielhaft etwa in Virginias Einschlafszene, für die das Gespenst ein Lullaby mit der Stimme der verstorbenen Kindsmutter singt; da flossen im Publikum einige Tränen. Wiederum die quasi Finalarie des Gespenstes selbst, das sich nach all seinen 450 Jahren die endliche Ruhe ersehnt, klingt frappierend nach dem Othmar Schoeck der Zwanzigerjahre. An anderen Stellen hatte ich Schreker im Ohr. Insgesamt also eine frühmodern-eklektizistische Musik unter Aussparung späterer Serialität – eine gerade für eine Kinderoper kluge ästhetische Wahl. Sie spannt in den Ohren der jungen Hörer:innen weite Möglichkeiten des musikalischen Ausdrucks auf und lehrt sie deshalb hören, ohne dabei didaktisch zu sein. Besonders eindrucksvoll ist überdies, wie fast makellos die Übertragung der ursprünglich kammerorchestralen Konzeption auf ein großes Orchester gelungen ist. Die erste, für die Zürcher Oper – also unter der Ägide des vormaligen Intendanten der Komischen Oper, Andreas Homoki – entstandene Fassung war noch auf kleine Besetzung entworfen.
Die nunmehr „große“ Fassung bringt Vorteile mit sich, wie sie einer „kleinen“ gerade in Anbetracht der Werklänge fehlen dürften: Fast zwei von nur einer Pause unterbrochene Stunden Musik sind besonders für kleinere Kinder eigentlich nicht zu verkraften. Hier aber lief das fast unheimlich konzentriert ab; daß dennoch einige permanent quasselten, warf mehr ein Licht auf ihre Leit- und Erziehungspersonen, als daß es gegen Langes Oper spräche. Deren sowohl musikalischer wie dramaturgischer Aktionismus, lustvoll von Jasmina Hadziahmetovic in rasante Szenen gesetzt, nimmt es im Gegenteil einfach in sich auf. Auchßvergißt man, bzw, übersieht völlig, das das oft hoch überm Bühnenboden schwebende Gespenst an Seilen hängt; es spaziert auch schon mal im rechten Winkel die Wand hinab. Daß fast durchweg über Mikrophone gesungen und gesprochen wird, stellt schlichtweg die Textverständlichkeit sicher: für Kinder, die keine Übertitel mitlesen können, eine conditio sine qua non. Nur die etwas zu durchschaubar sich bewegenden Ritterrüstungen stören durch mechanische Erwartbarkeit; sowas haben auch Siebenjährige oft schon „besser“ gesehen, etwa meine Zwillinge, um von meinem schon älteren Sohn zu schweigen. Mit allen dreien habe ich mich selbstverständlich besprochen, bevor ich mich an diese Kritik gesetzt habe.
Deshalb ein ganz besonderes Danke an Gideon Davey, der die Kostüme entworfen hat. Farbigkeit und losgelassene Formenfreude wirkt auf Kinder unmittelbar und noch sehr lange nach – hier etwa auch die Phantastik der übrigen Geistererscheinungen. Daß ältere Zuschauer:innen bei der Ballszene, direkt nach der Pause, sofort an Polanski denken müssen, spielt für Kinder keine Rolle.
Auch die Besetzung dieser deutschen Erstaufführung ist ganz wunderbar. Alma Sadé singt die Virginia mit einem innigen Ton, hin- und herschwankend zwischen eigentlich noch Mädchen und aber zu früh schon Mutter, ersatzhaft für die beiden Brüder, die vielleicht ein wenig jünger hätten gewählt werden können; nur wäre das stimmlich dann nicht hingekommen. Kinderrollen sind in der Oper fast immer ein Problem; wirklich meisterhaft hat das wohl nur Britten geschafft. Carsten Sabrowski gibt einen makellos profanen, eigentlich verloren, also um so wichtigtuerischeren Vater ab, und Adela Zaharia hat ganz offenbar einen riesigen Spaß an ihrer nicht so wirklich korrekten Karikatur einer machtgeilen Sekretärin. Hätte sie nicht diese Beine, sämtlicher Zuschauer Antipathie wär ihr, die Figur, restlos sicher gewesen. Nur hat sie sie halt. So daß man, wenn auch nur derenhalber, den weichen Makler verstehen kann. Und schließlich Tom Erik Lie, das Gespenst: mit großer Geste, großem Ton, doch so klein gewordenem, eingeschrumpftem Herzen, daß man es in den Händen schützen möchte: ganz längst selbst wieder Kind: 
Temperamentvolles Orchester, unverniedlichter Klangrausch, geführt von einer Dirigentin, die ich einmal gerne mit wirklich Schreker hören würde: Kristiina Poska. ***
Marius Felix Lange
DAS GESPENST VON CANTERVILLE
Gruseloper in zwei Akten
Libretto von Michael Frowin, nach Oscar Wildes Erzählung.
Musikalische Leitung Kristiina Poska – Inszenierung Jasmina Hadziahmetovic
Bühnenbild Paul Zoller – Kostüme Gideon Davey – Dramaturgie Pavel B. Jiracek, Beate Breidenbach – Chöre Andrew Crooks – Licht Diego Leetz
Tom Erik Lie - Carsten Sabrowski - Alma Sadé - Stephan Witzlinger
Fabian Guggisberg - Christiane Oertel - Johannes Dunz - Frauke-Beeke Hansen
Orchester und Chorsolisten der Komischen Oper Berlin
Kristiina Poska
Die nächsten Vorstellungen:
So 2., So 9., Do 13., So 16., Fr 28. November 2014.
Do 4., So 7., Fr 26. Dezember 2014.
>>>> Kartenalbannikolaiherbst - Dienstag, 4. November 2014, 12:32- Rubrik: Oper
|
|
Für Adrian Ranjit Singh v. Ribbentrop,
meinen Sohn.
Herbst & Deters Fiktionäre:
Achtung Archive!
DIE DSCHUNGEL. ANDERSWELT wird im Rahmen eines Projektes der Universität Innsbruck beforscht und über >>>> DILIMAG, sowie durch das >>>> deutsche literatur archiv Marbach archiviert und der Öffentlichkeit auch andernorts zugänglich gemacht. Mitschreiber Der Dschungel erklären, indem sie sie mitschreiben, ihr Einverständnis.
NEU ERSCHIENEN
Wieder da - nach
14 Jahren des Verbots:
Kontakt ANH:
fiktionaere AT gmx DOT de
E R E I G N I S S E :
# IN DER DINGLICHEN REALITÄT:
Wien
Donnerstag, 30. November 2017
CHAMBER MUSIC
Vorstellung der neuen Nachdichtungen
VERLAGSABEND >>>> ARCO
>>>> Buchhandlung a.punkt
Brigitte Salandra
Fischerstiege 1-7
1010 Wien
20 Uhr
NEUES
Die Dynamik
hatte so etwas. Hab's öfter im Kopf abgespielt....
Bruno Lampe - 2018/01/17 21:27
albannikolaiherbst - 2018/01/17 09:45
Zwischenbemerkung (als Arbeitsjournal). ...
Freundin,
ich bin wieder von der Insel zurück, kam gestern abends an, die Wohnung war kalt, vor allem ... albannikolaiherbst - 2018/01/17 09:38
Sabinenliebe. (Auszug).
(...)
So beobachtete ich sie heimlich für mich. Zum Beispiel sehe ich sie noch heute an dem großen Braunschweiger ... Ritt auf dem Pegasos...
Der Ritt auf dem Pegasos ist nicht ganz ungefährlich,...
werneburg - 2018/01/17 08:24
Pegasoi@findeiss.
Den Pegasus zu reiten, bedeutet, dichterisch tätig...
albannikolaiherbst - 2018/01/17 07:50
Vom@Lampe Lastwagen fallen.
Eine ähnliche Begegnung hatte ich vor Jahren in...
albannikolaiherbst - 2018/01/17 07:43
findeiss - 2018/01/16 21:06
Pferde
In dieser Nacht träumte ich, dass ich über hügeliges Land ging, mit reifen, dunkelgrünen, im Wind raschelnden ... lies doch das noch mal
dann stimmt auch die zeitrechnung
http://alban nikolaiherbst.twoday.net/s tories/interview-mit-anady omene/
und...
Anna Häusler - 2018/01/14 23:38
lieber alban
sehr bewegend dein abschied von der löwin, der...
Anna Häusler - 2018/01/14 23:27
Bruno Lampe - 2018/01/11 19:30
III, 356 - Merkwürdige Begegnung
Seit einer Woche war die Wasserrechnung fällig und ich somit irgendwie gezwungen, doch noch das Postamt ... Bruno Lampe - 2018/01/07 20:34
III, 355 - … und der Gürtel des Orion
Epifania del Nostro Signore und Apertura Staordinario des einen Supermarkts - Coop. Seit dem ersten Januar ... Bruno Lampe - 2018/01/03 19:44
III, 354 - Neujahrsnacht e dintorni
Das Jahr begann mit einer unvorgesehenen Autofahrt bzw. mit der Gewißheit, mir am Vormittag Zigaretten ... albannikolaiherbst - 2018/01/03 15:16
Isola africana (1). Das Arbeitsjournal ...
[Mâconièrevilla Uno, Terrasse im Vormittagslicht
10.32 Uhr
Britten, Rhapsodie für Streichquartett]
Das ...
JPC

DIE DSCHUNGEL.ANDERSWELT ist seit 4967 Tagen online.
Zuletzt aktualisiert am 2018/01/17 21:27
IMPRESSUM
Die Dschungel. Anderswelt
Das literarische Weblog
Seit 2003/2004
Redaktion:
Herbst & Deters Fiktionäre
Dunckerstraße 68, Q3
10437 Berlin
ViSdP: Alban Nikolai Herbst
HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Der Autor diese Weblogs erklärt hiermit
ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen
Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle
und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft
der gelinkten/verknüpften Seiten hat der Autor keinerlei Einfluss.
Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten
aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung
verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb
des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für
Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Gästebüchern,
Diskussionsforen und Mailinglisten, insbesondere für Fremdeinträge
innerhalb dieses Weblogs. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen,
haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde,
nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung
lediglich verweist.
|