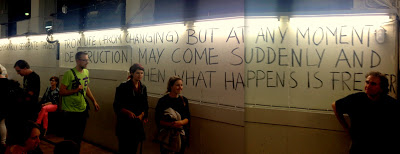|
|
Oper

Vorweg >>>> zum Ereignis, das mich hinein-, muß ich sagen, -trieb; unterdessen bin ich fast ebenso puccini- wie allerdings ganz besonders Wagners müde. Aber Barenboim hat sich ganz sicher nicht grundlos die, neben der Bohème, von allen Pucciniopern beliebteste ausgesucht. Ihre innere Radikalität - auch aber die thematische Ambivalenz - hat zu Uraufführungszeiten nämlich heftige Ablehnung erwirkt, der Fachwelt. Ich bin geneigt, von „Abwehr“ zu sprechen. Welterfolg war die Oper gleichwohl. Das hatte weniger mit der politischen und dabei antiklerikalen Brisanz des Stoffes zu tun als vor allem mit Puccinis Schmelz und insgesamt der Mitsanglichkeit des Belcantos, hier aber eben auch mit der klaren Ungeheuerlichkeit Scarpias, des sadistischen Polizeichefs der seinerzeit österreichischen Herrschaft über Rom. An ihm, dem „Bösen“, gibt es eben keinerlei Ambivalenz. Auch in Hermanis‘ Inszenierung wird auf sie, ihnbezüglich, kein Wert gelegt. Was ich schade finde. Er ist einfach das Ungeheuer, dem jede eigene Erlösungssehnsucht im Interesse populistischer Anti-Identifikation verweigert bleibt, obwohl sie von Mephisto bis Dracula jedes solche eben auch immer kennzeichnet. Bei Puccini ist die restlose Schwarzweißzeichnung politisch zu verstehen. Sie zeigt, wessen Partei er ergreift, besonders wenn am kompositorisch grandiosen Ende des Ersten Aktes das katholische Laudate unlösbar mit Scarpias Haßarie verschmilzt. In der neuen Staatsoperninszenierung ist diese Szene musikalisch der absolute Höhepunkt. Genau von dem hätte eine tatsächliche Neuinterpretation auszugehen.
Barenboim ist einer der weltweit derzeit wichtigsten Wagnerdirigenten überhaupt; das ist diesem Puccini-Debut auch anzuhören. Er bringt das Kunststück fertig, sein Orchester trotz der für Massenorchestrierung heiklen Akustik – nach wie vor ist das Schilltertheater Interimsort der Staatsoper – extrem weitflächig klingen zu lassen, so, als dehnte sich der Orchestergraben um mindestens noch einmal den doppelten Raum aus. Dazu ist Barenboims Ausarbeitung der Themen ausgesprochen scharf und dem Sujet gemäß hart; sentimentale Weichlichkeiten läßt er nicht zu. Das erlaubt ihm, die wegen der in Puccinis Partituren häufigen Parallelführungen immer etwas lauernde Gefahr der Breiigkeit völlig auszuhebeln und in eine orchestrale geradezu Durchsichtigkeit herumzudrehen. Auf diesem Meer klanglicher Luzidität lassen sich die einzelnen Kompositionsinseln selbstverständlich detaillierter sehen, also hören, als würde der Tonraum zusammengepreßt. Ebenso kann Barenboim das Orchester nun mit einem enormen Reichtum an Tonfarben spielen lassen, unter denen in Einheit mit den Kirchenglocken immer die Drohung tiefster Kanonschläge liegt. Der Nachteil ist, bei der diesem Klangaum nicht entsprechenden Schillertheater-Bühne, daß die Sängerinnen und Sänger fast durchweg mit dem Forte kämpfen müssen. Da kommt es schon mal vor, daß etwa Michael Volles ansonsten ungeheuer präsenter Scarpia für ein zwei Töne im Chor verschwindet, und fast am Ende der Oper schien Fabio Sartoris großer Tenor für eine Sekunde in die Knie zu gehen. Aber er fing das meisterhaft auf, als hätte er auf ein Luftreserevat zurückgegriffen und es, ohne zu pressen, freigesetzt. Anja Kampes Sopran blieb dagegen von der ersten bis zur letzten Sekunde unbrechbar. Dabei singt sie kaum mit Tremolo. Allerdings ist ihre Stimme bereits sehr reif und tendiert ins Mezzo. Es singt hier keine junge Tosca mehr, auch keine, die Jugend stimmlich darstellen kann – einen Umstand, dem Alvis Hermanis‘ Regie ebenso zu begegnen versucht hat wie, auf dieser Bühne, Cavaradossis geradezu klischeehaft-bizarrer Leibesfülle. Doch zum Konzept der Inszenierung gleich mehr. Problematisch ist, daß, wegen des von Barenboim vorgegebenen Primats des Orchesters, die Personen, vor allem Tosca, nicht wirklich eine Möglichkeit haben, komplexere Seelenzustände Stimme werden zu lassen. Sie sind, wie schon in seiner Text-Anlage Scarpia, auf harte Kontraste verwiesen, so daß etwa die Eifersucht - auf ein Bild (!) - zur ganzen-Eifersucht-an-sich wird. Nun ist Eifersucht für sich genommen schon ziemlich lächerlich, aber besonders, wenn sie sich derart mänadisch auf ein Ersatzobjekt stürzt. Wagnerscher Musikaufruhr läßt einen aber nicht lachen, nicht mal spotten, sondern bügelt den Kopfschüttler einfach nieder. Wenn sich Barenboim also etwas vorwerfen läßt, dann, daß er Wagners Totalismus auf Puccini überträgt; andererseits gewinnt Puccinis Musik dadurch spürbar an musikästhetischer Bedeutung – oder wird in ihrer Bedeutung überhaupt erst klar. Die Klageklänge etwa der breitgeführten Streicher bekommen Tristan-Niveau und überhaupt, besonders, wie Barenboim die Celli hebt. Man denke an das kurze orchestrale Zwischenspiel beim Wiedersehen der Liebenden in Scarpias Arbeitszimmer. Und in den Aufruhr der Gefühle läßt Barenboim aus dem ohnedies wühlenden Orchester die Klangfarben geradezu hinein schießen.
Der Jubel des Publikums nach Fall des letzten Vorhangs war vorherzusehen. Und absolut berechtigt. Die geradezu unsisonen Buhs für das Regieteam sind es n i c h t. Sie lassen sich nicht einmal erklären,nicht in dieser unisonen, unnachdenkenden Art des gestrigen späten Abends - es sei denn, es wäre eine Neudeutung allen Ernstes erwartet worden. Was ich bei Puccini nicht glaube.
Neudeutung ist Hermanis‘ Tosca tatsächlich nicht, aber eine solide, auf dem Boden realistischer Puccini-Inszenierungen stehende Arbeit. Gutes Handwerk also, vielleicht auch bestes. Nicht mehr, nicht weniger.
Die Szenen sind über Einrichtungsstücke angedeutet ausgeführt: eine Kirchenwand, das Zimmer im Palazzo Farnese, der Vorgang vor den Kerkern im Castel S. Angelo. Das schränkt den Raum ein, er ist quasi dauernd eng, was das Problem zwischen Orchester und Sänger:innen verstärkt. Weite kommt über Bilder zustande, die – quasi gerahmt, das ist wichtig – in die Szenen eingeblendet sind und wechseln: bisweilen ein Porträt, bisweilen ein Tableau, aber im Stil realistischer Comics.
Auf denen wird parallel zum Bühnengeschehen die Geschichte noch einmal erzählt, nun aber mit den, sagen wir, Idealgestalten der Personen. Da steht die Tosca wirklich in der Knospe, der Cavaradossi ist ein junger schlanker Bohèmien mit Dreitagesbart, und Scarpia trägt die für feudale Macht stehende Perücke des ancient régime:  Fotografie © Hermann und Clärchen Baus. Fotografie © Hermann und Clärchen Baus.Nur daß die Sprechblasen fehlen.
Aus Sicht der Tafeln läßt sich sagen, daß diese, die Sprechblasen, von der Bühne vorgestellt werden. Denn wenn wir uns auf die Tafeln konzentrieren, findet die, noch einmal, ideale Inszenierung des Stücks eben in ihnen statt. Das ist nicht ohne Radikalität. Dabei stört die Diskrepanz zwischen etwa der Erscheinung des leibhaftigen Cavaradossis und dem auf den Tafeln nur ganz zu Anfang. Zunehmend dann erhält der leibhaftige des gezeichneten idealen Gestalt. Das ist ausgesprochen frappierend:  Fotografie ©: Hermann und Clärchen Baus. Fotografie ©: Hermann und Clärchen Baus.Selbstverständlich man muß sich darauf einlassen wollen, sonst funktioniert es nicht. Und später stören die Schäferbilder zu Beginn von Akt III ziemlich die Ästhetik. Daß die Engelsburg zur Handlungszeit tatsächlich an der Stadtgrenze lag und wirklich dort Tiere weideten, ist als Wissen ganz hübsch. Aber dafür hätte ein einzelnes Bild genügt. Statt dessen bekommt man eine gezeichnete Stadtführerfolge des späten 18. Jahrhunderts vor die Augen. Was szenisch einen ziemlichen Löckchenkitsch ergibt. Das liegt schlicht daran, daß sich auf den Tafeln das Niveau der Zeichenstrichs ändert, der Raum des realistische Comics verlassen wird. So daß ich zum ersten Mal in meinem Leben ein Regiemätzchen gesehen habe, das gezeichnet worden ist. Es ist aber, meiner Erinnerung nach, das einzige. Nervig freilich noch, daß an der Deckenleiste von Scapias Arbeitszimmer „Palazzo Farnese“ steht. Erstens weiß man das sowieso, zweitens läßt es sich dem Programmheft entnehmen, drittens ist der Ort prinzipiell völlig wurscht. Wobei ich ganz gerne einwenden möchte, es sei nicht sehr glaubhaft, daß der mächtige Scarpia mit seinen Untergebenen während der Arbeitszeit Wein trinkt, schon gar nicht solche Mengen. Er hätte mit denen überhaupt nicht getrunken; erst recht hätten sie sich nicht ungefragt aus seinen Weinflasche n (!), ja, mehrere gleich, einschenken dürfen. Andererseits gibt dies der Tosca die Möglichkeit, nach Scarpias Tötung sich ebenfalls ein Gläschen zu gönnen, ja sie nimmt in seinem Lehnstuhl Platz – für einen kurzen Moment nun selber mächtig, und ebenfalls, wenn auch aus hoher Not, durch Gewalttat. Wobei die Tragik hier besonders für jeden deutlich wird, die und der den Stückausgang schon kennt: daß sie über des mächtigen Mannes Tod hinaus von ihm gegängelt wird.
Die in ihren fernen und näheren Kirchenglockenklängen grandiose Pastorale des dritten Aktanfangs führt dann allerdings, erstmals, zu dramaturgischen Längen. Es ist mit einem Mal, im Gefängnis, Zeit zu Besinnungen, gegenseitigen Versicherungen, Liebesschwüren usw. Das fällt aus der bis hierhin ausgesprochen handlungsgetriebenen Oper ziemlich heraus und müßte, für meinen Geschmack, gestrafft werden. Oder die Regie wüßte die Längen zu überbildern. Denn auch musikalisch gibt es nicht eigentlich mehr Neues. Die Geschichte ist tatsächlich zum Stehen gekommen und wird jeden Moment enden. Jetzt zieht und zieht die Oper diesen Moment, ein wenig wie bei in der Oper Sterbenden, die stundenlang noch weitersingen. Siegfried ist so ein Kandidat, bei dem man allerdings eh froh wäre, wenn ihn das Zeitliche endlich aussegnen würde. Hingegen uns mit Cavaradossi eine auch politische Sympathie verbindet. So müßte nun die nach wie vor wirkende Präsenz Scarpias deutlicher werden, wohl auch die Stabilität insgesamt des totalitären Gewaltsystems – zu dem gehört, daß Hermanis denselben Mann Cavaradossi liqudieren läßt, der ihm zuvor fast kameradschaftlich zu trinken gegeben hat. Hierüber, eventuell, wäre dieser ganze Akt aufzurollen gewesen: um ins schwarze, steinerne Herz der Gewaltstrukturen einzudringen, die an ihrer Oberfläche so warm wie alle Herzen schlagen.
Doch wie nun auch immer:
In jedem Fall hineingehen.

Giacomo Puccini
T o s c a
Oper in drei Akten.
Libretto nach Victorien Sardou
von Giuseppe Giacosa und Luigi Illica.
Regie Alvis Hermanis, Mitarbeit der Regie Gudrun Hartmann,
Ausstattung Kristine Jurjane, Licht Gleb Filshtinsky, Chöre Martin Wright,
Dramaturgie Jens Schroth
Anja Kampe - Fabio Sartori - Michael Volle
Tobias Schabel - Jan Martiník - Florian Hoffmann
Maximilian Krummen - Grigory Shkarupa - Jakob Buschermöhle
Staatskapelle Berlin, Staatsopern- und Kinderchor der Staatsoper Unter den Linden
Daniel Barenboim
(Tosca->>>>Website der Staatsoper.)
Die nächsten Vorstellungen:
06., 12., 16., 19., 22. und 25. Oktober 2014
Jeweils um 19:30 UHR.
>>>> Karten albannikolaiherbst - Samstag, 4. Oktober 2014, 13:14- Rubrik: Oper
[Fotografien ©: >>>> Marcus Lieberenz.] [John Claggart, genannt Jimmy Legs.] [John Claggart, genannt Jimmy Legs.]
Die Geschichte ist kurz erzählt:
Der junge Billy Budd wird von Pressern des britischen Kriegsschiffes „Indominable“ ausgehoben. Anders als seine Schicksalsgenossen freut er sich über seine neue Tätigkeit, ist mehr als nur gehorsam und erträumt sich schnellen Aufstieg an Bord. Da er sehr schön ist, fast licht, erringt er binnen kurzen die Zuneigung aller, ja man träumt von ihm. So daß es ist, als stünde er – allein seiner Existenz wegen - für ein besseres Leben. Dieses ist dem Waffenmeister, dessen tiefe Dunkelheit von dem Jungen ebenfalls erleuchtet wird, bedrohlich, weshalb er ihn als Meuterer denunziert. Zur Rede gestellt, kann Budd, der bei Aufregungen ohnedies stottert, nicht antworten, aber im Affekt holt er aus und erschlägt den Mann. Damit ist der Straftatbestand der Meuterei erfüllt. Rein im Wortsinn des Kriegsrechts und gegen besseres Fühlen des Kapitäns und aller anderen an diesem Urteil Beteiligen wird Budd zum Tod durch den Strang veruteilt und der Richtspruch vollzogen.
Die Oper setzt Jahrzehnte später in der Erinnerung des Kapitäns ein. In David Aldens Inszenierung sehen wir nach dem kurzen dunklen Vorspiel in den Bauch eines durchaus modernen Kriegsschiffes, nicht etwa Windjammers, wie ihn Herman Melville für jene „Zeit, in der es noch keine Dampfschiffe gab“, vor den Augen gehabt hat, als er seine Novelle „Billy Budd“ schrieb, die für Benjamin Britten und seine beiden Librettisten Forster und Crozier Vorlage des gleichnamigen, 1951 uraufgeführten und zehn Jahre später noch einmal revidierten Musiktheaters geworden ist. Der Urtext selbst war erst 1929, fast dreißig Jahre nach Melvilles Tod, veröffentlicht worden; nicht nur dieser Umstand gibt ihm Modernität – der in einer sogenannten Materialschlacht gipfelnde Erste Weltkrieg war bereits geführt worden – , sondern auch das formal eigenartige, in seiner Fragmentartigkeit fast etwas unheimliche Ende der Erzählung, ja überhaupt, daß sie aus narrationslogisch zunehmend lockeren, quasi unverbundenen Stücken besteht, deren letztes, das Gedicht „Billy in Ketten“, für Britten zur Vorlage einer der anrührendsten Partien dieser Oper wurde. Ihr musikalisches Thema wird bereits in Budds Ewachensarie am Ende des ersten Aktes, aber da nur ganz vorsichtig, laut und am Ende des zweiten Aktes zu seinem Lebensabschiedsgesang – eine der herzbeklemmend meisterhaften Konstuktionsideen überhaupt dieses Komponisten, schon deshalb, weil sie unter den aktiven Anfang und das schließliche Ende des Unheils einen eigenen Boden zieht, es besonders quasi beleuchtet, indes das Unheil des Gesamten ungebrochen sich fortsetzt und ungebrochen begonnen hat. Nur die Erinnerung beginnt, nicht das Geschehen. Deshalb auch singt der Chor zu Anfang nicht frei, ich möchte einmal sagen: er schmettert nicht, wie das bisweilen auf CD-Einspielungen zu hören ist, sondern die ständige Gedrücktheit liegt auf ihm. „Seafarers“ kann man auf einem Plakat am Bahnhof des Hafens von Harvich lesen, „are like prisoners but they have commited no crime“. Für gepreßte Soldaten, und erst recht auf See, gilt das besonders. Man hört immer eine Art Sehnsucht, aber sie duckt sich bereits im Ausdruck vor dem schon nächsten Schlag:  So ist es auch wahrscheinlich kein Zufall, daß die Stahltäger in den rohen Kassetten der metallenen rostfarbenen Bühnen-Bordsswand, auf die wir sehen – hälftlings zieht sich, als stilisierte Brücke des Schiffs – ein eiserner Gang davor entlang, jeweils zwei gegeneinander um 90 Grad versetzte Kreuze sind. Auch wenn Brittens Partitur Anspielungen auf die Erlösungsgeschichte eigentlich vermeidet, sind sie bei Melville deutlich zu lesen, besonders nachdrücklich dort, wo gegen Budd erstmal die falsche Anschuldigung öffentlich vorgebracht wird: „... so daß er nur um so heftiger nach Worten rang, bis er dann sehr bald völlig erlahmte mit dem Ausdruck eines Gekreuzigten“ *. Nur hat dieser Erlöser gar nichts anderes getan, als einfach schön zu sein. Und um einen Judas zu finden, reicht es völlig hin, daß man ihn vorher gequält hat. Brittens Oper, jenseits des Rätsels Kunst überhaupt, Rätselhaftigkeit zuzuschreiben, ist absurd. Alles, wirklich alles liegt furchtbar offen da; man muß es lediglich denken auch wollen.
Tatsächlich können in hart restiktiven Gesellschaften Güte, Offen- und Unvoreingenommenheit, ja sogar Authentizität zu Ursachen einer nicht eindämmbaren Rebellion werden. Das haben im Fall des Nazareners die Pharisäer gespürt, Roms imperialistische Machthaber Roms sowieso, und genau dies spüren in Melvilles Novelle und Brittens Oper die Offiziere, vor allem jene, denen die Disziplinierung der Mannschaft obliegt– am nachdrücklichsten die in ihrer bewußten Verfallenheit intessanteste Figur des Stücks, der Jemmy Leggs bespitznamte, Wagners Hagen nicht unähnliche Waffenmeister John Claggart. Indem Budd in ihm einen verschütteten Sehnsuchtsteil zwar nicht ausgräbt, nein, aber zum Anklingen bringt – er tritt gegenüber dem Jungen nicht, wie gegen alle anderen sonst, unerbittlich auf, ja lobt ihn sogar – , muß er diese in sich verspürte Schwäche, die an Zärtlichkeit rührt, als eine bedohliche Verzärtelung erspüren. Es ist diese Dynamik, übrigens, die Vergewaltigungen als logische Folgen von Kriegshandlungen klarstellt, und zwar grundsätzlich; sie sind insofern, was immer anderes die Statuten auch vorschreiben mögen, gewünscht. Billy Budds schöne Erscheinung jedenfalls, ihre Helligkeit, gefährdet die Abläufe des Bordlebens, verweichlicht sie tatsächlich. Dabei spielt es keine Rolle, daß er keinerlei Arg kennt und schon gar nicht Aufruhr im Sinn trägt, sondern sich sogar willig sämtlichen Einschränkungen und Demütigungen unterwirft, ja sie noch begeistert begrüßt. Insofern hat Claggert als Personifizierung der Kriegsmaschine in deren Logik völlig recht, den Jungen einen Meuterer zu nennen. Das ist das eigentlich Bösartige an Melvilles Erzählung wie an Brittens Oper. Das auch ist es, was der Kapitän des Schiffes, Vere, unmittelbar nach nach dem Tod seines Waffenmeisters begreifen muß und ihn das objektiv falsche, im Interesse des Kriegs aber richtige Urteil fällen läßt. „The angel of god has struck and the angel must hang (...)“
Was in Brittens Musikwerk vor Gericht steht, ist der Krieg nämlich selbst, ganz unabhängig von den Kulturräumen, in denen er geführt wird. „Kein Kind“ heißt es bei Melville im Kapitel der Gerichtsverhandlung, „kann seinem Vater ähnlicher sehen als dieses Gesetz seinem Erzeuger, nämlich dem Krieg.“ Daß hier auch homosexuelle Attraktionen mitverhandelt werden – zu Brittens Zeiten noch ein Rechtsbruch – , ist für die Oper nebensächlich, auch wenn immer wieder ein Anderes ins interpretatorische Zentrum gerückt wird; es geht de facto nicht um sexuelles Begehren, sondern um Sanftheit und Licht. Daß auch Frauen den Logiken des notwendigen Kriegsunrechtes folgen, wissen wir nicht erst seit den deutschen Vernichtungslagern und Abu-Ghuraib. Krieg verroht den Menschen und, vor allem, er soll ihn verrohen. Weil er anders nicht führbar wäre. Es ist genau diese Erkenntnis, die Brittens „Billy Budd“ für uns aktuell macht.
Allerdings greift gegenüber Melvilles sachlich-distanzierter Erzählhaltung, die den seelenlosen Character der Vorgänge spiegelt, Brittens Komposition direkt an das Herz. So saß meine Begleiterin, die diese Oper noch nicht kannte, nach Ende des Stücks wie fassungslos da und konnte sich auch danach lange noch nicht lösen, - ja selbst die für meinen Geschmack – es sind auch nur wenige – um eine Spur zu deutlichen Anspielungen verfehlten nicht ihre Wirkung, etwa, wenn Claggert, indem er den zuvor ausgepeitschten Seeburschen als Spitzel dingt, sich dabei über ihn wirft und anale Penetrationsbewegungen macht. Daß er ihm Geldstücke gibt, in diesem Fall Gold, ist an sich unnötig, aber unterstreicht noch einmal die Parallele zum Neuen Testament. Dies nur nebenbei bemerkt.
Alden hat ohne Überhöhung inszeniert, „neusachlich“ könnte man sagen, und seine auf jede Perücke der Zeit verzichtenden Partner, Constance Hoffmann für die Kostüme und Paul Steinberg für das Bühnenbild, folgen ihm darin; die Szene ist martialisch material, man ist ans Innere eines UBoots erinnert und alles auf Zerstörung aus, die Kleidung faschistoid, Uniformen, Leder und Wachstuch, unterhalb der Offiziersebene werden quasi Lumpen getragen. Das entspricht den Gepflogenheiten er die britische Seemacht durch Aushebung auffüllenden Praxis. Nur der von der gesamten Mannschaft geliebte Kapitän steht in Weiß da und wird damit zu einem Spiegelbild Budds, aber einem, der die Autorität hat. Daß man den in der Oper, nicht aber in Melvilles Novelle letztlich komplett schwachen Mann aber liebt, hat allerdings damit zu tun, daß er alle Führungsentscheidungen, besonders über die Mannschaft, an seine Offiziere abgibt; er selbst ist es nicht, der quält, doch sieht über die Qualen hinweg, liest lieber antike Autoren, und hat eine sogar strategische Fehlleistung zu verantworten. Als er schließlich, des angeklagten Budds wegen, doch einmal eine Entscheidung treffen muß, windet er sich selbst da heraus: „Grant us our guidance“, bitten die Offiziere. „No“, gibt er zur Antwort. „Do not ask me; I cannot.“ Das entspricht fast Pontius Pilatus‘ Haltung gegenüber Jesus von Nazareth, als jener das schließliche Urteil dem Volk überläßt, bevor er seine eigenen Hände in Unschuld wäscht. Wo Vere sich bei Melville noch ausdrücklich auf den Wortlaut des Kriegsgesetzes beruft, er also noch de jure, nicht aber de facto, Recht spricht, gibt er bei Britten die Verantwortung feige weiter – und dies, obwohl ihm seine Offiziere die Gründe für einen Freispruch geradezu verzweifelt in den Mund legen zu wollen scheinen. Interessant daran ist, daß der Komponist selbst immer darauf bestanden hat, in Vere die eigentliche Hauptperson der Erzählung zu sehen; doch strich er diese deutliche Sympathie für ihn selbst durch, nämlich, als er die Oper zehn Jahre nach ihrer Uraufführung um mehr als ein Drittel Spielzeit und die vier Akte auf nur noch zwei Akte kürzte. Dadurch fielen wichtige, den Kapitän ins Charakterbild nehmende Szenen weg; daß und weshalb man ihn liebt, wird nunmehr nur noch behauptet und nicht mehr vorgeführt; schon deshalb muß sein erster Auftritt nun, in dem der wie mehr oder minder ins Kriegsgeschehen „gefallene“ Schöngeist zwar am Ende eines riesigen Kanonenrohres, aber in einer strahlend weißen Kajüte logiert, den eines geradezu unerträglichen Weichlings machen. Aldens materialkonzentrierte Inszenierung unterstreicht das noch; Veres strahlende Weiße wird aber dadurch ebenfalls zur Behauptung, nämlich einer allein der Inszenierung, ohne daß in irgend einer Weise substantiiert würde. Das ist problematisch, weil ja das Gegenbild, Billy Budds tatsächliche Freundlichkeit, eben nicht nur symbolisch und „gemeint“, sondern wie seine Schönheit konkret ist. Es ist, als hätte sich das Regieteam nicht anders zu helfen gewußt, wenn es Brittens Äußerungen bezüglich dieses Kapitäns ernst nehmen wollte. Alleine Kleidung kann eine wie auch immer gespaltene innere Größe nicht zeigen; dazu braucht es Handlung. Deshalb kommt einem Veres späte Zerknirschung in dem dunklen Bußgewand eines gebeugten alten Mannes nur um so feiger vor. Nicht mal die Größe, offen für Schuld einzustehen, dachte ich, zwar Selbstanklage („What have I done?“), aber sich eklig erlösend durch Verklärung: „There‘s a land where she (i.e. die Liebe) anchors for ever.“
Hiergegen ist der Waffenmeister, an dem Britten selbst nicht eine einzige gute Seite sehen wollte, von einer geradezu radikalen Klarheit; für mich ist er, besonders dieser Berliner, nämlich in Gidon Saks‘ stimm- und präsenzgewaltiger Interpretation, die wirkliche Hauptperson der Oper, und mit allem Recht würde man sie von „Billy Budd“ in „Jimmy Legs“ umbenennen können. Auffällig, ja schlagend, wie dadurch, allein vermittels eines namentlichen Perspektivenwechsels, sich die Wertungen drehten. Denn Jimmy Legs, der Waffenmeister John Claggert, ist der Krieg, ist er personifiziert und nicht, wie immer wieder geschrieben wird, eine Erscheinung Satans. Er ist vielmehr der ausgestoßen Liebende, in den Krieg Gestoßene, der dann unter notwendiger Verleugnung aller zarten Anteile, aller Sehnsüchte und Hoffnungen, zum Geliebten des Krieges wird, zu dem, der den Krieg liebt. „Ach wer heilet die Schmerzen des‘, dem Balsam zu Gift ward“, heißt es in Goethes Winterreise, „der sich Menschenhaß aus der Fülle der übermächtigen Liebe sog?“ Und Claggert, in seinem riesigen Monolog, selbst: „O beauty – o handsomeness“ Would that I never encountered you! Would that I lived in my own world always, in that depravity to which I was born. (…) O beauty, o handesomeness, goodness! would that I had never seen you!“ Genau dies macht ihn, nicht etwa Vere, zu Billy Budds Spiegelbild, nämlich zu dem genau inversen. Billy Budd, bei aller ziemlich dummen, aber doch gutgemeinten Begeisterung, sieht noch in der eigenen, geschweige der Erniedrigung anderer nicht, was der Krieg ist; Claggert, in seiner scharfsinnigen permanenten Gegenwart, sieht es, und beide nehmen ihn gleichermaßen an. Daß Budd später das Todesurteil so sprachlos akzeptiert, hat genau damit zu tun, ist genau davon die pycho/logische Folge: nicht, daß er die Dynamik selbst begriffe, dafür ist er wirklich zu eingeschränkt, aber das Urteil ist ihm evident, und er segnet den Kapitän noch dafür. Der aber, anders als Claggert sofort, begreift imgrunde im Alter noch nicht. Ein Rätsel, ich wiederhole mich, ist dies alles aber nicht oder allenfalls dann, wenn man aus dieser Oper unbedingt ein Schwulendrama machen will. Die erotischen Neigungen sind aber, auch das wiederhole ich bewußt, sind in ihr ganz egal; in allen Gefängnissen, also auch an Bord eines Kriegsschiffs, werden auch heterosexuelle Bedürfnisse in der Gestalt von homosexuellen manifest; es bleibt ihnen gar nichts anderes übrig. Und sowieso ist das egal. Es ist gerade eine Stärke der brittenschen Kunst, daß sie ihre biografischen Bedingungen unendlich transzendiert: kompositorisch ins Jenseits der Geschlechter.
Claggart also ist die Hauptperson, Billy Budd ein dummer Junge, den aber – und eben n i c h t, weder sogleich noch später, den Vere – seine Offenheit und Frische segnen, deretwegen er nicht weiß noch überhaupt merkt, welche Wirkung er auf alle anderen an Bord hat und wie er das, was, um grausam bleiben zu können, hell nicht werden darf, erhellt. Der einzige außer Claggart, der das spürt, ist der eigenbrötlerische Dansker, dessen Warnungen Budd naiv in den Wind schlägt. Zumal Billy wie der genau so dumme, aber anders als er unterträglich großkotzige Siegfried weder weiß, was Furcht ist, noch vor allem, welche Kraft er hat. Hieraus erklärt sich später der spontane Totschlag: daß die Hand wirklich nicht wußte, was sie vermag. Schon das wäre Grund für eine eher milde Strafe, wenn nicht genau so für Bewährung gewesen, wie man sie in der britischen Flotte sogar den bei Melville wie Britten immer wieder zitierten Meuterern der Nore zugestanden hat, dem britischen Schreckbild einer Rebellion von Mannschaften an sich. Aber Billies Hand schlug den Krieg. Genau das ist es, was Kapitän Vere begreift und weshalb er Budd hinrichten muß. Er wäre denn, indirekt, selbst zu einem Meuterer geworden. Genau wie Hagen von Tronje Treubruch rächt, rächt Vere den Bruch von Grausamkeit. Den begriff Claggart vom ersten Ansehn Billies an. Vere selbst, bis ins hohe Alter, hat nicht Format genug, sich einzugestehen, was ihn trieb. Daß Güte und Krieg unvereinbar sind, und zwar prinzipiell.
Auch heute sind sie das nicht, auch nicht in Afghanistan.
David Aldens Inszenierung entstand – wie bereits >>>> der vor einem Jahr in Berlin aufgeführte „Peter Grimes“ – als Koproduktion mit der English National Opera und hatte >>>> dort bereits vor knapp zwei Jahren Premiere; als weiterer Mitproduzent ist diesmal das Moskauer Bolshoi hinzugekommen. Es wäre spannend, die jeweiligen Aufführungen zu vergleichen, besonders, inwieweit die jeweils verschiedenen Besetzungen auf die Interpretation einwirken, sie möglicherweise grundlegend verändern. Ein mehr als in Berlin väterlich gespielter Vere könnte die Perspektive allein durch sein Timbre verändern, ein „heldischerer“ Budd ebenso, der in Berlin wirklich nichts als ein großer Junge ist, aus dem erst in seinem Abgesang eine Art von Zweifel aufsteigt. Hier liegt der eigentliche Skandal des Stücks, weil nämlich der Junge noch da an „die Sache“ und die Menschen glaubt, die sie voranbringen sollen. Den Krieg aber hat er bis ganz zuletzt nicht begriffen. Genau das macht diese Arie so beklemmend traurig, und der wirklich noch junge John Chest singt sie mit allem Schmelz, der sich nur irgend empfinden läßt, ohne sich, gleichsam, über die eigene Tragik zu erheben. Dabei gelingt ihm in der Abschiedsarie ein Klang, den man für gewöhnlich nur im englischen Kunstlied zu hören bekommt. Eine ebenso wie Saks für Claggert absolute Idealbesetzung, ragt er außer über diesen über alle anderen, die man sich ebenso gut auch anders besetzt vorstellen könnte, hinaus, und zwar gerade, weil er nie schmettert, sondern immer irgendwie im Pubertären verblieben zu sein und auch am Ende seiner letzten Arie darin wieder zu versinken scheint: sogar sein Schwärmen ist wie das eines Jünglings-Backfischs, ist sanglich gewissermaßen „unschuldig“ - was ja „ohne Schuld“ bedeutet; man müßte, um ihn sexuell zu begehren, deutlich pädophil sein. Daher seine „Reinheit“, die ihre kompositorische Entsprechung in den Kinderpartien hat: gleichsam Engelsstimmen in dieser dunklen Männeroper, Schellen gleich am Schlitten, der über das tiefnächtliche Eis längst erfrorener Seelen zieht, in die allein das Sonnenstrahlchen Budd ein bißchen Wärme gibt. Und nur deshalb, weil es ist: ***
Es ist grandios, wie Donald Runnicles sein Orchester alles dieses Klang werden läßt und wie es ihm in jeder Regung folgt. Immer ist es, wiewohl musikalisch die Seele des Operngeschehens, der Teppich für die Stimmen, ohne sich je gegen sie zu wenden; kein Schritt in ihm versinkt; immer geht es mit ihnen, den Stimmen, ohne daß man andererseits den Eindruck hätte, daß es „stützen“ müsse. Musikalisch kann man diese Aufführung nur perfekt nennen und sollte das deshalb auch tun. Und dankbar sein, wenn man sie miterleben durfte:
Benjamin Britten
BILLY BUDD
Oper in zwei Akten mit Prolog und Epilog
Inszenierung David Alden – Bühne Paul Steinberg – Kostüme Constance Hoffman – Licht Andy Cutbush – Chöre William Spaulding
Burkhard Ulrich - John Chest - Gidon Saks - Markus Brück - Albert Pesendorfer - Tobias Kehrer - Clemens Bieber - Simon Pauly - Lenus Carlson - Thomas Blondelle - Alvaro Zambrano - Marko Mimica - Seth Carico - Noel Bouley - Stephen Barchi - Matthew Newlin - Ben Wager - Hong-Kyun Oh - Heiner Boßmeyer.
Chöre und Orchester der Deutschen Oper Berlin.
Sir Donald Runnicles
Die nächsten Vorstellungen:
28. und 31 Mai,
3. und 6. Juni,
je um 19.30 Uhr.
>>>> Karten.
albannikolaiherbst - Montag, 26. Mai 2014, 16:36- Rubrik: Oper
[Bilder >>>> dort.
Foto im Saal: ANH/iPhone.]  Welch ein sängerischer Parforceritt Svetlana Sozdatelevas!
Fast ununterbrochen während der über zwei Stunden währenden Aufführung hat ihre Stimme, und mit welchen Anforderungen!, präsent zu sein. Alleine das wäre einen Jubel wert, auch wenn einen die absolute Zwangsläufigkeit des Geschehens solchen Jubel in den Rachen gleich wieder zurückstopft: Der Teufel selbst scheint Prokofievs Feuriger Engel zu sein – wär er denn nicht, was die Inszenierung durchaus denken läßt, nur das Innenbild eines nie erfüllten, furchtbar christlich in Sünde umgemünzten Begehrens. So daß es pervertieren muß. Wo keine Freiheit der Sinne, zumal der sexuellen, wird schließlich selbst der Feuertod in einen Befreiungsakt umverfälscht. Das ist das Grauenhafte an dieser Oper, wie unbedingt sie das zeigt, mit welcher unerbittlich voranstampfenden Logik.
Als kleines Mädchen hatte Renata eine Engelserscheinung, mit der sie vertraut umging, und sie mit ihr, bis die Pubertät kam und Innigkeit auch Körperliches wollte. Sei es denn nicht ganz, fragt Renata, ein organischer Ablauf der Dinge, daß Nähe sich vollenden wolle? Woraufhin sie weggestoßen wird, alleingelassen von dem, wer immer das gewesen, Engel.
Seither sucht sie ihn, fand ihn in einer Projektion, die ihr indes ihr Begehren abermals zur Sünde machte. Der Regisseur, Benedict Andrews interpretiert diesen Mann, Graf Heinrich, in der Maske eines Priesters, was von Anfang an Renatas Vergeblichkeit mehr als nur illustriert; später tritt dieser Graf denn auch als Inquisitor auf, der für die unterdessen ins Kloster gegangene Frau den Scheiterhaufen fordert, weil ihr tobendes Verlangen längst auf die Mitschwestern übergesprungen ist, eine folie à deux à mille, für die es in der Operngeschichte eine gewaltige Entsprechung gibt: Krzysztof Pendereckis nach Aubins Aufzeichnungen komponierten „Teufel von Loudon“. Anders als dort im Beichtiger Grandier, findet sich bei Prokofiev für den sexuellen Massenwahn aber nicht wirklich ein Objekt des Begehrens, sondern dieses bleibt eines der reinen Vorstellung. Der theologische Skandal daran ist, daß dasselbe von dem gesagt werden kann, der den Kreuzestod starb: Somit balanzieren sich Gut und Böse gleichberechtigt aus, weshalb es inszenatorisch hoch sinnvoll ist, den geforderten Feuertod mit einem selbstgewählten zur Deckung zu bringen. Gleichsam wird er, der doch bestrafen soll (und, „natürlich“, reinigen), zum Triumph. Das genau entspricht aber der Doktrin der Inquisition. Diesen Zusammenhang zu erfassen, ist allerdings dem Publikum überlassen.
Das hat sich vielleicht ein wenig zu viel von dem aufschießenden Feuerzauber zu Ende der Inszenierung vereinnahmen lassen. Betroffenheit, Schockiertheit sogar, wäre angemessen gewesen und abermals, sich um die Dynamik scheinmoralischer Verklemmtheit, ja Niederdrückung Gedanken zu machen, besonders in einer Zeit – sie ist unsere Gegenwart – , in der „Correctness“ zur ultimativen gesellschaftlichen Handelsmaxime geworden ist.
Es ist, in der Interpretation dieses Musiktheaters an der Komischen Oper, das besonders Auffällige, wie Renatas vorgeblicher Wahn auf nahezu alle überspringt, die ihr nahekommen. Das geht bis zum – auch kompositorisch radikal gestalteten – Klopfen der Geister, bzw. des Verführers, den auch der nächste um Renata Werbende vernimmt und woran er so sehr, ebenfalls vor Verlangen, ertaubt, daß er selbst vorm Morden nicht zurückschreckt, wenn er die Frau, die ihn aber gar nicht will, damit gewinnen kann. Wie pervers die Dynamik ist, wird spätestens dann klar, wenn sie ihn, Ruprecht, wieder von sich stößt, nachdem er sich um ihretwillen auf ein Duell eingelassen hat, dabei schwer verwundet und von ihr, die „reuig“ zu sein schien, gepflegt wird. Denn kaum, daß er wieder auf den Beinen ist, verläßt sie ihn – abermals wegen des Feurigen Engels, den sie seit früher Jugend sucht. Und zieht sich in das Kloster zurück, in dessen bescheidenem ergebenen Leben sie Heilung erhofft. Statt dessen übernehmen die Schwestern ihren Wahn, spiegeln ihn auf sie zurück und rufen die Frau als ihre Heilige an. So wird der Inquisitor geholt – das ist für die Ordnung der Kirche ebenso unerbittlich logisch wie für die Verklemmung ihr, wo immer es geht, perverser Ausbruch.
Prokofiev hat das treibende Sehnsuchtsmoment in drängende Streicherklangflächen gelegt, die immer wieder voll Heilsversprechen sind, aber in der Ungefährheit ihrer Tonalität auch verwirrend, und unstet, sekundiert im zweiten Akt von den Klopfschlägen, die Schläge wirklich sind, fatale, zudem ein „Spiel“, ein verzerrtes, mit der christlichen Dreizahl. Die Oper legt es nahe, daß tatsächlich der Teufel es treibt. Die Inszenierung hingegen, modern, erhebt Einspruch, denn er, der Teufel, legt seine Maske ab, bei Tisch. Das gehört zu den großen Momenten dieser Regie, eben n i c h t ein Schauermärchen zu zeigen noch gar eine leibhaftige Existenz des Bösen zu konzedieren, sondern immer eine Lesart offenzuhalten, die auf persönliche Traumata rückgespiegelt ist. Andererseits läßt sich der Regisseur im Programmheft vernehmen, es komme ihm s c h o n darauf an, ein Heiliges zu zeigen. Darüber, sicher, kann man streiten; es überwächst die Inszenierung aber eben nicht; sie funktioniert auch ohne dieses – vor allem auch deshalb, weil durch den Auftritt vieler wirklicher, zum Teil recht kleiner Mädchen – und pubertierender, bis sie Frau sind – die psychopathologische Lesart, die gesunderseits einfach nur eine der Adoleszenz ist, an das Heilige nicht verraten wird. Auch diese Mädchen rollen sich schon.
Gestalterisch arbeiten Andrews und sein Bühnenbildner Johannes Schütz in sozusagen abstrakter Anlehnung an Bilder Edvard Hoppers; auch hier aber wieder herrscht eine dem US-Amerikaner noch ganz fremde Modulität vor: Das Ansehen wird in, ecco!, Module zerlegt, aus denen sowohl Trennwände und Gänge als auch Klosterzellen werden können; anders als bei jenem wird auch sakral inszeniert, etwa vermittels auf der Drehbühne rotierender Kerzen usw., die eben immer auch auf ein religiöses Moment verweisen, inkl. auf den Teufel als Antichrist. Damit wird die Interpretation und vor allem die Deutungs-Besetzung der Geschehen gleichsam überhöht – nicht, weil dies wirklich notwendig wäre, sondern weil das die Unerfülltheit - zumindest irgendwie - aushalten läßt, ja ihr einen Sinn und damit Wert verleiht. Exakt das ist die Dynamik der hier herrschenden Perversion, einer tatsächlich religiösen, in der Renata schließlich verbrennt, verbrennen muß. Was passiert, ist von allem Anfang an aussichtslos: Genau darüber lacht der Teufel. Der bei Prokofiev, deutlich zitiert, als Mefistofeles auftritt, begleitet von einem gänzlich desillusionierten ebenfalls zitierten Faust, denen beiden sich Renatas verstoßener Niemals-Geliebter Ruprecht endlich anschließt. Evez Abdulla spielt und singt ihn, an seiner Liebe schließlich zerbrochen, mit der ganzen sehnsuchtsvollen Männlichkeit eines verdischen Troubadours; auch er hat einen sängerischen Parforce-Ritt sondergleichen: Hetzjagd fürwahr.
So hetzt die Musik denn voran, atemholend ganz selten in lyrischen Partien, die zudem schnell überwölbt werden von den Schlägen des Schlagwerks und den, wie bei Tschaikowski, „fatalen“ Themen; sozusagen ist gar keine Zeit, sich zu besinnen: Man strömt mit Gewalt dem gewaltsamen Ende zu. Das ist beeindruckend, hat aber den Nachteil, daß die musikalischen Themen auch uns, den Hörer:inne:n, keine Minute Besinnung lassen; mit jedem neuen Akt weniger; der erste ließ uns noch Zeit für Renatas große, nie freilich abgeschlossene Sehnsuchtsarien.
Auch über uns also, das Publikum, rast das und wölbt sich hinweg. Es braucht gewiß, um dieses Stück wirklich zu erfassen, einiges wiederholte Hören. Dafür, wenn man sich dem Unheil aussetzen will, ist mehrmaliges Hineingehen unbedingt erfordert – oder wir besorgen uns eine Vergleichsaufnahme, machen uns vertraut und sehen die Inszenierung dann noch einmal an. Die Frage aber ist, ob sich dann das aus der Kunst Erhoffte: Reinigung, Erlösung, eigene Befreiung angesichts des Elends anderer, wirklich auch einstellt, oder ob wir nicht, weil eben selbst überwölbt, nur sprachlos ausgesetzt bleiben. Ich kann Ihnen da keine Gewißheit geben, werde es selbst erst ausprobieren müssen: indem ich tiefer in dieses Stück eindringe, als bei einem erstmaligen Erleben möglich ist. Was schließlich wird „hängen“ bleiben, dauerhaft, außer den vielen heftig stürzenden Linien in Geigen und Violinen, so daß auch diese Oper eine Repräsentanz in unserm Innern bezieht? Darum, genau darum, geht es doch immer in Kunst und nicht um einen gelungenen Abend allein. Ein solcher freilich war er ohne Zweifel. Davon sprach deutlich der Jubel nachher. *******Henrik Nánási dirigiert sich mit stravinskischem Frühlingsopfer-Furor durch die Partitur, läßt das Orchester auftrumpfen, sich hochbeugen, stürzen; es gibt selbst an den gefährlichen, weil sentimental retardierenden Stellen kein Verschleppen. Und wenn Renata voll Begehren träumt, gibt er ihr allen Schmelz, den das slavische Melos kennt, läßt er sie ihm Klanggestalt verleihen, ohne ihn mäßigend, sagen wir: „vornehm“, zu kultivieren. Genau das macht diesen Umbruch von Begehren in Grausamkeit tonbildlich offenbar: Wer Unrecht erfuhr, wird Unrecht begehen. - Daß Mefistofeles eben daran sein Vergnügen hat, führt mit eitelstem Lachen, nämlich ungoethesch antiharmonisch, Dmitry Golovin mit offenbarem eigenen Vergnügen vor. Es sind diese Momente, die einem hier immer wieder den Atem nehmen, viel weniger, als der doch recht bieder, geradezu calvinistisch anmutende Inquisitor Jens Larsens: zu deutlich seine, des Inquisitors, Angst vor dem Trieb, als daß man ihm das Machtkalkül eines Savonarolas abnehmen würde. In der Komischen Oper läßt ein Kleinbürger meucheln, nicht ein Macchiavellist, der sich an den rolligen Nonnen noch bedienen würde, die er der Staats- und Kirchenraison halber auf den Scheiterhaufen bringt. Bereits als Graf Heinrich machte er eine allein nur verklemmte Figur, der gegenüber Svetlana Sozdatelavas Renata wie eine Heilige tatsächlich wirkt und nicht wie das, was sie ist: eine schon als Mädchen tief verwundete und ob der Verwundung wieder und wieder, von ihrer Sehnsucht, gestoßene, auf ewig verlassene Frau. Die eben deshalb hilloses Mädchen für immer geblieben. *******
Sergej S. Prokofjew
DER FEURIGE ENGEL
Oper in 5 Akten (1955)
Libretto von Sergej Prokofjew, nach dem Roman Огненный ангел (1908)
von Waleri Jakowlewitsch Brjussow
Inszenierung Benedict Andrews – Bühnenbild - Johannes Schütz
Kostüme Victoria Behr – Dramaturgie Pavel B. Jiracek – Chöre David Cavelius
Lichtdesign Diego Leetz
Svetlana Sozdateleva - Evez Abdulla - Christiane Oertel - Dmitry Golovnin
Alexey Antonov - Jens Larsen - Xenia Vyaznikova - Christoph Späth
Máté Gál - Hans-Peter Scheidegger - Bernhard Hansky
Chorsolisten, Komparsen und Zusatzchor der Komischen Oper Berlin.
Orchester der Komischen Oper Berlin.
Henrik Nánási
Die nächsten Aufführungen:
Do 23.1.2014
So 2. und So 16.2.2014
So 2.3.2014
Do 10.7.2014
>>>> Karten
albannikolaiherbst - Dienstag, 21. Januar 2014, 17:48- Rubrik: Oper
 Erinnern ist nicht notwendigerweise eine Funktion des Schuldbewußtseins, sondern kann auch befreiend und dann heilend sein und uns, so die Botschaft, in eine Vergangenheit derart körperlich zurückversetzen, daß wir sie sowohl für neue Gegenwart halten möchten wie halten: ja, sie entfaltet im Zusammenspiel von erhalten gebliebenem Wissen, teils auch noch einstigen, sich unversehens aktualisierenden Fähigkeiten und der, besonders wenn vereint, menschlichen Imaginationskraft einen geradezu ungeheuren Zauber. Kommt dies alles zueinander, dann fällt es ihm leicht, sich durch welchen Mummenschanz auch immer auf auf das Publikum zu übertragen. >>>> Christoph Loys Falstaff ist ein wirkliches Meisterstück dieses Vorgang.
So tobte denn der große Saal der Deutschen Oper Berlin vor Freude, nachdem das Stück zuende war, dessen einzigen Wehmutstropfen der Umstand in die Begeisterung fallen ließ, daß man sie für den Sänger und Darsteller des Falstaffs nicht in gleichem Maße zeigen konnte wie für alle anderen. Es fehlte für Noul Bouley deutlich an Bravi. Das ist schon deshalb ein bißchen bitter, weil der junge Sänger, neuer Stipendiat des Hauses, kurzfristig für den erkrankten Markus Brück eingesprungen ist, aber auch, weil er gestalterisch einen ganz vorzüglichen Falstaff abgibt. Doch in der Tat fiel seine im übrigen ausgesprochen schöne, durchweg lyrische Stimme gegen die Präsenz der anderen spürbar ab. Normalerweise, wenn der anarchische Fettsack nachher vor den Vorhang tritt, brüllt der Saal vor Wollust. Doch die Ovationen gestern galten anderen. Etwa war ganz zweifellos der sangliche Star des Abends die junge Elena Tsallagova, die das Nanettchen sang, das in Loys Inszenierung zugleich die liebevolle Betreuerin der alten Leute ist, von denen das Stück sich selbst gegeben wird – wir sind da nur Besucher, nämlich der kurz „Casa Verdi“ genannten >>>> Casa di Riposo per Musicisti, die der alte Komponist und seine Gattin geplant haben und die in Mailand 1901, sozusagen testamentarisch, tatsächlich auch gegründet wurde und bis heute als letztes Heim altgewordener Musiker:innen besteht. Der Schweizer Filmemacher Daniel Schmid hat einen innigen Dokumentarfilm über das Haus gedreht, den, wer ihn jemals sah, niemals vergessen wird: >>>> Il bacio di Tosca.
So auch nicht Christoph Loy. Er muß deshalb Vistur Kairishs mit einer ganz ähnlichen Idee umgehende >>>> Inszenierung von Brittens Sommernachtstraum, v o r diesem Falstaff in der Komischen Oper Berlin, gar nicht gesehen haben, zumal bei ihm das leise Erschauern nicht da ist, das einen dort schließlich überkommt, sowieso fehlt das Überraschungsmoment, ja die Bewegung, nicht die Idee, ist anders: Loy geht es nicht um einen verklärenden Regreß, sondern ganz im Gegenteil um, scheint mir, Wieder-Selbstermächtigung. Denn kommen sie zusammen, die alten Leute – real, in der Casa Verdi – , dann wird nicht selten musiziert, und es wird von den alten Zeiten geschwärmt und gemeinsam geträumt.
Eben damit setzt Loys Inszenierung ein, und zwar vermittels eines selbstverständlich in Schwarzweiß nachgedrehten „Stumm“films, Musik aus dem Off, die Stimmen auf historisches Wachsplattenrauschen heruntergefahren. Eine Art Falstaff stopft Spaghetti in sich rein, derweil Noul-Bouley-als-alter-Mann mehr recht als schlecht noch einmal dessen Rolle gibt, und als sich die Leinwand hebt, also der Vorhang, sehen wir genau diese Szene auf der Bühne. Womit der Rahmen definiert wäre: Alle Protagonisten der Oper sitzen, alles alte Leute, im Salon und hören zu. Fortan werden sie bei jedem Szenewechsel, das ist rundweg genial, wieder alte Leute sein, die, sowie sie jeweils ihre Partien gestalten, die Maske ablegen, Kleidung, Perücken, Gehstöcke. um wieder schöne junge Menschen oder solche auf der Höhe ihres Lebens zu sein.
Das wird ganz offen gezeigt, diese improvisierte Verwandlung: uralte Tradition des allereinfachsten Theaters, und doch oder gerade deshalb fallen wir, das Publikum, m i t in die Illusion, die ein wirklich Utopisches, ein zutiefst Humanes in sich birgt: nämlich daß doch alledie noch immer eigentlich die sind, die sie einmal waren – ganz so, wie auch jeder Erwachsene weiterhin das Kind ist, das er einmal war. Er mag es verbergen, wie er will; spätestens beim Einschlafen steigt es, mit allen Kinderwünschen, wieder aus ihm hervor, sei man nun Bundeskanzlerin oder Straßenbahnschaffner, Lehrer oder Richterin, Friseurin oder Architekt.  Loy baut aber noch eine inverse Kippe ein: nämlich wenn sich der Falstaff als Falstaff immer wieder mal seinen Monsterbauch abschnallt, aber auch wieder anschnallt, so, als wäre der bereits im Stück nur Verkleidung gewesen. „In Wirklichkeit, da bin ich mager!“ ruft >>>> im Wolpertinger der unsäglich fette Dr. Lipom. Da kommt man dann ins Denken, weil der so sichere, feste Inszenierungsrahmen sich seinerseits als trügerisch erweist.
Im übrigen wird das Stück wie ein nicht selten anrührendes, durchaus aber auch derbes Volksstück inszeniert, mit falschen Türen, durch die eingetreten und der Raum verlassen wird, und einem „Themse“kanal, den statt Wasser nur noch Müll füllt. Dahinein, bekanntlich, wird der Falstaff aus dem Wäschekorb gekippt. Dieser bis zum Austrocknen geschundene Kanal wird unversehens zum überhaupt stärksten Bild der Inszenierung; es ist Johannes Leiacker zu verdanken. Da steht nämlich, Beginn Akt III, Falstaffs Bett aus dem Altersheim auf dem ökologisch vernichteten Kanalboden, vielleicht zwei Meter vom Müll umgebene Enge, und hinter ihr erhebt sich die cleane hochbürgerliche Fassade der Repräsentanz, mit fest verschlossener Tür. Man kann da als Armer nur durch die spiegelnden Scheiben sehen, auf den Luxus, der sich vor einem glänzend verschließt, lauter Zwanzigerjahrefrisuren dahinter, und als sich der nasse Falstaff aufrappelt und hineinwill, macht ihm keiner auf. Genau so leben bei uns die meisten alten Leute: ausgesperrt. Vergeblich ihr Klopfen, vergeblich Falstaffs, das zu einem ganz verzweifelten Pochen wird. Großartig. Beklemmend, ja schockierend, weil unversehens in das Volksspiel die schärfste Kritik an den sozialen Verhältnissen drängt, durch die man sich, wenn man denn gut leben will, tatsächlich nur so schummeln und lavieren kann, wie es der Falstaff bislang tat. Ob die fast durchweg reichen, zumindest wohlbegüterten Menschen, die gestern abend diese Inszenierung sahen, das gemerkt haben werden, sei dahingestellt; sie haben, als sie jubelten, sicher auch nicht wirklich das „Tutti gabbati!“ beklatscht, das diese Oper beschließt und sie und mich auch selbst zweifellos mitmeint: 
*******Es gibt mehrere solcher gleichsam indirekten Botschaften in der Inszenierung, etwa wenn die schöne Meg sich als durchaus nicht so puritanisch-bürgerlich zeigt, wie das von einer Frau dieses Standes zu ihrer Zeit erwartet wurde; anders als Alice, die zuhause zwar deutlich die Stiefel anhat, nicht nur die Gamaschen, aber zugleich den Schein der guten Ehe wahrt, läßt sie im Dritten Akt ziemlich locker ihre erotischen Reize wirken und spielt sie nicht nur einem Einzigen gegenüber aus, sondern nimmt recht deutlich mit, was an männlicher, sagen wir, Wohlfahrt sich erheimsen läßt: eine auf meinen überraschten Hinblick Kokotte, die im Keller die Leichen ihrer Liebhaber stapelt, also deren von ihr vergessenen, immer schnell mit neuen „Lovern“ überschriebenen Überreste. So daß Falstaff an seiner wirklich großen Stelle, kurz vor der großen Ensemble-Fuge, schon recht hat, wenn er sich höchst selbstbewußt das Salz in der Lebenssuppe der anderen nennt: Gedanke eines eigentlich sehr süditalienischen Gauners, der die Obrigkeiten unterläuft, wo immer das nur geht. Ohne einen Falstaff würde jeder Widerstand zum Zentralkomitee.  Und herrlich, wie Runnicles das alles aufheizt. Daß er an die Deutsche Oper kam, erweist sich für ihr Orchester als eine ähnliche Glücksfügung, wie es Barenboim, der Interimsnachbar - wirklich nur paar Meter nebenan - für die Staatskapelle Berlin gewesen ist und bleibt. Er, Runnicles, läßt Klangmomente ausmodellieren, die ich im Falstaff noch nirgendwo anders gehört habe, etwa die Insistenz des beinahe warnenden Pfeifens bei der Geistererzählung. Forsch fast durchweg die Tempi, frech, wie es dem Stück zukommt, manchmal wie bei Carlos Kleiber 1965, zugleich ohne jede Scheu vor der italienischen Sentimentalität, ihrem Unvoreingenommenen gegen sich selbst; Selbstbewußtsein ist ja überhaupt ein Thema des Abends: sich nicht abfinden, sondern alle Fantasie, über die wir verfügen, sich aufbäumen und uns - zumindest doch in i h r - (wieder) reichwerden lassen, prall, glühend – beneidenswert der Künstler, der sein Lebenswerk mit etwas solchem gekrönt hat, und wie befreiend, daß am Ende n i c h t ein „Alles ist eitel“ und schon gar nicht Depression steht, sondern – ob moralisch oder nicht – die pure Lebenslust! Was denn sonst wär es wert, es unsern Kindern zu hinterlassen. Denn auch für sie wurden diese Zeilen geschrieben: Tutto nel mondo è burla. Wobei das letzte Wort – anders, als der Obertitel-Übersetzer meinte – n i c h t ein beliebiges „Spiel“ meint, sondern einen rüden Spaß: Sie dürfen gern auch „Rüdenspaß“ dazu sagen und jenen, den eine jede Füchsin hat: 
*******
Giuseppe Verdi
F A L S T A F F
Commedia lirica in tre atti.
Libretto von Arrigo Boito nach William Shakespeares „The Merry Wifes of Windsor“
und „Henry IV“.
Inszenierung Christof Loy – Bühne Johannes Leiacker – Kostüme Ursula Renzenbrink
Chöre William Spaulding – Choreographie Thomas Wilhelm – Licht Bernd Purkrabek
Dramaturgie Dorothea Hartmann
Noel Bouley - Michael Nagy - Joel Prieto - Thomas Blondelle - Gideon Poppe
Marko Mimica - Barbara Haveman - Elena Tsallagova - Jana Kurucová
Dana Beth Miller - Julian Bleymehl - Rudolf Giglberger - Raffael Hinterhäuser
Guido Kleineidam - Spyridon Makropoulos - Douglas V. Brown
Orchester und Chor der Deutschen Oper Berlin
Musikalische Leitung: Sir Donald Runnicles
Die nächsten Vorstellungen:
22., und 29 November 2013
5., 7. und 30. Dezember 2013
4. Januar 2014
Jeweils um 19.30 Uhr
>>>> Kartenalbannikolaiherbst - Montag, 18. November 2013, 18:12- Rubrik: Oper
Vielleicht gibt es Inszenierungen, deren Premieren ebenso durchfallen wie bei ihrer Uraufführung die Opern manchmal selbst, aber später, bisweilen um einiges später, wird ihre Größe dann verstanden, und das Stück nimmt den Rang ein, der ihm gebührt: falls das so ist, wäre >>>> die gestern vorgeführte Britten-Arbeit Viestur Kairishs ein ziemlich guter Kandidat. Selbst meine Hände hatten, als sich der Vorhang senkte, Schwierigkeiten mit ihrem Enthusiasmus. So bekamen die Künstler eine Ungerechtigkeit zu spüren, außer den kleinen Sänger:inne:n des Kinderchors beinahe alle: ein ungerechtes Wogen der Verhaltenheit bestimmte den Applaus – nämlich eine solche, die die Botschaft für den Boten nimmt. Es ist aber nicht Kairishs Schuld, daß wir alle altern und gebrechlich werden. Das war's auch nicht, was man ihm übelnahm, wohl aber, daß er's zeigte. Benjamin Brittens auf Shakespeare komponiertes, 1960 uraufgeführtes „A Midsummer Night's Dream“ ist eines der, für mich, innigsten Werke der Opernliteratur. Und es wird wie mir auch anderen ergangen sein, daß wir bereits den ganzen Tag über in unserm Vorglück badeten; ich hörte in den vergangenen Tagen sogar meine sämtlichen Aufnahmen dieses Wunderstückes durch, bevor ich mich dann gestern zur Premiere in die Komische Oper Berlin aufmachte, dabei noch in dem Irrtum befangen, Koskie selbst, seit einem Jahr dort der Hausherr, habe inszeniert. Naheliegenderweise erwartete ich eine ähnlich kulinarische Aufführung, wie es vor genau einem Jahr >>>> die große Monteverdi-Trilogie gewesen war, erwartete Überschüttung mit so phantastischen wie humanistischen Bildern, erwartete blitzenden Witz und eine, vor allem, Titania, in die man sich auf Anhieb würde verlieben müssen: Genau damit lockte die pfauenfederne Ankündigung:
Nein, ich war ganz sicher nicht der einzige, dessen Erwartung einfach nicht erfüllt werden konnte, auf eine ganz andere Weise aber eben d o c h erfüllt wurde, aber eben so, wie es sich nicht erwarten ließ, und vor allem anderswo. Genau deshalb war nachher der Applaus so fast schmerzhaft verhalten, Bravi bekam einzig der Kinderchor, ja nach der Pause schon hatte sich der Saal spürbar geleert und mit dem Kritiker neben mir, zwischen ihm und mir, wäre es später fast zu einer Keilerei gekommen: derart hat des Letten Viestur Kairishs Inszenierung alles polarisierende Zeug. Uns eben nicht in warmer Eselsmilch, in die ein würziger, zaubrischer Honig des Wohlseins gerührt ist, baden zu lassen, sondern uns mit einem Traum zu konfrontieren, in dessen Urgrund wir eines Tages alle, alle versinken werden, das reservierte uns.
Es wird Verrisse hageln. Wir haben doch aber Befreiung erwartet, Glück, Erlösung.
Die Kritiken werden ungerecht sein. Ungerecht und, weil wir ja doch nicht ausweichen können, dumm.
Vielmehr.
Diese Inszenierung hat entschiedene Größe. Aber es ist ihr Problem, daß wir das erst in den Erwachensszenen des Dritten Aktes begreifen können, sinnlich begreifen, heißt das, weil wir es da erst sehen. Und da dann ist es ein Schock, der einen den Mund offenstehen läßt. Nein, ich möchte den „Clou“ nicht verraten, stattdessen Ihnen ans Herz legen, Vertrauen in diese Inszenierung zu haben, Kairsih einfach entgegenzukommen und es auszuhalten, daß man vieles von dem, was gezeigt wird, nicht vor dem Dritten Akt erfaßt. Oder man muß ziemlich denken, will man Kairishs Konzept schon vorher auf die Spur kommen. Das ist ein schmerzhafter Prozeß, wenn man doch darauf eingestimmt war, sich den Abend über behaglich zu fühlen. Es ist, schreibt Nietzsche, kühl da oben auf den Bergen des Geistes; wir aber, gestern abend, hatten unsere festen Jacken vergessen. So war in der Pause immer wieder zu hören: „Ich verstehe diese Bilderwelt nicht.“ - Ja, was sollte man anfangen mit Elben, die alle zwar kinderklein, aber von greisem Antlitz sind und ungelenk, von ihrem Alter eben, in ihrer Bewegung?
Selbst der Teint der doch als herrlich erwarteten Titania war von Leben durchfurcht, und deshalb auch von Leid; keine Feenkönigin, sondern Frau im Klimakterium. Einzig Oberon ließ sich der Zahn der Zeit nicht sofort ansehen, doch schlichtweg deshalb, weil sein silbergraues Haar zu gut gesignt auf das silberblaue Schimmern seines Seidenanzugs paßte und weil wir ungerechterweise bei Männern Falten sexy finden. Als er am Ende der Oper mit wiederlohem schwarzen Haar die Hochzeitsfeier okkupiert und neben ihm Titania wieder leuchtet, ist das ganze Ungeheure klar – und eigentlich auch vorher schon, aber ich will es eben nicht verraten. Es wäre, wie die Auflösung eines Thrillers zu verpetzen. Genau da aber eben liegt das Problem der Auführung: Es ist eines der Rezeptionspsychologie. Ich bin mir sicher, daß jeder zweite Besuch zu Erfüllungserlebnissen führen wird, von denen der erste erst gegen Ende etwas ahnen läßt, ganz so, wie wir manche Opern erst dann in uns aufgenommen haben, haben wir sie viele viele Male gesehen. Dann erst atmet man dem nun unfaßbar gewordenen >>>> „Jaja“ wie atemlos entgegen. Oper ist Wiederholungskunst: Kairish hat das, mit oder ohne Absicht, sich in seine Arbeit hineinspiegeln lassen.
Sein Sommernachtstraum ist ein vergeblicher. Er schreitet unaufhaltsam dem Tod zu, aber nicht einem plötzlichen, sondern dem langen, der sich, bevor er dann kommt, mit dem Bechterew quält, mit Alzheimer vielleicht, jedenfalls mit dem Versagen unserer Körper. Genau darum stellt Kairish ins Zentrum seiner Inszenierung diese unsere Körper hinein, sei es den des mit einem bizarr langen Geschlechtsteil ausgestatteten Esels, zu dem Zettel wurde – aber eben als Esel und nur als Esel in allertiefstem Glück -, sei es der der nach eben diesem Geschlechtsteil gierenden und dabei wirklich befreiten menopausen Titania – selten habe ich das Begehren, sich etwas einzuverleiben jenseits von Pornografie so evident dargestellt erlebt wie hier: Besessenheit von und Gier nach dem Schwanz – befreit, weil die hemmenden Konventionen abgefallen sind; immerhin, sie ist eine Königin... (wir könnten, fürs Publikum, auch „eine Bürgerliche“ sagen) - - sei es der beiden zunehmend, indem sich ihre Begehren gedreht und furchtbar verwickelt haben, zu Pflanzen mutierenden höfischen Liebespaare; eine großartige Bildgebung hier, wie aus ihnen Zweige wachsen, die sich begrünen, immer mal wieder abgerissen werden, aber nachwachsen, bis sie von vegetativen (!) Korsetts geradezu geschnürt sind – eine wahre ovidsche Metamorphose:  Dazu diese Bühnenbilder: immer ein Ungefähres, sanftes Nebeln der Dämmerungen, ob des abends, ob am Morgen bei dem Erwachen, in das die Jagdhörner aus furchtbar weiter Ferne tönen: aus der Welt. Licht, das von oben herab wie Sprühwasser fällt, dabei fließend selber. Doch dazu gleich die Aggression, die jedes Liebesaktes, soweit er nicht träumt, Anteil eben i s t; die Liebenden streiten sich noch, wenn längst das Happyend erreicht ist: abgerissen werden: eben. Auch darin ist Kairish nicht bereit, sich aufs Wohlfühlen einzulassen, nicht auf all die Teddybären, mit denen er anfangs die Bühne bekuschelt. Als sich Hermia und Lysander ihre Liebe zuschwören, reißen sie ihre Teddies auseinander, die Arme ab, die Beine ab, den Kopf ab; sie zerpflücken sie geradezu, was eine wirklich genial in die Baumverwandlung führende Bildidee ist, und nachdem es zur Vereinigung Titanias mit dem Esel Zettel gekommen ist, einer „wirklichen“ erotisch-libidinösen Vereinigung, werden die zuvor auf einen Haufen geworfenen Stofftierbären notwendigerweise beerdigt: werden von den uralten Elbenkindern in ein Grab geworfen, und wie in einem Kondukt gehen sie ab, diese kinderalten Altenkinder, gefolgt von dem das blutende Herz haltenden Oberon - das auch eine der grandiosen Ideen von Karisih und seiner Ausstatterin Ieva Jurjāna ist (das Arschloch von Kritiker rechts neben mir schmähte sie, indem er einem hinter uns Sitzenden „diese Ausstattungstante!“ zufauchte), - nämlich aus dem Liebeskraut“ (Shakespeare: „love-in- idleness“: das von Cupidos Pfeil getroffene Stiefmütterchen, das mein Bruder einst, eine leicht erschreckende Erinnerung, auf das Grab unserer Großmutter pflanzen wollte) ein organisches Herz zu machen, aus dem es tropft, Blut tropft, wenn man es preßt. Mit diesem Blut, mit Herzblut also, werden die zu Verzaubernden beträufelt. Noch ganz zum Schluß der Inszenierung ist dieses Herz präsent, ein Organ, nicht etwa nur Symbol: Der Tod streckt die Hand nach ihm aus, aber Oberon nimmt es mit sich fort:  Je mehr ich jetzt also nachdenke, mich erinnere, nach lausche, desto schlüssiger wird nahezu alles, was ich sah - „nahezu“, denn eine bittre Pille ist dann d o c h zu schlucken: Es ist nachvollziehbar, zwar, wenn Kairish über Shakespeares/Brittens schnelles Hinwegfliegen darüber nicht ebenfalls einfach hinwegfliegen wollte, daß Hippolytens und Theseus', des Fürstenpaares, Hochzeit ganz offenbar einige Grausamkeit vorhergegangen oder sogar ihre Vorbedingung gewesen ist, die nun mit geradezu nachlässiger Ignoranz für erledigt erklärt wird; dennoch fragt man sich, weshalb aus den beiden Popanze gemacht werden, die sich von US-fetten Teenagerinnen in geschmacklosen Pettycoats bordüren lassen, fette Schleifen je im Haar, und von sonstigen Cretins figurgewordener männlicher Regressionssymptome. Diese Veralberung texanischstämmiger (mit zu großem Westernhut) US-Präsidenten tut weder dem Stück selbst noch der Interpretion, die diese Inszenierung vorführt, einen anderen Mehrwert bei, als daß man eben verulkt hat: Hier hat nun doch einmal das Regietheatermätzchen zugepatscht. Nun gut, kann man sagen, geschenkt. Doch nimmt genau dieser politische v o r dem im Stück all den Schranzen vorgespielten Theater-im-Theater-Ulk ihr, der Handwerker-Groteske von Pyramus und Thisbe, ihre dramaturgisch-komische Kraft, schwächt sie jedenfalls – zumal wenn Kairishs Einfälle nun wirklich zotig werden: Als Thisbe/Flaut die Ritze in der Wand küßt, die sie von Pyramus trennt, läßt Kairish sie/ihn knien und die Lippen auf den After des Handwerkers drücken, der diese Wand vorstellen soll, wonach die Verliebte zum Gaudi des Publikums ausrufen muß: „Ich hab das Loch geküßt!“ Thomas Langhoff, in der bisher hinreißendsten Inszenierung, die ich von dem Stück je sah, 1989, Oper Frankfurtmain, hatte es gelöst, indem er „die Wand“ zwei Finger vorstrecken ließ, auf die der heikle Kuß ging. Hier aber wird, wahrscheinlich unwillentlich, eine Anspielung auf Brittens sexuelle Disposition zum Befeixen offeriert; das ist nicht nur schade, sondern ärgerlich, auch dann, wenn Zettels großspuriger Klamauk, er stirbt auch klamaukig, schnell darüber hinweghilft – zumal, als die vom Fürsten erbetene Bergameske von der Quasi-Polka der Handwerker in einen Totentanz mutiert, der einiges von Achim Freyers halluzinatorischer Bebilderung, seinerzeit an der Deutschen Oper Berlin, des verdischen Requiems hat, und dazu die Elben den Festhof fluten, womit Karisihs Inszenierung ihre seit dem Erwachen zu Beginn des Dritten Akts offenbare Kraft gewaltig zurückgewinnt.
Nun aber zu einem Wichtigen, das bei Regietheaterkonzeptionen in den Kritiken fast immer zu kurz kommt, auch zu kurz kommen muß, weil sich eine eingehende Besprechung fast nur an Fachpublikum wenden kann; “normalen“ Leuten gefällt etwas oder halt nicht. Jedenfalls kommt man entweder um Vergleiche mit den musikalischen Interpretationen anderer Klangkörper nicht herum – naheliegend ist zum Beispiel >>>> die „klassische“ Einspielung von 1960, unter Britten noch selbst, ich hege sie >>>> auf Vinyl – oder aber um einen detailierten Einblick in die Partitur. Im übrigen muß es bei der Beschreibung des Höreindrucks bleiben – im Fall des Ensembles und Orchesters der Komischen Oper etwa bei den im eigenen Programmheft ein „Wabern“ genannten Streicherklängen ganz zu Anfang, die unter den Händen der Dirigentin Kristiina Poska aber ein geradezu, das heißt im Wortsinn, unheimliches Gleiten sind; ich habe das so noch niemals vorgeführt gehört. Es löst die scheinbar festen Grenzen unserer Realität völlig auf und versetzt in ein Schweben, das genau auf diese Weise zur Voraussetzung des folgenden Traumes wird, so sehr, daß nicht einmal die tölpelnden Handwerker, die im Wald ihr Stück proben wollen, es zu erden vermögen; im Gegenteil, sie selbst werden enterdet, so daß sich Puck nicht nur deshalb an Zettel rächt, ihn also in den Esel verwandelt, weil der ihm unwissentlich und schmerzhaft lange auf dem linken Fuß gestanden, sondern weil die Verwandlung Notwendigkeit im Traumraum hat: bei Jurjāna und Kairish ist er gegens Außen abgeschlossen; das Programmheft spricht vom Inneren eines Baumes (ich selbst dachte an das Innere einer Gehirnpartie). Aber es gibt Fenster, gibt Öffnungen. Mir scheinen sie nicht von ungefähr an >>>> die Nekropolen von Pantálica zu erinnern; auch dies schon Verbildlichung des hinter der Erzählung dräuenden Todes-, bzw. Themas von Altern und Sterbenmüssen und eben noch einmal, in diesem Sommernachtstraum, zurückschauen, zurückträumen dürfen, regredieren dürfen: Teddybären. Genau deshalb gelingt da die endliche Vereinigungsszene Esel/Titania auch musikalisch so sehr, wenn sich die Begehren erschöpft haben und beide Verliebte in einem Bad voller Federn, die weiße Zettel(!)chen sind, zu Klarinette und Glissandi einschlafen können. Niemanden von uns kann nun der überlange, schlackernde Eselsschwanz noch stören, die ebenfalls hinwegschlafende Titania hält ihn zu Zettels auf- und einmal lang in nun s e i n e n Schlaf seufzender Seligkeit wie einen Säugling zwischen ihren Brüsten. Und wir alle, wenn wir uns denn einlassen, sind endlich selber angekommen. Wobei wir das noch nicht wissen, weil wir die Erlösung erst für später erwarten. Eine der sowohl musikalisch wie szenisch stärksten Stellen begibt sich, wenn Puck ganz am Ende des Zweiten Aktes die beiden zerstrittenen Paare zusammen- und zum Schlafen ruft und an seinen Beinen einschlafen läßt, um dann den Zauber zu lösen, der alle Erlösung aber hinwegnehmen wird, von uns, von den vieren und von Titanias konventionsentbundener tierischer Liebe.
Das Orchester spielt Brittens eingängig nur anmutende Musik – tatsächlich ist sie hochkomplex – in großartiger Durchsichtigkeit und scheut wiederum die emotionalen Ausbrüche nicht; Britten sei einer gewesen, hat Leonard Bernstein geschrieben, der mit der Welt verfallen war. Welch eine Kraft deshalb der Vornehmheit, für die er komponierte – zugleich voll britischer Zurückhaltung: ein permanentes Understatement bei höchst leidenschaftlicher Schöpfer-, ja einer Kraft des Mitempfindens, Mitleidens (Sym/Pathos), die sich selbst oft völlig zurücknimmt – von dem autobiografisch getönten Spätwerk „Death in Venice“ vielleicht abgesehen. Dies alles muß sehr viel sinnhafter ausbalanziert werden als bei anderen Komponisten, weil es vor allem keinerlei verschmierende Füllsel in dieser Musik gibt, schon gar keine Effekte, sondern jede Nuance und eben ihre Balance bestimmt den Klangcharakter und dieser das, was erzählt wird; man kann etwa sagen, daß bei Britten die Tonfarbe nicht nur Tonfarbe, sondern Thema-selber ist, ja bisweilen setzt die Tonfarbe das komponierte Thema fort, ohne daß es thematisch noch ausgeführt würde. Kristiina Poska leitet das wundervoll sensibel, wie, als ließe sie alle ihre Musiker selber schweben. Dazu David DQ Lees schöner Oberon-Counter; seine körperliche, fernasiatische Erscheinung beinahe art-deco-arabesk.
Dazu Nicole Chevaliers, deren S t i m m e sogar lasziv wird, wenn sie einverleiben will; dazu außerdem sehr schön Günter Papendells Demetrius – überhaupt dieses Sänger:innentableau, das fast vollständig aus dem reichen Ensemble der Komischen Oper besteht. Und Jens Larsens Squenz ließ mich plötzlich begreifen, fühlen, wie sehr dieser wenn zwar nicht Schuster, sondern Zimmermann Brittens ironische Verneigung vor Hans Sachs ist – sozusagen transzendente Höhepunkte einer Aufführung, die man eigentlich erst hinterher, viel später, wirklich erfaßt. Und daß der Puck von einem Mann gespielt wird, Gundars Ābolinš, aber in kurzen Jungenhosen, macht die Inszenierung rund. Nicht einmal >>>> David Bennents seinerzeitiger Bilderbuch-Puck (unter 15 Uhr im Link), unter Langhoff, vermag sich noch darüberzublenden. Hineingehen. Aber mindestens zweimal. *******
BENJAMIN BRITTEN
Ein Sommernachtstraum
Oper in drei Akten (1960)
Libretto nach William Shakespeare von Benjamin Britten und Peter Pears.
Deutsche Übertragung nach August Wilhelm von Schlegel, eingerichtet von Ernst Roth, revidiert von Walter Felsenstein.
Inszenierung Viestur Kairish Bühnenbild & Kostüme Ieva Jurjāne
Dramaturgie Johanna Wall Kinderchor Dagmar Fiebach
Lichtdesign Diego Leetz
David DQ Lee - Nicole Chevalier - Gundars Āboliņš - Alexey Antonov -
Christiane Oertel - Tansel Akzeybek - Günter Papendell - Annelie Sophie Müller - Adela Zaharia - Stefan Sevenich - Jens Larsen - Peter Renz - Hans-Martin Nau -
Máté Gál - Bernhard Hansky.
Kinderchor und Orchester der Komischen Oper Berlin.
Kristiina Poska.
Die nächsten Vorstellungen:
So 29.9.
Fr 4.10., Do 10.10., Sa 26.10
sowie im Juli 2014: Di 8.7.
>>>> Karten.
albannikolaiherbst - Samstag, 21. September 2013, 07:10- Rubrik: Oper
[Fotos: ANH/iPhone.] 
Ein Libretto ist eigentlich, zumal in der Moderne, egal. Könnte man meinen. Denn das Regietheater bricht eh nur Steine heraus – oder um die Librettistin Christiane Neudecker zu zitieren: „Der Nachteil allerdings ist, daß der Text in bestimmten Tonlagen kaum noch verständlich ist“, weshalb sie froh sei, wenn die Zuschauer die Möglichkeit hätten, ihn nach- oder mitzulesen. Nun ist auf jeden Fall ein Mitlesen in den Räumen der Installation nicht möglich, was aber das Nachlesen anbelangt, macht mich das eher unglücklich. Denn der im Programmheft abgedruckte Text läßt mich fast dankbar dafür sein, daß er mich während >>>> der Aufführung, was er ganz sicher getan hat, nicht aus ihr hinausgetrieben hat. Man liest da nämlich sowas: Regenbögen zerrissen
im Mausoleum aufgebahrt
Blutstropfen glitzern
auf ihren (der Regenbögen!) Hälsen
Wundbrand klafft eiternd
schmeckt Schwären
geschmolzener Wolkenfetzen
mit jedem Himmelsschrei
Nicht etwa, daß dies eine alliterierende Satire auf schlechte Lyrik des Expressionismus sein soll; sie wäre freilich ihrerseits schlecht - nein, Frau Neudecker meint ernst, was sie da geschrieben hat – ernst nimmt es jedenfalls der Komponist Christian Steinhäuser und wohl auch der Regisseur Sven Sören Becker. Frau Neudecker hat darüber hinaus auch kein Problem damit, aus „Diktatoren“ (wörtlich „Detektoren-Diktaturen“) „Tick-tack, Tick-tack“ abzuleiten, was dann in die „Sprach“coda Tick-Mir, Tack-Dir“ führt und weiter: Dir-Mir Mir-Dir
Dass die
Welt verrückt
Dass die
Welt verrückt
Dass die Welt verrückt
sein magund dann, weil das beides fernliegt: Verrückung!
Verzückung!Nein. Mit dem Abdruck dieses Librettos hat sich niemand einen Gefallen getan. Aber das Libretto ist bei einem Stück, das eine Erzählung gar nicht will, ich schrieb es schon, egal. Es ist ein Steinbruch, man kann musikalisch aus allem was machen.
Denn wirklich gibt es faszinierende Momente an dieser Opern-Installation, die sich vom unteren Foyer bis zu den oberen Rangebenen erstreckt mit einem, gewissermaßen, eigenen Foyer der Installation-selbst: Dort, am Eingang zum eigentlichen Stück, wird Maurizio Kagels „Himmelmechanik“ aufgeführt – als gewissermaßen Ouvertüre zu Christian Steinhäusers Installationskomposition „Dass die Welt verrückt sein mag“. Aus der Himmelsmechanik entwickelt er denn auch einige Motive; die Zusammenstellung ist durchaus nicht beliebig, und dort, wo seine Musik Kagel quasi zitiert, ist sie auf hohem Niveau wirksam. Schon, daß das funktioniert, läßt einen staunen, und es macht Respekt. Deshalb will ich diese meine Besprechung nicht einfach nur als einen Verriß verstanden wissen, vielmehr als ein Nachdenken und einen Katalog von Fragen, die an einige mehr solcher, sagen wir, Performances zu richten sind. Hier geht es – künstlerisch – um Prinzipielles.  Die Fabel ist kurz und banal: Die Himmelsmechanik stimmt nicht mehr, alles, im materialen Sinn, hängt schief; es steht das Ende der Welt bevor. Wo bei Kagel eine fast märchenhaft-naive Naturschau inszeniert wird, besonders auch klanglich (Wind, Donner, Regen – und wie ein kleines Kind berührt, so schaute ich hoch, als auf mich ein Federrieseln von Konfetti niederschneite), wird Steinhäusers Operninstallation von Anfang an komplex.
Mit einem Nachrichtensprecher geht es los, der im Fernsehen die schlimme Nachricht kundgibt. Er tut das drei Mal insgesamt, beim dritten sind die Wörter quasi permutativ durcheinandergeraten („Herren, verehrte, meine sehr gute Dame und Abend, hier sind die Fernrichten mit dem deutschen Nachsehen“), was das umherschreitende Publikum schon mal tüchtig amüsiert:  Das Amusement ist, wie wir wissen, schon die halbe Miete. Man fühlt sich fein beentertained. Nun aber geht es in die eigentliche Installation hinab; schief angeordnete opak transparente Wände, in die man von der Treppe aus hinabsieht, fügen sich zu schmalen, programmatisch schiefen Gängen, durch die nun mehr oder minder desorientiert flaniert wird; oder man bleibt stehen und lauscht nur oder schaut sich in den kleinen Fernsehbildschirmen kritisch gemeinte Spots an. Zu denen noch nachher.
Die Sänger gehen herum, singen – Noten und Text sinnvollerweise auf tablets – aus dem Libretto gebrochene Steine, etwa tölt plötzlich laut „Stiftung Warentest!“ Elektronische Musik, deren Klangorte wechseln, ja sie können sich – das in der Tat ist faszinierend – bewegen, wird von zugespielten Kammerstreichern (einem Quartett, hatte ich den Eindruck) teils unterlaufen, teils übernehmen sie die klangliche Führung, sowie musizieren außerhalb der Installation, aber durch eine Glasscheibe sichtbar, Perkussionisten auf u.a. Marimba und Xylophon. Klanglich dabei besonders schön, wenn die Tafeln mit dem Geigenbogen gestrichen werden. Der perkussive Ton insgesamt wird aber nicht direkt gehört, sondern in die elektronische Zuspielung eingespeist. Als „reales“ Instrument zu hören und zu sehen ist allein das Englischhorn, dessen Tonführung-allein einen Besuch dieser Performance lohnt. Ein inniges Kompliment, also, an Chloé Payot:  Wir waten durch Licht – was aber auch nicht wirklich neu ist; nahezu jede einigermaßen psyche-,sagen wir,-delische Performance, sei es der populären Musik, sei es des Tanztheaters hat in den letzten Jahren ähnlich gearbeitet, und was die Elektronik anbelangt, so war Pierre Henry – in den Fünfzigern! - ästhetisch um Lichtjahre weiter. Eben deshalb machte das futuristische Interieur dieser Installation auf mich einen seltsam regressiven Eindruck, obwohl es andererseits wirklich wunderbar ist, was die Bühnengestalter der >>>> phase7 aus dem Foyer der Deutschen Oper gemacht haben:  Das regressive Moment wird besonders von den Kammermusikstreichern getragen, die Harmoniefolgen spielen, für die ein Freund, der mitwar, den passenden Begriff sofort auf der Zunge hatte: Arvo-Pärt-Kitsch. Das erste große Problem – nach dem des Librettos – ist, daß dieser Kitsch sich über die gesamte Inszenierung stülpt, weil alleine er die Emotionen des Publikums affiziert, das sich auf diese Weise richtig wohlfühlen kann, wiewohl die Erzählung selbst eine des Untergangs sein will. Das zweite große Problem sind die Videos, die ich aufgrund der sehr kleinen Bildschirme „Video chens“ nennen möchte, videocelli, und die die ohnedies, etwa durch die kalauerhafte Sprachbehandlung, bestehende Tendenz zur Verniedlichung noch verstärken. Auch das kommt freilich dem Wohlsein des Publikums entgegen, das nicht wirklich fürchten muß, sondern sich im vorgeführten angeblichen Unheil wohlig ergehen kann. Besonders bitter ist das nicht dort, wo im Bildschirm hübsche Frauen im Bikini Maschinengewehre vorführen, sondern wo, ganz in der hinteren Ecke, Millionen Küken auf Fließbändern der >>>> Häckselmaschine zugetragen werden, für sich genommen ein ganz furchtbares Filmbild, hier eine fast putzige Installationsillustration.
Nachdem in der Erzählung klarwird, es sei die Schieflage der Himmelsmechanik nur noch mit äußersten technischen Mitteln – und allenfalls! – wieder zu richten, wird das Publikum – bei Frau Neudecker lesen wir dazu tatsächlich die Regieanweisung „Wappnung des Volks“! – nunmehr aufgefordert, sich unverzüglich ins „Innere der Maschine“ zu begeben; bevor dieses Volk das auch tut, bekommt ein jeder einen weißen Kittel, so daß man irritiert sich fragt, ob wir vielleicht fortan als medizinisches Hilfspersonal mit Hand anlegen müßten – auch hier bleiben wir immer auf der „richtigen“ Seite, nicht etwa der Opfer, nein, der Macht. Und hören dann den mehr oder minder unverständlichen, weil in verstümmelten Wissenschaftsworten vorgetragenen Expertisen der Spezialisten zu. Dazu lasert's über uns in mehreren Strahlen rot, immer wieder wechselt die Psychedelik, die Spezialisten werden in transparente Zylinder gehüllt, die jeder erst über ihnen hingen und sich dann auf sie herabsenken, aber sie heben sich auch wieder; schließlich war alles vergebens, und die Spezialisten, die uns in unserer seichtvergnüglichen Hilflosigkeit zurücklassen, kleiden sich in Schutzanzüge, bzw. Überlebenstrainings-Dress, und dann gehen sie über die Treppe davon. Vorher haben sie noch einen enormen Einfall Frau Neudeckers gerufen, der mich nicht nur ästhetisch überzeugte, sondern auch erschütterte: „Wenn Gott nicht würfelt, würfeln wir!“ Damit war die Inszenierung dann gänzlich auf den Dall gekommen, >>>> Karl Dall, Sie erinnern sich? Jetzt aber schreiten sie die Treppe hinan und singen mit Refrain, der folgendes fragt: „Ist es jetzt getan?“
Nein, ist es nicht! Das hätte ich gerufen, wäre das Stück denn zueEnde gewesen. Das war es aber nicht. Sondern (Regieanweisung: „Leerstellen“ - ! - „füllen: Nachrichten des Aufführungstages, so aktuell und kirzfristig wie irgend möglich“) der Nachrichtensprecher spricht erneut. Mubarak sei verlegt worden, und über Israel seien Raketen niedergegangen. „Zu der Verrückung“, aber, „einer unlängst beobachteten Verschwenkung gibt es keine weiteren Informationen“ usw. blablabla. „Und jetzt: das Wetter.“
Da lachen wir aber was! Und rufen Bravi, als es dunkelt.
Dennoch möchte ich, daß die Deutsche Oper Berlin die neue Spielzeit mit einem Werk der Neuen Musik beginnt, für ein gutes Zeichen halten. Und der Kagel hat sich, o h n e Wenn, gelohnt. 
Maurizio Kagel/Christian Steinhäuser
HIMMELSMECHANIK – EINE ENTORTUNG
Eine begehbare Oper in der Deutschen Oper Berlin,
szenisch realisiert von >>>> phase7.
Bühne phase7 performing.arts - Kostüme Pedro Richter - Musik Christian Steinhäuser
Libretto Christiane Neudecker - Licht Björn Hermann - Softwarekunst Frieder Weiss
Videokunst Hajo Rehm - Safy Etiel - Dramaturgie Anne Oppermann, Dorothea Hartmann
Projektmanagement phase7 Jana Posth - phase7 Kommunikation Liza Wiegand
Sopran Anna Schoeck - Mezzosopran Dana Beth Miller - Tenor Clemens Bieber - Bariton Stephen Bronk - Der Maler Peter Gragert - Nachrichtensprecher Henning Kober
Musiker des Orchesters der Deutschen Oper Berlin. Kevin McCutcheon.
Die nächsten Vorstellungen:
Freitag, 23., Sonnabend, 24., Sonntag, 25., Montag, 26. August 2013.
Jeweils um 19 Uhr.
>>>> Karten. albannikolaiherbst - Freitag, 23. August 2013, 12:47- Rubrik: Oper
[Fotografien/Collagen: ANH/iPhone.] Womit sonst sollte man ein Festival für neues Musiktheater abschließen, als mit quasi einer Verbeugung vor einem Komponisten, der die Neue Musik ausschlaggebend mitgeformt hat und die Oper selbst zwar dekonstruiert, sich zugleich aber selbst vor ihr verbeugt hat? - beides nicht ohne unverhohlenes Augenzwinkern. Der 1992 in der Heimatstatt seiner Wahl, New York City, verstorbene >>>> John Cage hat von 1987 bis in sein Todesjahr fünf „Europeras“ genannte, nun, nicht „Opern“, aber doch Musiktheaterstücke geschrieben, durchnummeriert von 1 bis 5 mit jeweils verschiedenen Schwerpunkten im Blick; Europeras 3 & 4, das nun in der Werkstatt der Staatsoper zur Aufführung kam, fokussieren sich besonders auf die Spätromantik, also auf bis einen in den Expressionismus vorangetriebenen Ausdrucksgesang, der die Weichen in die Neue Musik durchaus mitgestellt hat, namentlich der in Europeras 3 besonders vordrängliche Richard Wagner; aber auch der Verismo ist kräftig vertreten, sowie werden neben salonmusikähnlichen Klavierminiaturen vor allem Liszt-Transkriptionen angespielt. Das Klavier wirkt insgesamt als ein – allenfalls – strukturierendes Instrument, was auch musikhistorischen Sinn ergibt, insofern es bis heute als Orchesterersatz verwendet wird – als ein solcher war es auch spätestens gedacht, seit in Form sogenannter Klavierauszüge die Opernmusik Einzug in die „gehobenen“ bürgerlichen Haushalte hielt. Daraus entwickelte sich schließlich eine ganz eigene Kunstform, die eben vor allem Franz Liszt vorantrieb und in der er seinerseits mit modernen Impulsen der Entwicklung, und zwar extrem, experimentierte. Auch das wird, ungesagt, von Europeras mit reflektiert. Denn wiewohl – von „Don Sanche“, einem Frühwerk, mal abgesehen – nun wirklich kein Opernkomponist, wirkt er in Cages Europeras 3 & 4 geradezu als Kulminationspunkt.  Tatsächlich hören wir – mit dem weiteren Orchesterersatz dreier Plattenspieler, bzw. ist es in Europeras 4 nur noch eines – ein deftiges Sammelsurium bis heftiges Durcheinander zufällig gewählter großer Stellen der Opernliteratur, eben nicht nur live von den Sängern vorgetragen, sondern auch, mehr oder minder verzerrt, von den Plattenspielern. Dazu gehen in Sabine Simitzes und Isabel Ostermanns Inszenierungen die Sänger halbkostümiert, teils in Maske (wunderbar Katharina Kammerloher als Mann mit täuschend echt wirkendem Dreitagebart; man konnte sie glatt für einen Counter halten), teils ohne im Publikum herum, besteigen die im Raum verteilten Podeste, singen simultan ihre Arien, steigen wieder herab, nehmen verschiedene Positionen ein, während zwei Uhren unerbittlich die Zeit hinaufzählen, bis der Countup des jeweiligen Stückes, von Europeras 3 und von Europeras 4, abgeschlossen ist. Mitten dann, wo immer man grad ist, verstummt die Szene, nämlich abrupt. Wobei es während der Aufführung dem Publikum völlig überlassen ist, ob es sitzenbleibt, wo es anfangs Platz nahm, oder ob es aufsteht und seinerseits herumgeht, ja, indem die Türen zum Saal allezeit offenbleiben, ist es jedem freigestellt, aus eignem Ermessen für sich die Vorführung zu beenden. Das ist auch eine Einladung zur Wahrnehmung der eigenen Freiheit, denn wie lange man bleibt, bzw. bleiben müßte, um zu verstehen, seinen Spaß zu haben, vielleicht sogar eine Art Genuß, geben die Stücke nicht vor; im Gegenteil hat die unerbittlich laufende Zeit, deren Präsenz in der Staatsoper noch dadurch unterstrichen wurde, daß man die Uhrziffern riesig auf eine Wand projezierte, etwas von der Aufforderung, daß man sich doch bitte nicht übern Kopf weg ausharrend abfinden möge. Wobei für mich wieder einmal spannend war, wie verschieden der Eindruck ist, wenn man sich mit geschlossenen Augen nur auf die Klangsensationen konzentriert, oder ob man wirklich dem „Geschehen“ mit den Augen folgt. Es ergibt sich ein komplett verschiedenes Erleben; was mit offenen Augen nicht wenig von mit dem Absurden, auch Clownesken spielender Eulenspiegelei hat, wird allein im Ohr zu einer Erfahrung des Gleichklangs, worin sich die heterogensten Klangelemente oft zu überraschenden und auch durchaus ergreifenden Momenten verdichten – aber eben aus derselben Zufälligkeit, die uns solche Erfahrungen bei geschlossenen Augen auch mitten in der Stadt machen läßt, worauf uns aber erst diese Musik stößt. Legendär ist Cages Ausruf anläßlich des Besuchs eines ihn befragenden Journalisten: „ Daher hab ich's!“ - wobei er ein Fenster zur Straße aufriß. Daß er hiermit die Arbeit zum Beispiel Charles Ives' fortsetzte, ist klar. Dekonstruktion meint bei Cage nicht Zerstörung, sondern ist positiv gemeint: als Lebensbejahung. Daher auch seine musikalische Skepsis gegenüber dem ideologischen Musikpathos. So lesen wir denn auch, kaum daß wir den Saal betreten haben, in großen Lettern an der, den Eingangstüren gegenüber, Längswand: 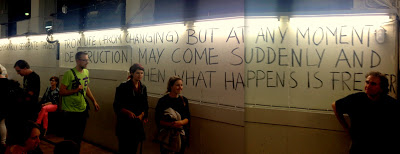
We temporarily seperate things from live (from changing), but at any moment
destruction may come suddenly and than what happens is fresher.
Womit sich Cage eindeutig auf die Seite der Entwicklung stellt und unseren Ohren empfiehlt, es mit ihm zu halten, anstatt, zum Beispiel, der vom eigentlichen Klangerlebnis wegleitenden Versuchung zu erliegen, aus dem Wust von Klängen einzelne zu identifizieren, d.h. sich eben nicht darauf zu konzentrieren, daß man innere Erfolge des Wiedererkennens feiert: „Ah! das war jetzt Puccini, oh! Humperndinck – und das da, das war doch Simon Boccanegra?“ Völlig läßt sich das aber nicht vermeiden, vor allem nicht dann, wenn besonders immer wieder Wagner von den Plattenspielern klingt; da sucht man eben d o c h ein eigentlich Gemeintes – und ist wahrscheinlich komplett auf der Fehlspur. Vor allem, so groß die Gefahr auch ist, sich von der Szene ablenken zu lassen, findet das eigentliche – und da dann schlagend zupackende – Erlebnis eben allein im Raum zwischen Ohr und Gehirn statt: da, wirklich, wird Musik. Man könnte im einzelnen aufweisen, wie bestimmte Phrasen, gewissermaßen musikalische Themenstanzen, ihrerseits das Geschehen strukturieren, teils wie ein Generalbaß wirkend, teils zu Scheinschlüssen führend, die Steigerungen versprechen usw. Dazu gehören auch die verschiedenen, ich möchte sie Klangvalenzen nennen, auf die die technische Übertragung Einfluß hat, weil sie Auras bestimmt. Jederman kennt das von historischen Aufnahmen: wie verschieden zu modernen Einspielungen der Klang- und damit Assoziationshof ist. Auch darauf spielt Cage an, bzw. spielen die Regisseurinnen darauf an, indem sie in Europeras 4 ein altes, handbekurbeltes Grammophon mit goldglänzendem Schalltrichter neben den Dual-Plattenspieler stellen lassen; die Kurbel wird auch genutzt, aber ohne, daß wirklich eine 78erRPM-Scheibe draufgelegt würde; wir vernehmen nur deutlich das rollende Drehgraunen der Mechanik über vorgestern abend Friedrich von Flotows Martha hinweg. Und starren vorher auf die echtlederbeschlagenen Sohlen der Cowboystiefel eines Sängers, als der es sich am Boden bequem gemacht hat, bzw. sich halb über eines der Podien fläzt. Oder warten darauf, daß einen die Sopranistin, durch Europeras 3 schreitend, mit ihrer rechten Hand berührt, die von Zuschauer zu Zuhörerin im Vorübergehen über die Bäuche gleitet.  Indes es in Europeras 4, dem eher kammermusikalisch, ja im Gegensatz zum emotionsgewühlten Europeras 3 geradezu poetischen, „leisen“ Teil zu fast tragischen Eindrücken kommt, wenn nämlich Reiner Goldbergs, eines einst großen Sängers, rechte Hand in permanentes parkinsonhaftsches Zittern gerät, weil er sich so anstrengt. Denn – ganz sicher eine Besonderheit dieser Inszenierung – sie gaben alle ihr Bestes, und das ist extrem viel: ob, in Europeras 3, Alin Anca, Alfredo Daza, Esther Lee, Katharina Kammerloher, Paul O’Neill oder Tobias Schabel, ob, in Europeras 4, die wunderbare Narine Yeghiyan oder eben Reiner Goldberg: Cages Musiktheater wird hier nicht, wie oft, von auf Neue Musik spezialisierten oder Sängern der zweiten Reihe interpretiert, sondern von Ensemble-Mitgliedern eines der führenden Opernhäuser unserer Welt. Denn nicht zuletzt, daß sie die Aufführung mit derselben Intensität gestalten, die sie im, sagen wir, bürgerlichen Repertoire zu Stars macht, daß sie ihr Unternehmen also, bei allem Spaß an der Sache, ernst nehmen, machte den Abend zu einem höchst besonderen und zum, siehe oben, gelungensten Abschluß dieses Festivals, der sich nur denken läßt. Daß ausgerechnet „Ridi Bajazzo!“ aus Leoncavallos Cavalleria rusticana, zumal in einer historischen Aufnahme auf Deutsch gesungen, für Europeras 4 durchaus stimmungsgebend war, hatte dabei nicht wenig von der Melancholie eines sterbenden Menschen, der auf ein gutes Leben zurückblickt – ebenso wie die einzelnen Klaviertöne, die in Off-Musiken hineingespielt werden, sowie die „Mhmh“s und das gelegentliche Räuspern Reiner Goldbergs. Da legt sich einem was ums Herz, zumal, wenn dann auch noch... Liszts Liebestodes-Transkription... –  John Cage John Cage
EUROPERAS 3 & 4
Regie Sophia Simitzis und Isabel Ostermann.
Ausstattung Corinna Gassauer.
Alin Anca - Alfredo Daza - Esther Lee - Katharina Kammerloher
Paul O’Neill - Tobias Schabel - Reiner Goldberg - Narine Yeghiyan
Klaviere: Günther Albers - Jenny Kim.
Musikalische Gesamtleitung: Günther Albers. Leider keine weitere Vorstellung.  albannikolaiherbst - Mittwoch, 26. Juni 2013, 11:36- Rubrik: Oper
[Fotografien (©): Arno Declair (To the Unconnected Child)
Hermann und Clärchen Baus (Hanjo).] Ich habe mich geirrt. Meine in dem Pressegespräch nach der Probe >>>> geäußerte Skepsis hat sich nicht bestätigt. Vielmehr ist Falk Richters Szenen-Arrangement „To the Disconnected Child“, wiewohl sicherlich weniger wirklich ein Musiktheater als ein wirkliches Theater mit Musik, von geradezu unmittelbarem Zugriff; in seiner sehr klar und oft ins Absurde schießenden, witzigen Realität ist es gewissermaßen das völlige Gegenstück zu >>>> Oehrings Opernbrei. Dabei gehen beide Stücke von einer ähnlichen Idee aus. Beide beziehen sie sich auf Musik der Vergangenheit – Oehring auf Purcells The Fairy Queen, Richter auf Tschaikowskis Eugen Onegin – und beide versuchen sie, ihre, sagen wir, Vorlagen auf die Gegenwart zu beziehen: Oehring auf eine ihrerseits schon vergangene der etwa 60er Jahre des vorigen Jahrhunderts, Richter aber auf unsere unmittelbar zeitgenössische. Allein schon daraus resultiert eine Modernität, die mit schnellen Bildern, quasi Schnitten, arbeitet, indes Oehring seinen Stoff unentwegt langzieht. Außerdem beharrt Richter auf Tschaikowskis, bzw. Puschkins Erzählung, derweil Oehring Purcell, bzw. Shakespeare beliebig nach Gefühlswollen beugt, und was Oehring deshalb mißlingt und mißlungen muß, wird bei Richter sofort plausibel, indem er Onegins Unwillen, sich zu binden oder sonstwie einzulassen, zum Kennzeichen heutiger Paarbeziehungen macht – ganz entsprechend dem Bedarf der westlichen Ökonomie nach sogenannter Flexibilität, zu deren Folgen bekanntermaßen nicht nur die schon historische Auflösung der Groß-, sondern auch der Kernfamilien gehört. Partnerschaften sind unterdessen als Beziehungen-auf-Zeit fast schon definiert. Die Scheidungsregister wissen davon Bände zu erzählen.
Gleichwohl ist, insbesondere bei jungen Menschen, das Bedürfnis nach bleibender Einheit nach wie vor virulent; nach wie vor schwört man sich ewige Treue, ja die traditionellen Liebes-Vorstellung, wiewohl sie geschichtlich sehr jung ist, nämlich aus dem 19. Jahrhundert stammt, scheint in einer Art Retro-Bewegung eine neue HochZeit zu erfahren. Also stoßen die Begehren, Bedürfnisse, Träume der einzelnen und die schließliche Realität fast unentwegt aneinander. Genau dies zeigt Richters Stück.  Richter erweist sich als ein Texter, Arrangeur und Regisseur, den ich geradezu elegant nennen muß; indem er die verschiedenen Sparten zusammendenkt und zusammen fühlt, indem er zudem jeglichen Kitsch vermeidet, bzw. ihn zwar einsetzt, aber sofort wieder – mit wirklich bewundernswertem Gespür – wegzubrechen weiß, bekommt Puschkins Erzählung auch in der Sicht Tschaikowskis eine perfekt auch auf junge Menschen zugeschnittene Form – mitunter vielleicht ein wenig zu glatt und nicht immer dem offenbar Intendierten adäquat, andererseits gerade dadurch für quasi jederman rezipierbar. Das ist in der Tat eine Kunst. Andererseits hat das Stück – als Musiktheater – ein Problem, daß aber seine ganz besondere Stärke ist: Was wir hören, ist tatsächlich nur im Zusammenspiel mit den hervorragenden Sprechern und Darstellern, der Schauspielern also, und mit den Tänzern, wirksam – nämlich allein im Moment auf der Bühne. Hört man die Klänge und Musiken für sich, bleibt nichts außer einem bißchen Arvo Pärt, einem Bißchen synkretistisch verspielter, arios behandelter Miniaturen, für das zum Beispiel Puccini La-Bohème-Thema bei Jörg Mainka steht und außer den für sich genommen reichlich sentimentalen, halb dem Folk, halb dem Schlager zuzurechnenden Songs des Pop-Barden Helgi Hran Jónsson:  , zu dessen, leider, Gunsten die zweite Hälfte des Stücks ein bißchen zerfasert – der gegenüber die erste, längere, deutlich besser durchgearbeitet zu sein wirkt. Ich habe mich später gefragt, weshalb überhaupt zwischen Teil I und Teil II eine Pause eingeschoben wurde und habe unterdessen den Verdacht: eben deshalb. Die Zerfaserung gegen Ende wäre ohne die Pause sehr viel stärker, nämlich als Länge, spürbar geworden. So aber saß man – mit dem Willen, sich amüsieren zu lassen, und deshalb auch dem gewünschten Effekt – gern auch noch die letzte halbe Stunde dort.
Richter hat sieben Komponisten gebeten, zum Thema und zu seinen Texten Musiken zu schreiben, keines länger je als sieben, vielleicht zehn Minuten. Durch sein geschicktes Zeit-Arrangement heben sich diese Stücke gegenseitig in ihrer Wirkung ausgesprochen an, zumal sie durch das eingeschobene originale, allerdings auf ein Kammerensemble transponierte Onegin-Vorspiel zusätzlich kontrastiert werden; schon so wird eine „Langweiligkeit“ ausgeschlossen. Mit tiefstem Theaterinstinkt weiß Richter Wirkungen einzuschätzen und zu konstellieren; das betrifft ganz besonders seinen Umgang mit dem teils atemberaubend starken Ausdruckstanz – besonders in dem von mir schon in meiner >>>> Besprechung der Presse-Probe vom 7. Juni hervorgehobenen Pas de Deux, der auf Franz Schuberts durch eine zunehmend lauter werdende Geräuschmusik „Gute Nacht“ getanzt wird und in wenigen Minuten vor unseren Augen eine Paarbeziehung ablaufen läßt, vom ersten Kuß über den ersten, schnell gewaltsam werdenden Streit bis zum schließlichen, erschöpften AneinanderEinschlafen:  Allerdings war auch diesmal mein sogar noch verstärkter Eindruck, daß die „Störungen“ des Gesangs das Schubert-Lied nicht etwa, wie Falk Richter meinte, beschädigte, sondern im Gegenteil erst wirklich stark machte, auch schon einfach deshalb, weil sie die Konzertkonvention unterliefen. Diese Stärkung entspricht aber genau der Sehnsucht der Protagonisten nach Heilheit, Harmonie, AngekommenSein im anderen – nur eben, gerade bei Schubert, als einem sich niemals erfüllenden. Man kann sagen, daß die Geräuschmusik Schubert eigentlich zu sich bringt und damit auch den romantischen Impuls, der bei Schubert nahezu immer mit einem Vergeblichen verbunden ist. Wobei ich nicht verabsäumen will, noch einmal die innige Gesangskunst >>>> Gyulay Orendt ganz besonders hervorzuheben.
Ähnlich, und ebenfalls „anders anders“, als ich nach der Probe gedacht und geäußert hatte, „funktioniert“ das Puccini-Motiv: es wird durch die vorhergehende Erzählung völlig organisch in den Gesamtfluß eingefügt; mein vermutender Vorwurf von Beliebigkeit ging hier tatsächlich fehl.
Großartig aber bereits der Anfang des Stücks. Erst denkt man, wenn Jónsson singt, meine Güte, was 'ne Schnulze, aber dann wird das sofort durch einen Dialog gebrochen, den die beeindruckende Ursina Landi mit „ihrem“ Onegin am Telefon führt – schon sind wir mittendrin im Thema, und die Schnulze ist tatsächlich Ausdruck der Sehnsucht dieser Frau – wobei später das Motiv ein bißchen überdehnt wird, daß es in Partnerforen schwierig sei, alleinstehende vierzigjährige Akademikerinnen mit zwei Kindern an den, im Wortsinn, Mann zu bringen. Da bedient Richter dann doch mal tüchtig ein Klischee. Auf den gesamten Abend hin erlebt, nimmt man das aber gerne hin, sozusagen als einen running gag.
Sehr schön die höchst variable, auch sie an Oehrings Stück erinnerndes Bühne; auch hier ein perfekter Umgang mit Videoprojetionen, bzw. Rückprojektionen, geschickt arrangierte Einspielungen von Ton und Klang aus dem Off, bewegend die auf ein tatsächliches Erlebnis Richters zurückgehenden Kommunikationsversuche einer alten Sängerin der achten Reihe, worin sie auf dem Notsitz sitzt und hofft, endlich einmal auf die Bühne zu dürfen, mit ihrer ihr nachvereinsamenden Tochter. Hinreißend aber schon die Hereinnahme der modernen Kommunikationstechnologie, Facebook, SMS, Singleforen im Netz usw. Falk Richters Einfallsreichtum sprüht hier geradezu, und man merkt allen Beteiligten an, mit welchem Spaß sie ihre abstrusen, leider eben realistischen Parts gestalten – ein Spaß, der unmittelbar ins Publikum hinüberspringt. Auch wenn er letztlich bitter ist.  Falk Richter Falk Richter
TO THE DISCONNECTED CHILD
Text, Regie und Choreographie: Falk Richter
Mit Kompositionen von Malte Beckenbach, Achim Bornhoeft,
Oliver Frick, Helgi Hrafn Jónsson, Jan Kopp, Jörg Mainka
und Oliver Prechtl
Franz Hartwig - Ursina Lardi - Stefan Stern - Tilman Strauß
Luise Wolfram
Steven Michel - Franz Rogowski - Jorijn Vriesendorp
Helgi Hrafn Jónsson - Borjana Mateewa Gyula Orendt
Maraike Schröter
Staatskapelle Berlin, Orchesterakademie bei der Staatskapelle Berlin.
Wolfram-Maria Märtig
Die weiteren Vorstellungen:
Heute, am 25.6., sowie am 29. und 30.6.2013,
jeweils um 20.00 Uhr.
>>>> Karten.******* Von einem allerdings noch einmal ganz anderen Kaliber, das die bereits erwähnte „Glätte“ bei Richter fast ein bißchen schmerzhaft spüren läßt, ist nun aber >>>> Toshio Hosokawas auf der No-Tradition gegründetes, gleichwohl mit westlichen Opernkonzepten vermitteltes Musiktheater „Hanjo“ - eine wenn auch relativ kurze, so doch um so konzentriertere Oper auch in musikabsolutem Sinn, die ihre Berliner Premiere am Sonnabend abend, dem 22., hatte, bzw. hatten wir sie, die wir im Publikum dabeisein durften. Nicht „nur“ der Musik wegen war es ein Ereignis, sondern frappierend, wie ausgerechnet der für Skandale – je nach Perspektive: – berühmte oder berüchtigte Calixto Bieito auf jegliche Regietheater-Einfälle verzichtete. So sehr offenbar ließ er sich auf das konzentrierte, halb surreale, halb geradezu griechisch-tragische Geschehen dieses Stückes ein („Du hast deinen Ort“, sagt es: „sinnlos, ihn verlassen zu wollen“). Auch des Mannes häufige Kritiker – erinnern Sie sich bitte an >>>> die in Der Dschungel geführte Auseinandersetzung um seine Freischütz-Inszenierung an der Komischen Oper Berlins – werden seine Regiearbeiten von hieraus noch einmal ganz anders betrachten müssen; ich selbst habe ernsthaft mit einiger Nacktheit gerechnet, schon insofern die Protagonistin eine Geisha ist, bzw. war, die aus ihrer Profession von einer lesbischen Malerin ausgelöst wird. Bieito hätte hier satt zuschlagen können. Aber nein. Er behält Hanaos entrückte Ver/rückung im Auge, ohne sich auch nur irgendwie regietheatralisch vorzudrängen und ohne den sich schließlich in ein Glück des beiderseitig gewollten Verzichts ausbalanzierenden ferneren Alltags mit gewaltsamen Mitteln zu illustrieren, auf den das Stück – anders als in >>>> Mishimas Vorlage – schließlich hinausläuft. 
Bereits, wenn wir den Saal betreten, empfängt uns eine Bühneninstallation, deren Kraft an Yannis Kounellis' Objekte, bzw. Environments erinnert: Schräg von der Hinterbühne bis ganz nach vorn ist ein Gleispaar verlegt, das wie in der Wirklichkeit auf einem Schotterdamm ruht; quer dazu sehen wir einen umgestürzten mageren Baum; dann gibt es rechts noch ein paar Kisten, die von ungefähr an Gräber erinnern und von geknäulten, dicken Plastikfolien bedeckt sind. Dahinter, aber fast direkt in Berührung mit dem Bild, ist das zweigeteilte Orchester gruppiert, dessen Musiker teils selbst, wie Personen eines No-Stücks, maskiert sind: die Masken aufgemalt, teils angedeutet, man merkt es anfangs erst gar nicht. Interessanterweise betont dies den „griechischen“ Aspekt der Oper: als wären die Musiker der chorische Kommentator des Geschehens. Nimmt man diese Auslegung an, ist eigentlich die Instrumentalmusik seine letzte Erzählinstanz. Hosokawas Komposition scheint das zu bestätigen, die in „freier“, teils flächiger Aura und besonders zu Anfang an der Grenze der Wahrnehmbarkeit erklingt – wobei einmal mehr, und nicht nur in diesem Haus, die Klimaanlage ausgesprochen stört. Andererseits erhebt sich der Klang so aus einer Art Hintergrundrauschen und formiert sich gegen es zugleich wie mit ihm, das die Glöckchen- und Schellenklänge geradezu in sich integriert, so daß sie besonders ungefähr klingen. Insofern entspricht das Rauschen der traditionellen japanischen Musik, die schon sehr früh, anders als die westliche, Geräusche als einen wesentlichen Teil ihres Charakters ausgebildet hat. „Naturnähe“, in der Moderne, kommt zudem um technische Klänge, also um Zweite, bzw. Dritte Natur nicht herum. Nicht grundlos haben sich zeitgenössische Komponisten der westlichen Welt immer wieder auf fernöstliche Musiken bezogen, nachdem der Kreis des Quintenzirkels, aber auch das serielle Konzept abgeschritten war, indes die in ihrer Entwicklung zum Stillstand gekommene japanische Musik die westliche Kunstmusik seit etwa den Fünfzigern/Sechzigern nicht nur adaptiert, sondern noch zu übersteigern versucht hat.
Die erzählte Geschichte ist einfach.
Hanako, noch als Geisha, verliebt sich in Yoshio und er sich in sie. Als er sie verlassen muß, tauschen sie die Fächer; er trägt fortan den ihren bei sich, sie den seinen. Nachdem die Liebende ihre Tätigkeit schließlich aufgegegeben hat, begibt sie sich jeden Tag zum Bahnhof, um dort, seinen Fächer immer bei sich, die Rückkehr des lange, immer länger ausbleibenden Geliebten zu erwarten. Finanziert wird ihr das von der japanischen >>>> Geschwitz Jitusko, der sie, quasi als Gegenleistung, Modell steht. Wobei Bieito aus den Fächern Tattoos macht, die am Bauch, bzw. auf der Brust getragen werden. Da es in Japan aber nur >>>> Yakuza sind, die sich tätowieren lassen  , spielt Bieito höchst geschickt auf einen Gewaltzusammenhang an, der in dem Moment auch für die Zuschauer real wird, als die Malerin Yoshio nicht zu Hanako vorlassen will. Nach einer heftigen Auseinandersetzung schlägt er ihr ins Gesicht; hernach erscheint sie mit blutender Nasen/Wangen/Mundpartie. Und als er bei ihrer endlichen Wiederbegegnung Hanoko das Fächer-Tattoo präsentiert, ist es nicht wie bei ihr ein einziges Zeichen, sondern sein ganzer Vorderleib starrt von Tätowierungen – als hätte er nicht nur diesen einen Fächer getauscht:  Schon deshalb, dieser Inszenierungs-Idee folgend, kann Hanako in ihm den erwarteten Geliebten nicht wiedererkennen – ein insofern höchst raffinierter Regietrick, als er die japanische Versagungsmentalität mit dem westlichen Konzept quasi-ehelicher Treue ineins führt.
Zunehmend aber schon vorher entrückte sich Hanako in ihre Vorstellungswelt, in der sich der reale Geliebte in einen imaginären „wahren“ verwandelte, der für sie schließlich mehr Gegenwart hat als die wirkliche Erscheinung des Zurückgekehrten. Ja, die Menschen aus Fleisch und Blut werden ihr insgesamt zu Gespenstern, indes das Reich der Geister sich ins Reale schiebt. Eben dies garantiert zugleich die Beziehungs-Stabilität der entsagenden Lesbe und der ihre Erfüllung allein im hoffenden (Er)Warten findenden Liebenden. In diese Ausbalanziertheit, die schon die erste Szene charakterisierte, führt die Musik in der letzten zurück: Man kann von einer magisch stabilierten Negativen Harmonie sprechen. Genau der gibt Hosokawas oft flirrende, gleitend schwebende und immer wieder im Wind des Lebens klingelnde Musik den Ton.
Dies alles heißt nun aber nicht, daß das Stück undramatisch wäre; sogar das Gegenteil ist der Fall. Die hier gerade zwischen der Malerin und ihrem, sagen wir einmal, Nebenbuhler aufwallenden Emotionen stehen der europäischen Hysterie-Tradition in keiner Weise nach, nur daß es den gewohnten Schmelz nicht gibt, mit dem sie aufgeedelt wird  ; vielmehr ist ihnen entweder eine massiv ausbrechende Rohheit eigen, verkörpert vom „männlichen“ Prinzip Yushios, oder aber sie filtert sich in distanzierte Haltung – etwas, das insgesamt auch der Neuen Musik Europas eigen ist, zumindest war, und ihr nicht selten den nicht durchweg grundlosen Vorwurf der Intellektualisierung eingetragen hat. Die Entwicklung der populären Musik, die es dem Rezipienten einfach macht, indem es ihn auf dem Status entweder melodisch-tonalen Tonerlebens und/oder rhythmischen Mit ravenkönnens festhält, ist bis heute zu totalitär, um tatsächlich ein neues Hörempfinden zu erlauben, auf das es eigentlich ankäme – und zwar nicht nur für Eliten. Daß Markt hier eine ganz besondere Rolle spielt, muß ich nicht schreiben; favorisiert wird immer das „Bekannte“, das mit schnellem Genuß zahlt und die Gegenleistung als Quote garantiert: eine von vornherein präformierte Dynamik, derethalben ich eben als von einem Totalitären spreche. Um so wichtiger - vor allem bei dem Erfolg, den Hosokawas Oper am Sonnabend abend feiern konnte -, daß Stücke wie dieses auch weiterhin an großen Bühnen eine Heimat finden: sie machen uns das Fremde als ein Eigenes vertraut – eine seit über einhundert Jahren vollständig uneingelöste Utopie.
Fasszinierend zugleich puppenhaft wie traumwandelnd Ingela Bohlins Hanako. „unschuldig“, würde ich sagen, wäre nicht die Stimme derart präsent; und Ursula Hesse von den Steinen gestaltet ihre Frau Honda beinah wie eine Lady Macbeth, der es um die Macht des Beherrschens ebenso geht wie dem Yakuza Yoshio, den Georg Nigl mit angemessener Würde erst, dann zunehmend wütender Forderung, schließlich – all dies auch in der Stimme – in einer Niedergeschlagenheit präsentiert, die dem Gesichtsverlust entspricht, derart abgewiesen zu werden. Daß er auf allen Vieren davonkriecht schließlich, ist kein bieitosches Bühnenmätzchen, sondern entspricht der japanischen Mentalität, die, wenn die Ehre verlorenging, sich selbst noch ganz besonders kleinmacht. In meiner obwohl nur sehr kurzen Tokyozeit habe ich das zweidreimal erleben müssen.
Dennoch eine winzige Einschränkung: nach Ankunft des Zuges – enorm filmisch, wie die Scheinwerfer ins Publikum gleißen – hätte Bieito mit dem Rauch etwas weniger verschwenderisch umgehen können, einfach, weil das Mittel schon so ausgelutscht ist und es völlig gereicht hätte, Hosokawas Klängen zu vertrauen.  Toshio Hosokawa Toshio Hosokawa
HANJO
Oper in einem Akt.
Inszenierung Calixto Bieito – Bühnenbild Susanne Gschwender
Kostüme Anna Eiermann – Licht Reinhard Traub – Dramaturgie Xavier Zuber.
Ingela Bohlin - Ursula Hesse von den Steinen - Georg Nigl
Staatskapelle Berlin, Günther Albers.
Noch eine Vorstellung:
30. Juni 2013, 19.30 Uhr.
>>>> Karten. albannikolaiherbst - Dienstag, 25. Juni 2013, 18:35- Rubrik: Oper
Hin- und herüberlegt habe ich, ob ich über >>>> „Aschemond“ überhaupt schreiben soll. Als wir am Mittwoch abend die zweite Vorstellung nach der Uraufführung verließen, kochte G., mein bester Freund, vor Ekel und kanalisierte ihn in Verachtung: „Das war die schlechteste Oper, die ich jemals gesehen habe“. Schon saßen wir in der Strandbar beisammen, um uns zu erholen. Er schimpfte und schimpfte. Denn in der Tat: Was einem da zugemutet wurde, ist nicht zu begreifen, dieses Ausmaß an Regression und Regressionssucht, Kitsch, Schwulst, hohlem Pathos, überdies einem - an Henry Purcell - Mißbrauch, der die ästhetische Vergewaltigung nicht nur streift, wenigstens aber - nimmt man die Oper als von Helmut Oehring geschrieben – einerseits gnadenlosem Plagiieren gleichkommt, anderseits einer Form von Leichenfledderei, über die bereits Karl Kraus schrieb, daß es für einen kleinen Menschen nicht wirklich leicht sei, einem großen auf den Kopf zu spucken, und zwar auch dann nicht, dies nun nicht mehr Kraus, wenn man an fremder Kopfhaut saugt, um vom Gehirn abzukriegen. Egal. Alle haben gejubelt; auch die Kritiken nachher.
Man fragt sich nur: wem zu? Denn wirklich, die Sängerinnen und Sänger waren großartig, desgleichen sämtliche Instrumentalisten, der Dirigent; auch die Bühne, imgrunde, stimmte, die Videoprojektionen stimmten, die Abläufe, die Regie – nur als das, was dieses Stück sein soll, ging es bis in den Selbstmord durch seine Peinlichkeit daneben. Und dies wahrscheinlich bereits als Konzept. ***Doch damit will ich nicht beginnen, sondern mit der gestrigen Premiere der sehr viel bescheidener daherkommenden, tastenden, auslotenden >>>> „Récitations“ des gräcofranzösischen Komponisten Georges Aperghis in der proppevollen und extrem aufnahmebereiten Werkstatt des Schillertheaters- einem Raum, der für Experimente gemacht ist, weil er sich mit einfachsten Mitteln, gestern auch tatsächlich fast nur darstellerischen in jeden anderen Raum der Welt verwandeln läßt: unserer Innenwelten, aber auch der realen Gegenwart und beides zugleich.  Daß die Aufführung derart gelang, liegt nicht nur an der bewundernswerten Uta Buchheister, die stimmlich Extremes zu leisten hat, sondern auch und besonders an der Elisabeth Stöpplers, der es tatsächlich gelungen ist, aus dem quasi informell gebauten, scharf durchkonzipierten Musikmaterial eine bewegliche und bewegende, teils dem Absurden verschriebene, teils aber unmittelbar ins Empathische und in unaufgesetzte Emphase hinüberzubrechen, und dies unter Verwendung einfachster theatralischer Mittel bis hin zu einem geradezu schlagenden, wellenschlagenden nämlich, Spiel mit allem Rheingold der Welt.
Aperghis' Stück betont in dieser Interpretation nicht nur das experimentelle Theater der 50er/60er Jahre, sondern übertritt bereits in sich selbst die Grenze von Performance, mimischer Darstellung, Clownerien, Verzweiflungen und Begeisterungen, ja selbst zum action painting. Damit ist das Stück noch völlig frei von - um dies im deutschen Mißverstehen des Begriffs zu schreiben: - „postmoderner“ Affirmation, die den Abend davor, also Oehrings Schwulststück, vielleicht am allerbesten charakterisiert und auch die Begeisterung, mit der es aufgenommen wurde. Nein, Asperghis ist, bei aller komödiantischen Lust, streng. Er läßt uns auf die Binnentöne hören, Binnenklänge, ganze Klanghöfe – dabei immer nur sehr kurz angesungen –, die als Musik eben auch Geräusche verstehen, auch solche, die durch die Gänge der Darstellerin erzeugt werden, durch die Absätze ihrer Schuhe auf dem hohl von ihnen klingenden Boden, oder allein durch ihr Atmen, dann wieder vermittels rhythmischem Fingerschnippen. Wobei es eine Meisterleistung für sich ist, vom französischen Text so in einen deutschen zu springen, daß sich Einzelne aus dem Publikum direkt ansprechen lassen. Was denen erstmal peinlich ist, klar, aber das gab sich gestern abend schnell, und spätestens, nachdem wir von unseren Sitzbänken aufstehen mußten, weil die Darstellerin sie verrücken wollte und das auch tat, und als wir dann wieder saßen – mit bisweilen ganz anderer Sicht, anderen Nachbarn - lösten wir uns und wurden zum Teil des Spiels. Wobei besonders spannend ist, daß in Stöpplers Auffassung das Publikum letztlich ebenso Teil des Interieurs ist wie der (mit blauer Farbe befüllte) Feuerlöscher, wie anfangs die immer wieder aus der Wand kippende Tür, wie die Längsstreben, die von der Decke herabkamen und ihrerseits Teil der Aktion wurden. Daraus spricht aber nicht nur karikierende oder sich zergrübelnde Spiellust, sondern – weil die Sängerin letztlich allein bliebt, denn die aktive Mitwirkmöglichkeit des Publikums ist scharf begrenzt – vor allem eines: Einsamkeit.  So eilt ihr denn auch niemand zuhilfe, wenn sie sich vermittels einer Starkstrom(!)kabels erhängen will und wirklich sich erhängt. Und die Alarmsignale gellen. Auch, daß diese Inszenierung zweidreimal elektronische Zuspielungen verwendet – deren Aura ließ Berios „Ommagio à Joyce“ von 1958/59 erinnern – sowie entfernte Schlagermusik, die für die „falsche Hoffnung von außen“, eine letztlich industrielle, steht, fügt sich in dieses Konzept nahtlos ein, selbst sollte Arpeghis' Partitur, die ich nicht kenne, das nicht vorsehen: Récitations ist quasi-seriell puristisch. Aber fremde Klänge g e h ö r e n zur Realität einer Bühne, zu ihrem Material: sofort wahrzunehmen, als nach Einsatz einer Rauchmaschine – auch dieses inszeniert – ein Notfenster viertels aufgezogen wurde, um den Qualm wieder abziehen zu lassen, der aus dem Publikum eine ältere Dame veranlaßte, sich davonzumachen. Mit einem Mal hörten wir alle das Draußen, indem wir auf unser Drinnen konzentriert waren, das sich zu dieser Aktion auf dem Musiktheater zu verhalten lernen mußte. Dafür wurden wir mit einem der zugleich einfachsten wie märchenhaftesten Finales belohnt, das ich in der Oper überhaupt je erlebt habe.  RÉCITATIONS RÉCITATIONS
von Georges Aperghis Inszenierung Elisabeth Stöppler – Ausstattung Annika Haller
Dramaturgie Detlef Giese
Voix Seule Uta BuchheisterWomit wir wieder im Abend zuvor und bei meinem Freund G. wären, der da die schlechteste Oper, die er je gesehen, erlebt zu haben schimpfte. Das Perverse daran ist, nicht immer, aber oft, daß man dennoch klatschen muß – einfach, weil die Ausführenden so hervorragend sind. Das spricht nun aber besonders gegen das Stück, weil sehr gute Ausführende selbst klapprige Opern zum Leuchten bringen können, einen quasi auf die Schultern heben und über jede Peinlichkeit, jeden kompositorischen Fehler, jedes schiefe Happyend oder bizarr ausgedehnte Sterbeszenen hinwegtragen. Bei sehr guten Ausführenden akzeptieren wir – quasi eine Übereinkunft – noch die abstrusesten Handlungsverläufe. Und hier waren die Ausführenden nicht nur gut, sondern von absolutem Weltniveau, sei es Marlies Petersen, sei es der unfaßbar engelhaft singende Counter Bejun Mehta, sei's Topi Lehtipuus Tenor, sei's Roman Trekels sonore, ganze Räume öffnende Tiefklang. Nicht anders die wie immer ausgezeichnete Akademie für Alte Musik und die Mitglieder der Staatskapelle Berlin.  Wenn aber von deren virtuoser Gestaltungskraft zum Schluß nichts bleibt als das Gefühl, in eine obendrein versalzene fette Buttercremesüße getunkt worden zu sein, dann ist das entsetzlich – und um so entsetzlicher, als Kritik wie Publikum das nicht nur nicht gemerkt, sondern es als Wohltat empfunden zu haben scheinen. „Ich denke, du lehnst den Pop ab?“ zischelte mir während der Aufführung nicht nur ironisch, nein höhnisch der Freund zu. Da hatte ich aber längst in den Taschen die Fäuste geballt. Wären nicht die Purcell-Lieder, aus denen sich Oehrings Parasiten-Oper die Wirkung herausschmarotzt und für Eigenes ausgibt, derart schön vorgetragen worden, ich hätte das Haus nach der ersten halben der zweieinhalb Stunden verlassen, und es wäre mir ein Genuß gewesen, von ganz in der Mitte die Leute zum Aufstehen nötigen zu müssen, kurz: Unruhe in dieses weihevolle Pubertieren zu bringen. Wahrscheinlich hätte ich auch zum ersten Mal in meinem Leben im Opernhaus die Tür geschlagen. Meine Güte, die da vorne waren völlig nackt, aber hinterher jubelten alle dem Kleidermacher zu.
Dabei war billig schon der musikalische Auftakt: nach elektronischem Dräuen à la Geschichten aus der Gruselgruft ein Herzschlag unter alles gelegt – wie wenn man da die Absicht nicht bemerkte. Bemerkte man auch nicht. Dann schon, leicht verfremdet von Oehrings Instrumentation, der erste Purcell-Song, gefolgt von metaphysischem Seinwollen des Klangs und Stimme, bedeutungsschwanger, aus dem Off, mal wieder eine Anlehnung an Ligetis Requiem, dann, sagen wir mal, Psychodelickereien. Dazu eine Story, wie sie abgelatschter gar nicht sein kann. Mann um die fünfundvierzig kehrt in sein Heimathaus zurück, gerät an das Tagebuch seiner toten Mutter und erfährt nach und nach – indem er teils als Geist, teils als Kind-wieder-selbst Zeuge der Vergangenheit wird -, weshalb sich seine Mutter unmgebracht hat. Nun ja, das kann wirklich einen Grund gehabt haben, über den niemand je sprach. Aber was stellt sich heraus? Aus Liebeskummer und wegen eines Überdrusses an den von Trieben bestimmten Menschen und daran, daß sie Rituale des Alltags noch und noch wiederholen. Jesses, denkt man da, das soll dieser doch eigentlich reife Mensch nicht vorher schon gewußt haben? Wo ist da das Geheimnis? Was aber Helmut Oehring und Klaus Guth, der für die Texte mitverantwortliche Regisseur, daraus abziehen, ist eine Sehnsucht nach Regreß, die jeden erwachsenen Menschen kotzen lassen müßte, wäre es nicht so entsetzlich lächerlich.  Dazu gesellt sich obendrein eine extreme, als „edel“ und „verloren“ kaschierte Ablehnung von Sexualität, wie wir sie allenfalls von calvinistischen Sekten kennen oder, na gut, aus dem Biedermeier – hier um so schlimmer, als sie sich – abermals bedeutungsschwanger aus dem Off über die Szene gesprochen – an einem aus dem Zusammenhang gerissenen Shakespeare-Sonett bedient, das schamlos hochgemotzt ins Deutsche übersetzt wird, ohne auf Metrik und Metaphorik zu achten, ja sie zu mißachten, was den Text in ein moralinsäuerliches Rülpsen verwandelt, das als Botschaft daherkommt und wahrscheinlich der neuen zeitgenössischen Reinlichkeit – einer, die zugleich gerne foltert – ausgesprochen entgegenkommt: Der Tod der Seele in schamloser Vergeudung
ist die Wirkung der Lust; und bis sie wirkt,
ist Lust meineidig, mörderisch, blutig, voll Schuld,
brutal, drastisch, roh, grausam, ohne Vertrauen.
Nicht länger genossen, geradewegs verschmäht.
Vorbei, gehetzte Vernunft, nicht mehr da,
vorbei, gehaßter Verstand, verschluckt wie ein Köder,
ausgelegt, um das Opfer verrückt zu machen.
Zuvor: versprochene Wonne, danach: ein Traum,was überdies die letzten beiden Verse des Sonetts unterschlägt, im folgenden in Shakespeares Original: The expense of spirit in a waste of shame
Is lust in action; and till action, lust
Is perjured, murderous, bloody, full of blame,
Savage, extreme, rude, cruel, not to trust;
Enjoy'd no sooner but despised straight;
Past reason hunted; and no sooner had,
Past reason hated, as a swallowed bait,
On purpose laid to make the taker mad:
Mad in pursuit, and in possession so;
Had, having, and in quest to have, extreme;
A bliss in proof, and proved, a very woe;
Before, a joy proposed; behind, a dream.
(All this the world well knows; yet none knows well
To shun the heaven that leads men to this hell.)Um Ihnen klarzumachen, mit welcher Verfälschung Oehring und Guth hier „arbeiten“, im folgenden Karl Kraus' hinreißende Nachdichtung dieses Gedichtes: Wird Geist gewendet an den Plan der Lust,
sind Lust und Geist im Werk der Schmach verschwendet.
Kein Meineid, kein Verrat ist unbewußt,
nicht Mord dem Sinn, den jene Lockung blendet.
Doch sie verkürzt ihn. Denn in tollem Wagen
wird Lust Verlust und nichts verbleibt den Sinnen
als noch der Wunsch, sich fortan zu versagen
und niemals mehr von neuem zu gewinnen.
Wie Wahnwitz giert und allzu bald ersattet,
bevor das Unmaß der Erfüllung voll —
unselig, den die Seligkeit ermattet,
und den das Glück gleich einem Gift macht toll.
Wer wüßt' es nicht, und würde nicht durch Gluten
des Himmels doch sich in die Hölle sputen!Worauf es nämlich ankommt, Shakespeare wie Kraus, ist dieses „Wer wüßt' es nicht“ - tja, der eigentlich erwachsene Erzählermann in dieser Oper weiß es offenbar n i c h t. Daß er so wenig gereift ist, macht es freilich schlüssig, daß er dann – ein furchtbar schmieriger Text – entwicklungsblöde ins Publikum spricht: Man hat mich als Kind auf ein Traumland konditioniert, auf Märchenköniginnen und kleine Prinzen mit Rosenbüschen, auf bissige Bären und ii-aa-Esel. Das schöne dunkelhaarige Kidn, das einem Sternenpfad folgend durch die Mitternachtshimmel fliegt, in der Filmdosenspule meiner Mutter – all das war mein Leben, als ich klein war.Wohlgemerkt, ein erwachsener Mann. Spüren, wie die zarte Haut sensibler Kinderfinger sich verdickt. Spüren, wie die Geschlechtsorgane laut nach dem - wie furchtbar! Fleisch rufen; und dann: Butter, Brot, Ehe, Sex.Allein schon die unterstellte Notwendigkeit einer Folge von Ehe und Sex – Ehe, klar, zuerst – macht deutlich, welch ein Regreß hier beschworen und dem Publikum manipulativ aufgedrückt werden soll. Warum zum Teufel wird man in diese glatte Erdbeern-mit-Sahne-Mutter-Gans-Welt hinein konditioniert, in diese Alice-in-Wonderland-Märchen, wenn man sowieso auf dem Folterrad landet.Ganz abgesehen davon, daß hier das Unheimliche von Carrolls Alice-Erzählung aufs Naive verdisneyt wird, ist zu fragen, was denn dieses Folterrad sei, das der Held der Oper beklage? Er soll erwachsen werden, endlich – d a s empfindet er als solches. Deshalb kriegen wir auch gleich den nächsten Quatsch auf die Ohren gedröhnt: Ich will jemanden lieben, weil ich geliebt werden will. Vielleicht werfe ich mich mit der Angst des Hasen vor ein Auto, weil mich die Scheinwerfer erschrecken undMan beachte die Form der Conclusio: ich mich sicher fühle im dunklen, blicklosen Tod unter den Rädern.Der Mann - und das Publikum offenbar mit ihm - will nicht lernen, mit Amibivalenzen umzugehen, flüchtet sich immer mehr hinter seine als Kind getragene Katzenmaske, deren trauriger Ausdruck unterschlägt, ebenfalls unterschlägt, daß Katzen Raubtiere sind, die gerne ihre Mäuse quälen.
Es sind Oehring und Guth selbst, die die Erdbeersahne verstreichen – darin nicht unähnlich >>>> Lars van Triers „Melancholia“, wo auch schon „ Le Weltschmerz“ zur Begründung hinreichen sollte, daß alles untergehen müsse. Anstatt sich den Problemen zu stellen und wirkend einzugreifen, gegenzusteuern. Mein Gott, die Mutter hat aus Liebeskummer Selbstmord begangen. Das ist nicht schön, aber kommt vor. Wir hatten solche Anwandlungen alle, aber sehen wir zurück, begreifen wir daran unsere einstige Unreife. Auch hier kann Shakespeare uns einiges lehren – auch das Lachen, das dieser klebrigen Oper komplett abgeht und von dem Goethe geschrieben, es habe immer einen dunklen Grund. Tutto nel mondo è burla! ruft lachend der begreifende Falstaff aus, auch wenn der Spaß auf seine Kosten ging. Oehring aber will zu Werther zurück, und mit schlechteren Mitteln.
So auch die Regie. Wird jemand – wie die Mutter – hysterisch, verrenkt sie sich an der Wand oder windet sich spastisch am Boden; dazu dräuend die Musik. Hier wird eine Bühnensprache verwendet, von der Sloterdijk einmal sehr zu recht gesagt hat, die Hysterie sei das erfolgreichste Exportprodukt Europas, nämlich eines des Operngeschranzes. Was fürs 19. Jahrhundert freilich noch angehen mochte, wiewohl Mitursache für die dann folgenden Greuel, ist bereits für die zweite Hälfte des zwanzigsten, nach der Erfahrung dieser Greuel, schlichtweg inakzeptabel. Oehrings Oper ist politische Reaktion-pur, ein mit dem Zucker des Selbstmitleids überbackter musikantischer Wiener Kongreß, und entspricht exakt dem Kniefall unter den globale Kapitalismus mit all seinen schauderhaften Folgen. Während ich dies schreibe, soll eine deutsch-US-amerikanische Freihandelszone eingerichtet werden, die die EU quasi auf die USA erweitert, aber ohne daß Europäer dort dauerndes Lebensrecht hätten. Geschmiert wird das alles vom Pop – ich meine nicht den in seiner experimentellen Ausprägung, sondern die am Schlager orientierte billige Massenversion, deren Texte mit exakt derselben an einem sogenannten Einfachen ausgerichteten Verlogenheit daherkommen – , genau dem, da hatte mein Freund völlig recht, ist diese Oper zuzurechnen.
Wenn man sich jetzt die Musik an„sieht“, also insoweit sie von Oehring überhaupt stammt, dann handelt es sich um leichte Dekonstruktionen der Purcell-Lieder, von denen er aber alle Wirkung bezieht. Es tut den Liedern manchmal ganz gut, daß sie von Oehring aus der abgestandenen Hörgwohnheit herausgelöst werden; das bestreite ich nicht; aber so etwas ist mit allereinfachsten Mitteln zu bewerkstelligen und muß mit Komposition gar nichts zu tun haben. Es gab Meister dieses Fachs, Schnittke etwa, der dafür berühmt war, aber auch Berio, und auch bei Henze, in seinem „Tristan“ zum Beispiel, finden wir es: Stücke eines meisterhaften Synkretismus, mit dem ich durchaus sympathisiere – seine Gegner denunzieren ihn gerne als Eklektizismus –, ein Formspiel, das nicht nur Gesten übernimmt, sondern das „alte“ Material im Eigenen kompositorisch aufhebt. Wo Oehring so etwas gelingt, bleibt es aber seinerseits Zitat, etwa kurz vorm Ende der ersten halben Stunde im untergelegten Cembalo. Sogar die E-Gitarre ist aber zaghaft, fast, als müßte sie um Entschuldigung bitten; im übrigen bleibt es beim Auffächern der Klänge, einer Art Zerlegung, die allzu gern in ein Heavy Metal münden, von dem man, große Gutwilligkeit vorausgesetzt, sagen könnte, daß es von Stravinski herkommt.  Was aber alledies mit Shakespeare A Midsummer Night's Dream zu tun haben soll, auf dem Purcells The Fairy Queen fußt, bleibt bis zum Ende unklar, ebenso wie der Versuch, die mythische und mystische Anderswelt der Naturgeister, die, weil eben Natur, auf Seiten der Triebe stehen, und zwar mit allem Witz, der sich denken läßt, mit dem griechischen Chor zu verbinden, der in der Antike der Erzähler und Kommentator des tragödisch Vorgeführten war. Diese Funktion kann er hier nicht haben, weil es ja Ulrich Matthes gibt, der außer seiner Bekanntheit gar keine Gelegenheit hat, etwas anderes zu mimen, als einen zunehmend regredierenden durch die Szenen irrenden Verwirrten, der schließlich noch grölend singen muß, um dem Geworfenen in ihm einen anderen Ausdruck als den eines unterentwickelten Menschen zu verleihen, der doch dringend nachreifen müßte, um die Diagnose psychoanalytisch auszudrücken. Wie sehr er sich dagegen sperrt, zeigt selbstverräterisch eine Szene des Schlußbilds, wo der altgewordene Onkel, der für die Tote nach wie vor Kerzen entzündet, ihn zu sich nehmen will: eben, damit er zu trauern lerne. Daß der Mann das ablehnt, ist in „Aschemond“, und auch nur vielleicht das, der einzige wahre Moment. Zwei Minuten Aufschuß von Wahrheit gegen einhundertfünfzig, die der Lüge huldigen. Die Elfenkönigin bleibt dabei im Hohlen stecken, selbst, würde man die Massen melancholischer Zuckerbäckerei hinwegschieben können. Wozu es eines ganzen Kettenräumers bedürfte.  AscheMOND oder The Fairy Queen
Oper von Helmut Oehring unter Verwendung von Musiken Henry Purcells. AscheMOND oder The Fairy Queen
Oper von Helmut Oehring unter Verwendung von Musiken Henry Purcells.
Konzeption und Libretto von Stefanie Wördemann.
mit Texten von William Shakespeare, Heinrich Heine,
Adalbert Stifter und Helmut Oehring.
Inszenierung Claus Guth - Bühnenbild & Kostüme Christian Schmidt – Licht Olaf Freese
Choreographie Ramses Sigl – Video Kai Ehlers – Elektronik Torsten Ottersberg
Chor Eberhard Friedrich – Dramaturgie Konrad Kuhn & Jens Schroth
Marlis Petersen - Tanja Ariane Baumgartner - Bejun Mehta - Topi Lehtipuu
Roman Trekel - Ulrich Matthes - Uli Kirsch - Christina Schönfeld
E-Gitarre Jörg Wilkendorf - Solo-Gitarre & Banjo Daniel Göritz
Solo-Kontrabass - Matthias Bauer
Staatskapelle und Staatsopernchor Berlin, Johannes Kalitzke
Akademie für Alte Musik Berlin, Benjamin Baylalbannikolaiherbst - Freitag, 21. Juni 2013, 11:14- Rubrik: Oper
 Puccinis Oper „La Fanciulla del West“ ist für den einfachen Menschen geschrieben. Insofern diese einfachen Menschen keine Oper mehr hören, ist sie die verlorenste, vielleicht, aller Opern. Da helfen auch Nobert Abels wie immer klugen Anmerkungen im Programmheft nichts; da hilft es ebenso wenig, daß Christof Loy vollkommen recht hat, eine sogenannte Aktualisierung des Stückes abzulehnen. Schon gar nicht eignet es sich für Abstrahierungen; jede Überhöhung des veristischen Szenarios, das heißt auch, des von ihm verkörperten Naturalismus, wäre also grundfalsch. Dabei ist das Stück längst selber falsch geworden, nämlich, indem es nicht nur – was es von Anfang an sein sollte – mengen-, also publikumswirksam ist, sondern weil es industriell so ausgeschlachtet und, dadurch zugleich um seine Neuerungen beraubt, auf den wohlfeilsten Gebrauch in Klangmodule zur politischen Massenrührung und -lenkung hin zerlegt worden ist. Deshalb funktioniert es unterdessen, wie seine modernen Derivate, als Sammlung variabler Klischees. Was Loy und auch Abel zurecht als Errungenschaften des Spielfilms bejubeln und für deren Quelle sie, ebenfalls zurecht, das „realistische“ Theater der vorletzten Jahrhundertwende, vor allem aber die Oper ansehen, ist ein Hauptinstrument der wie auch immer demokratisch genannten politischen Manipulation geworden, und zwar insbesondere durch den Spielfilm. Es brauchte Filmsprachen wie, zum Beispiel, Godards und Rivettes, in neuerer Zeit auch Lynchs, um dem wenigstens ein bißchen etwas, und oft genug b l e i b t's bei der Absicht, entgegenzusetzen – ein unterdessen sowieso allenfalls noch respektables Vorhaben, weil den entsprechenden Filmen in die Kinos gar kein Einlaß mehr gewährt wird. Deren Kasse verlangt die gnadenlose Zurichtung auf Bekanntes; alles andere irritiert und wird abgestoßen. Dahinter steht in unserer zunehmend unübersichtlich gewordenen Zeit gewiß das Bedürfnis nach glückhafter Eindeutigkeit.  Eben die gewährt Puccini, und zwar auch dann, wenn er sein „eigentliches“ Publikum längst verfehlt. Man darf nicht vergessen, daß zu seiner und auch Verdis Zeiten ganze Städte die Arien am nächsten Morgen nachgeschmettert oder gesummt haben: aus jeder Backstube klang das und wurde, die Beine baumelnd am Hafen, vor sich hingepfiffen. Die Musik stiftete eine soziale Identität, die im heutigen Opernbesucher nahezu immer falsch ist. Deshalb aber auch kommen einem gerade Puccinis in Töne gesetzten großen Gefühle so oft unangemessen vor: viel zu überhöht für seine gerade in der Fanciulla doch ziemlich retardierten Charaktere. Sie vermitteln eine Utopie des „Echten und Wahren“, eines sogenannt Einfachen, das draußen, wenn der Opernabend vorüber, geradezu minütlich des falschen Scheins entlarvt wird. Das Publikum aber einigt sich für zweieinhalb Stunden aufs gemeinsame Regredieren, bevor man am nächsten Morgen an den nächsten Mord geht, den heutzutage indirekt, qua Ökonomie, begangenen. Deshalb wirkt die Vorführung der Lynch-Mentalitäten nicht einmal mehr wie ein vorgehaltener Spiegel, denn sie gehören zum gemeinschaftlichen Regreß ganz gemütlich dazu. 
Ich habe also große Vorbehalte. Sie sind aber ungerecht. Denn das, wozu Puccini schließlich wurde (und Wagner noch viel schlimmer), ist gar nicht Bestandteil seiner Komposition, über die ausgerechnet der puristische Anton Webern schrieb, „von durchaus ganz originellem Klang. Prachtvoll. Jeder Takt überraschend. Ganz besondere Klänge. Keine Spur von Kitsch.“ So zitiert ihn Norbert Abels. Und tatsächlich wird der Eindruck ein anderer, wenn man Puccinis Musik nur hört. Da entfaltet sich ihr Genie nach wie vor. Daß eine Aufführung – jede, die ich bisher sah -, es nicht mehr in die Welt bringt, auch nicht Christof Loys über weite Strecken radikal „wahre“, liegt daran, daß wir, die wir im Publikum sitzen, schon an die Existenz derart einfacher Menschen nicht mehr glauben können, und das wiederum liegt daran, daß nicht solche einfachen Menschen den Saal und die Ränge füllen; einfache Menschen gehen eben nicht mehr in die Oper, sondern hören Schlager und Pop – sie sind der manipulativsten Zurichtung hörig, die jemals der Musik geschah, und zwar weit über alle wagnerschen und/oder puccinischen Willen zur emotionalen Packung des Menschen hinaus. Wenn wir, die wir in der Oper sitzen, Puccini „glauben“ wollen, müssen wir eine Spaltung vornehmen – dessen, das wir wissen, bzw. permanent überfließend und kaum mehr bearbeitbar erfahren, von dem, was vielleicht einmal – aber selbst da bin ich skeptisch - unser inneres Kind war. Dabei läßt es sich auch – in globaler Hinsicht – gar nicht mehr von „Erniedrigten und Beleidigten“ sprechen, weil diese in Bezug auf andere Ethnien längst selbst die Erniedriger und Beleidiger sind – jede Socke, die wir kaufen, kann uns dazu machen. In Loys Inszenierung wird das auch ein bißchen klar – am Beispiel des alten Indianers nämlich, der stumm in dem Salon – durchaus symbolisch zu nehmen: – an der Wand steht. Um so bitterer dann – und schüttelt man die Vergeblichkeit ab, dann kann es einen wütend machen -, wenn ihn der Regisseur im zweiten Akt auch noch veralbert. Indessen das halbe Frankfurter Publikum lacht – der, mit Nietzsche gesprochen, feine Geist hört darin denselben Motor, der wie im Saal den Hohn auf der Bühne den Lynchwillen antreibt. - Wohlgemerkt aber: alledie sind Erniedrigte und Beleidigte selbst, die ihre Not an den noch tiefer Stehenden abreagieren. Loy mußte die beiden Indianer, den alten Mann und seine werdende Squaw, nur jeweils die Hand heben und dazu „Hugh“ (in Frankfurt „Huck!“ gesprochen) sprechen lassen, und der Mechanismus rastete schauderhaft ein. Ein Regisseur muß so etwas wissen; also ist es intendiert. Unmittelbar sind wir selbst auf der rohen Stufe der desparaten Goldgräber angekommen – und bekommen gleich noch den Ablaß mitgeliefert, weil es doch Loy auf die all diesem Rohen unterliegende, eine „eigentliche“ Sanftheit gerade auch solcher Menschen ankommt: darauf, darzustellen, mit welcher Mildherzigkeit und welcher Bereitschaft, sogar ihre Gerechtigkeit anheimzugeben, sie alle ausgestattet seien – „eigentlich“ permanent, wären die Zustände nur nicht so roh. Dieses weiht die in der hörenden Wahrnehmung ungefilterte Emotionalität der Musik, der wir Heutigen nach über einhundert Jahren neuer Hörerfahrungen die Dissonanzen gar nicht mehr anhören, mit denen Puccini wohlweislich operiert hat. Nein, wir hören nur den Schmelz. Dabei kann man diesen Komponisten trotz und vielleicht auch wegen seines Schmelzes mit allem Recht für einen der modernsten Tonsetzer seiner Zeit begreifen; im Einakter „Il tabarro“ schreckte er auch davor nicht zurück, sinnvoll Autohupen einzusetzen, um dem Realismus der Szene so deutlich wie möglich Gestalt zu geben, bzw., um das romantheoretisch auszudrücken: für das Primat des Erzählten. Es bleibt bei ihm so einfach, wie es ist; ja, wenn man ein wenig den Kopf wendet und kritisch-nichtnegativ hinhört, also ohne die theoretische Distanz des Intellektuellen, dann sind hier selbst die losgelassensten Gefühlsaufwallungen genau das, was sie sind: nämlich das, als was sie von den Protagonisten empfunden werden.
Schicksalshafterweise, so bin ich zu schreiben versucht, funktioniert das aber nur noch o h n e die Szene, und zwar auch dann, wenn Loy in geschicktem und sinnlich ausgesprochen plausiblem Rekurs auf den Wildwest-Stummfilm (schwarzweiß und ungefähres, weil konturweich verwischtes Bild, das überdies mit leichten, durch quasi die Drehkurbel bewirkten Verzögerungen die Projektion zur realen Szene ergänzt); geschickt besonders deshalb, weil dieses Stilmittel einerseits in eine Art Vorzeit distanziert, aber gleichzeitig über unsere Vertrautheit mit der Geschichte des Films eine ganz besondere Nähe herstellt, und weil er, Loy, dieses Mittel nicht durchgängig einsetzt, sondern, quasi seriell, immer wieder wie eine Erinnerung-selbst.  Doch die Hoffnung, die industrielle Zurichtung dadurch rückgängig zu machen, von der ich oben erzählte, es seien ihr vor allem Wagners und Puccinis Musiken bis heute ausgesetzt worden, diese Hoffnung geht ins Leere. Sie wurden vielmehr zu Schmiermitteln des Machtinteresses und sind Leni Riefenstahls faschistischer Ästhetik direkt vorläufig, was besonders für Puccini schlimm ist, eben weil ihm eine Menschlichkeit eignet – die musikalische Empathie, die der Boden seiner vorgeblichen Sentimentalität ist – , die dem Ideologen Wagner fast rundweg abgeht. Aber beide haben es nicht intendiert, auch wenn wir noch nach seiner Renovierung das Bayreuther Festspielhaus, worin die Musik aus dem Off kommt, als das erste Lichtbildtheater der Weltgeschichte begreifen und erkennen können. Ohne Wagner und ohne Puccini gäbe es kein Hollywood, jedenfalls keines, das so ist, wie es ist und sich an diesen beiden – aus den von ihnen abgezogenen Klangmodulen - nach wie vor auf das schamloseste bedient. Es gehört in dieselbe Dialektik, daß aber das -genau dieser Umstand - Puccini nach wie vor die Hörer sichert, für die und aus deren Lebenswelten er seine Opern schrieb – nur wissen sie es nicht. Denn, wie gesagt, sie meiden die Oper. So daß das Schicksal der puccinischen Erniedrigten und Beleidigten allein noch der illustrativen Ergötzung von, hätte man früher gesagt, Pfeffersäcken dient. Genau darum wird Puccinis empathisches Sentiment zum Kitsch, und genau das macht mir das schlechte Gefühl bei quasi, außer der Turandot, jeder seiner Opern. Genau darum lohnt sich aber die Beschäftigung mit ihnen so sehr und wird, wie bei Wagner, nicht aufhören: Was die ihnen verbundenen modernen Regisseure treibt, ist nichts Geringeres als ihre Erlösung von dem, was Adorno den industriellen Verblendungszusammenhang genannt hat.  Deshalb ist es zugleich konsequent, wie es ihn auch ehrt, daß Christof Loy nicht den allereinfachsten aller Regiewege ging, nicht den der ironischen Brechung, die sich was feixt, noch den einer abstrakten Überhöhung, sondern daß er tatsächlich bei der Geschichte, einer Geschichte der einfachen Menschen, bleibt – egal, ob die Musik – das ist ihr eigentliches Skandalon – auch Folterern und Mördern die tiefe Gewißheit verleiht, daß sie gute Menschen seien, was bekanntlich nach den Greueln und Barbareien des Zweiten Weltkriegs viele Komponisten tonalen Harmonien nur noch mit höchstem Mißtrauen begegnen ließ. So daß sie von den, sagen wir einmal, Utopien des erfüllten Wohlklangs Abschied nahmen, was wiederum zu einer rein noch intellektuell erfaßbaren Spröde geführt hat und deshalb zur Abwesenheit menschengemäßen Lusterlebens – >>>> Allan Pettersson hat sogar von „unmenschlich“ gesprochen -, so daß gerade die sogenannte Neue Musik nahezu alle Hörer an die manipulierende Industriemusik verlor, gegen die man doch für die Menschen ein endlich Wahres setzen wollte. Lange Zeit galt gerade Puccini für einen, dessen Pathos einem solchen Wahren reaktionär entgegenstand. Vielleicht können erst wir Heutigen begreifen, da die ästhetischen Grabenkämpfe im Sumpf der Geschichte versanken, daß das seinerseits ein unmenschliches – also unwahres – Urteil war, egal, zu was die Verblendungsindustrie diese Musik hat handhabbar gemacht und ob sie auch jene lieben, die Guantánamo verantworten müßten, würden sie denn je vor ein Gericht gestellt.  Loys einfacher - den einfachen Menschen, weil er ihn ernstnimmt - liebender, ihn eben nicht ironisierender, gar abtuender Blick bleibt auch deshalb der Szene als einem Bild der Erzählung verpflichtet; so auch Murauers Bühne und Kostüme. Dabei wird der Saloon zu einem geschickten Passepartout, weil er zugleich seine eigene, eine Nut&Feder-hölzerne Außenwand sein kann; eine Tür öffnet den Blick in ein rotbrokatnes Sälchen für den ganz zu Recht berühmten Walzer, den die Männer lediglich summen, bevor er ihnen wie ein instrumentales Zwischenspiel vom Orchester gleichsam abgenommen wird. Doch schon, als das Heimwehlied, erst hinter der Bühne gesungen, dann nach vorne geholt, erklingt, wird selbst das, daß einer von seinem armen, weil in der Heimat verbliebenen Hund singt, nicht lächerlich gemacht – auch wenn an sich dies und nicht etwa die „Hugh“s der beiden Indianer Grund für Gelächter gewesen wäre. Nein, der Mann fühlt wirklich so. Kein Grund mithin, sich über seine Sehnsucht zu erheben. Aber ich zuckte schon mal kurz - es zuckte.
Auch die sich bisweilen geradezu übergangslos ineinanderstürzenden Stimmungsschwankungen der Männer, von Mitleid zu Grausamkeit, vom gemeinsamen Gebet bis zur Mordlust, ja bis dahin, daß sie als Pennäler die Schulbank drücken, und Minnie unterrichtet sie, bleibt als Erzählung zugleich glaubhaft wie sie das Ungenügen an solch einer retardierten Lebensform ausdrückt, deren Begehren und Begierden nach wie vor das Fundament des derzeit sowohl ökonomisch wie militärisch mächtigsten Staatenverbundes unserer Erde sind – im Keller bleibt der Genozid gestapelt, über dem sich der Wohnraum der Macht erhebt. Deutlicher läßt sich das nicht darstellen, als durch die Squaw, die zur Dienerin einer zwar herzensguten, aber möglicherweise viel einfacheren Frau herabsank, als sie selbst vor ihrer Niederwerfung gewesen. Daß Loy die Indianerszene danebenging, ist wirklich ein Jammer: Sie hätte die Quintessenz des gesamten Stückes sein können – eingeschlossen den „edlen Räuber“, der letztlich deshalb Räuber ist, weil er - anders als die beiden resignierten Indianer - seiner Enteignung, die eine seines Volkes war, nach wie vor Widerstand entgegensetzt und sei's nur, um wenigstens noch die eigene Familie ernähren zu können.
Eva-Maria Westbrock singt die Minnie – eine den Umständen nach resolute Erscheinung - mit sehr, ja fast ein wenig zu großer Stimme, nämlich gegenüber den Männerparts: Noch ein wenig mehr Druck, und die wären zu Mäuschen geschrumpft. Das macht sie auch gegenüber Ashley Hollands Rance und sogar Carlo Ventres Ramerrez unüberhörbar dominant, die ihr gegenüber beide, anderes als die übrigen Männer, nicht regredieren dürfen – Rance nicht wegen der ihm eigenen Brutalität, Ramerrez nicht wegen seiner Zartheit unter der rauhen Schale; der Stücklogik nach muß seine Zartheit der ihren, Minnies, entsprechen; deshalb eben erkennen sie einander, und deshalb erkennen's die Mannskinder an ihnen. Genau deshalb lassen sie sie ziehen, indessen der unerbittliche, haßerfüllte Rance in Minnies Kämmerchen quasi eingesperrt und am Ende der Oper aus der Szene geschoben wird und damit aus der Gemeinschaft gewiesen. Daß er nicht verzichten will, macht ihn billig, daß sie verzichten, wiederum, die einfachen Menschen edel, eben weil sie fortan ohne Minnies Erscheinung leben müssen, die ihnen ein fast transzendentes Versprechen gewesen, und mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit verrotten werden. - Wäre ich an Loys Stelle gewesen, übrigens, und wäre ich an Sebastian Weigles Stelle gewesen, dann hätte ich hier, am Ende dieser Oper, tatsächlich einmal in die Partitur eingegriffen: nämlich die Wiederholungen von Rances und Minnies irgendwie falsch-heldischem Addio zumindest ganz am Ende gestrichen und die Klangszene allein dem Trauern des Chors überlassen, weil er ja nun wirklich allein ist und es bleiben wird, und weil schon das Libretto hier lügt: in seiner Verklärung der „schneebedeckten Berge der Sierra“ - die und deren vorherige Bewohner, soweit man die am Leben ließ, doch für nichts anderes dawarn, als für die erbarmungslose Ausbeutung eben durch die Erniedrigten und Beleidigten selbst und dann schon durch diejenigen, die all dies mit Infrastruktur und Geschäft so richtig flüssig machten. Insofern hier, und nur hier, Libretto und Musik tatsächlich den Verblendungszusammenhang affirmieren, wird das Utopische einer freien Menschlichkeit desavouiert, um das es Puccinis Oper geht.
Vorzüglich und leidenschaftlich musiziert das Frankfurter Opern- und Museumsorchester unter Sebastian Weigle, der sich einmal mehr als ein durchaus würdiger Nachfolger des großen Georg Soltis erweist: Er dirigiert mit durchaus vergleichbarer Glut, auch wenn das nicht alle Sänger trägt, bzw. stützt. Man merkt da die Schule, die ihn geprägt hat. Noch hat er nicht Barenboims Macht, die unter den großen Sänger:inne:n der Welt einfach auswählen kann. Das hat auch Vorteile, solche der Darstellung etwa; wie so oft kann die Beschränkung Conditio für das Meisterhafte sein. Notwendig freilich ist das nicht - hinreichend aber auffallend oft.  ******* *******
Giacomo Puccini
>>>> LA FANCIULLA DEL WEST
Oper in drei Akten. Text von Guelfo
Civinini und Carlo Zangarini.
Regie
Regie Christof Loy - Szenische Leitung Anna Tomson - Bühne und Kostüme Herbert Murauer
Licht Bernd Purkrabek – Video Hobi Jarne, Nils Fridén, Emil Gotthard – Choreografie Thomas Wilhelm
Produktionsdramaturgie - Yvonne Gebauer - Dramaturgische Betreuung Norbert Abels - Chor
Matthias Köhler
Eva-Maria Westbroek - Ashley Holland - Carlo Ventre - Peter Marsh - Alfred Reiter - Simon Bailey - Michael McCown - Bálint Szabó - Sungkon Kim - Hans-Jürgen Lazar - Beau Gibson - Nathaniel Webster - Björn Bürger - Carlos Krause - Elisabeth Hornung - Franz Mayer - Cheol Kang - Francisco Brito
Chor der Oper Frankfurt - Frankfurter Opern- und Museumsorchester
Sebastian Weigle
Die nächsten Vorstellungen:
16.05.2013 | 19.05.2013 | 24.05.2013 | 30.05.2013 |
02.06.2013 | 09.06.2013 | 12.06.2013 | 15.06.2013
>>>> Karten. albannikolaiherbst - Samstag, 15. Juni 2013, 23:59- Rubrik: Oper
|
|
Für Adrian Ranjit Singh v. Ribbentrop,
meinen Sohn.
Herbst & Deters Fiktionäre:
Achtung Archive!
DIE DSCHUNGEL. ANDERSWELT wird im Rahmen eines Projektes der Universität Innsbruck beforscht und über >>>> DILIMAG, sowie durch das >>>> deutsche literatur archiv Marbach archiviert und der Öffentlichkeit auch andernorts zugänglich gemacht. Mitschreiber Der Dschungel erklären, indem sie sie mitschreiben, ihr Einverständnis.
NEU ERSCHIENEN
Wieder da - nach
14 Jahren des Verbots:
Kontakt ANH:
fiktionaere AT gmx DOT de
E R E I G N I S S E :
# IN DER DINGLICHEN REALITÄT:
Wien
Donnerstag, 30. November 2017
CHAMBER MUSIC
Vorstellung der neuen Nachdichtungen
VERLAGSABEND >>>> ARCO
>>>> Buchhandlung a.punkt
Brigitte Salandra
Fischerstiege 1-7
1010 Wien
20 Uhr
NEUES
Die Dynamik
hatte so etwas. Hab's öfter im Kopf abgespielt....
Bruno Lampe - 2018/01/17 21:27
albannikolaiherbst - 2018/01/17 09:45
Zwischenbemerkung (als Arbeitsjournal). ...
Freundin,
ich bin wieder von der Insel zurück, kam gestern abends an, die Wohnung war kalt, vor allem ... albannikolaiherbst - 2018/01/17 09:38
Sabinenliebe. (Auszug).
(...)
So beobachtete ich sie heimlich für mich. Zum Beispiel sehe ich sie noch heute an dem großen Braunschweiger ... Ritt auf dem Pegasos...
Der Ritt auf dem Pegasos ist nicht ganz ungefährlich,...
werneburg - 2018/01/17 08:24
Pegasoi@findeiss.
Den Pegasus zu reiten, bedeutet, dichterisch tätig...
albannikolaiherbst - 2018/01/17 07:50
Vom@Lampe Lastwagen fallen.
Eine ähnliche Begegnung hatte ich vor Jahren in...
albannikolaiherbst - 2018/01/17 07:43
findeiss - 2018/01/16 21:06
Pferde
In dieser Nacht träumte ich, dass ich über hügeliges Land ging, mit reifen, dunkelgrünen, im Wind raschelnden ... lies doch das noch mal
dann stimmt auch die zeitrechnung
http://alban nikolaiherbst.twoday.net/s tories/interview-mit-anady omene/
und...
Anna Häusler - 2018/01/14 23:38
lieber alban
sehr bewegend dein abschied von der löwin, der...
Anna Häusler - 2018/01/14 23:27
Bruno Lampe - 2018/01/11 19:30
III, 356 - Merkwürdige Begegnung
Seit einer Woche war die Wasserrechnung fällig und ich somit irgendwie gezwungen, doch noch das Postamt ... Bruno Lampe - 2018/01/07 20:34
III, 355 - … und der Gürtel des Orion
Epifania del Nostro Signore und Apertura Staordinario des einen Supermarkts - Coop. Seit dem ersten Januar ... Bruno Lampe - 2018/01/03 19:44
III, 354 - Neujahrsnacht e dintorni
Das Jahr begann mit einer unvorgesehenen Autofahrt bzw. mit der Gewißheit, mir am Vormittag Zigaretten ... albannikolaiherbst - 2018/01/03 15:16
Isola africana (1). Das Arbeitsjournal ...
[Mâconièrevilla Uno, Terrasse im Vormittagslicht
10.32 Uhr
Britten, Rhapsodie für Streichquartett]
Das ...
JPC

DIE DSCHUNGEL.ANDERSWELT ist seit 4968 Tagen online.
Zuletzt aktualisiert am 2018/01/17 21:27
IMPRESSUM
Die Dschungel. Anderswelt
Das literarische Weblog
Seit 2003/2004
Redaktion:
Herbst & Deters Fiktionäre
Dunckerstraße 68, Q3
10437 Berlin
ViSdP: Alban Nikolai Herbst
HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Der Autor diese Weblogs erklärt hiermit
ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen
Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle
und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft
der gelinkten/verknüpften Seiten hat der Autor keinerlei Einfluss.
Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten
aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung
verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb
des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für
Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Gästebüchern,
Diskussionsforen und Mailinglisten, insbesondere für Fremdeinträge
innerhalb dieses Weblogs. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen,
haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde,
nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung
lediglich verweist.
|