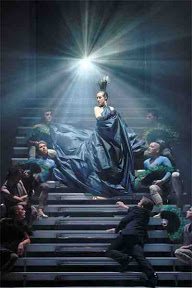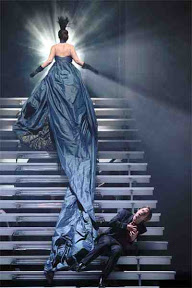|
|
Oper
 Nun also geht es los mit einem der kunstästhetisch spannendsten Festivals in Berlin: dem Infektion mit Ausrufezeichen benannten für neues Musiktheater. Wir werden sehen (und vor allem hören), welche Richtung „das Kunstwerk der Zukunft“ momentan nimmt. Davon einen kleinen, vermutlich aber nicht repräsentativen Eindruck vermittelten seit heute am frühen Mittag zwei Proben, zu denen Pressevertreter - aber ich auch, der alles andere als ein Vertreter der Presse ist; da ich dennoch über das Operntheater schreibe, nenne man mich also einen, auch, Musikschriftsteller, schöner noch einen „homme de lettres de la musique“ (doch was das sei, versteht keiner mehr) - - zu denen und zu den kleinen Gesprächen wir also geladen waren, die teils vorher, teils nachher stattfanden, mit den beteiligten Komponisten, Arrangeuren, Dramaturen, sowie dem derzeitigen Intendanten der Staatsoper, Jürgen Flimm.  Gleich zu Beginn, im Gläsernen Foyer des Schillertheaters, die heikle Situation für das Regieteam: nicht nur ließ die Probenwirklichkeit die Aufführung eines wenigstens annähernd repräsentativen Teiles nicht zu, überdies hatte Michael Boder, der eigentlich vorgesehene musikalische Leiter, der auch schon viel Arbeit investiert hatte, plötzlich ins Krankenhaus gemußt, und fliegend hat Johannes Kaltizke das schon insofern sauschwere Dirigat übernommen, als zugleich zwei Orchester, ein improvisierendes Trio sowie ein oft, wurde erklärt, hinter der Bühne singender Chor zu führen seien, und ebendieser Herr Kalitzke konnte am heutigen Tag nicht; deshalb war die Staatskapelle schon daheim. Geblieben war allein die Akademie für Alte Musik, und also probte man Purcell-Parts. Von dem, was Oehrings eigene Musik ist, bekamen wir nahezu gar nichts mit. Ich hatte indes eine Idee, fragte nach; es war ein bißchen bizarr, wie schroff der ansonsten außerordentlich freundliche und gesprächsoffene Mann entgegnete: „Ich schreibe keine dissonante Musik!“ Als hätte er „Apage, Satanas!“ gerufen. Wozu er dann moderierend ausführte, es wäre absurd, wenn ein heutiger Komponist nicht die musikalischen Entwicklungen von der Vergangenheit bis heute mit verarbeiten würde – hier nun bezogen auf Purcells The Fairy Queen, die auch tatsächlich Thema – mehr metaphorisch allerdings, hatte ich den Eindruck, denn konkret. Es ging im Gespräch auch ein bißchen durcheinander, was denn Surrealismus sei; ich zucke, wenn ich Shakespeares A Midsummer Night's Dream surreal genannt werden höre. Das Stück kennt zwei Realitäten; anders als in der surrealen Ideenwelt sind aber beide nach konkreten Gesetzen strukturiert; Oberon mag zaubern können, doch seine Zauberei ist immer auch bedingt, d.h. von Gesetzen abhängig. Dennoch, wie – und auch, indem es auf dieser Probe noch mißlang – Oehring drei Lieder von Purcell zur sich drehenden Bühne übereinanderlegt, ist von großem Reiz, zumal diese, die Bühne, ein geradezu naturalistisches Wohnungsszenario zeigt: das geht bis zu dem matten Fenster im Flur.  An sich mag ich so etwas gar nicht mehr sehen: hier aber, durch die simultanen Musiken, deren Tonalität sich im Collagieren auflöst, gewinnt es eine enorme Strahlkraft, und zwar dies, obwohl die Lichtregie noch gar nicht funktionierte; es würden, wurde erzählt, Videos dazuprojeziert. Das kann schiefgehen, ja, aber es kann auch von rasender Kraft sein. Am 16., also übernächsten Sonntag, wird man es sehen – ich selbst leider nicht, weil ich dann nicht in Berlin sein werde; aber ich werde nach der zweiten Vorstellung am 19. berichten. Noch weniger läßt sich bislang über Claus Guths Regie sagen, der das Stück – als bereits gemeinsames viertes – mit Helmut Ohring konzipiert hat. Er vermittelte immerhin den Eindruck einer unaufgeregten und visionorientierten Seriosität, irgendwie das Gegenteil der inszenatorischen Wildheit Calixto Bieitos.  Als tatsächlich problematisch empfand ich das zweite vorgestellte Stück, Falk Richters, der da auch Regie führt, For the Disconnected Child; aufgeführt als Zusammenarbeit mit der Berliner Schaubühne eben dort. Einige Presseleute wurden mit zwei Minibussen hinübergefahren, ich nahm mein Rad und hatte, draußen vorm Café, gut Zeit, noch einen Cigarillo zu rauchen und mich von der Sonne bescheinen zu lassen. - Nach mir zuerst, ebenfalls mit dem Fahrrad, kam der Pressesprecher Johannes Ehmann an, sah mich, grinste und sagte: „So muß das sein.“ Ich fand nicht die Gelegenheit, ihm zu erzählen, daß ich mir dies SoSein geradezu herausgeschnitten hatte, nämlich aus den >>>> ArgoFahnen, und nun wirklich glücklich war, das fünf Minuten lang genießen zu können. Denn schon waren die andern da: Nicht unwitzig, wie sie den Büslein entstiegen; 's ist ebenfalls nicht ohne Witz, daß sich Herr Flimm im Smart, so vernahm ich, hatte herfahren lassen, für den eigens ein Parkplatz auf dem Innenhof der Schaubühne reserviert worden sei.
Er – Flimm, nicht der Smart – hatte denn auch das erste Wort, als wir nunmehr drinnen saßen. Wie wunderschön es sei, wieder hier zu sein, sagte er, und daß sein Herz zwar für die Oper, doch auch noch für das Schauspiel schlage. Es waren die Worte eines Mannes, der zurückblickt: seltsam nostalgisch für einen Regisseur der Gegenwart, sehr menschlich, sogar berührend, aber ohne Interesse für jemanden, den die Zukunft interessiert und das Vergangene insofern, als es in diese Zukunft zu führen, mitzuführen sei. Von anderem Schlag dann, völlig anderem Schlag, Falk Richter. Ich würd ihn einen Jungdynamiker nennen: gut gekleidet, aber lässig, Sportschuh an den Füßen, Chucks, wenn ich mich richtig erinner; auch Flimm war mit sowas erschienen. Auch das Bühnenbild des Stücks könnte „typischer“ sein, für Schaubühne und des Regisseures Erscheinung: höchster technischer Standard, laufende Rückprojektionen, die auch direkt szenisch werden können usw.  Das ist viel Glanz, aber nicht wirklich aufregend. Auch die Musik ist nicht aufregend, wenngleich sich manche Hörerfahrung machen läßt: etwa daß zu einem Schubertlied, das der Bariton - Gyula Orendt - gnadenlos schön vortrug – bitte, geben Sie mit dem ganzen Zyklus ein Konzert, ich buch schon jetzt die Karten... - daß zu diesem Lied also mit Gestampfe, Reiben an Vittelflaschen und einer Art Bierkasten, die jemand wie seinen Kopf immer wieder an die Wand knallt und dran herunterknartaschen läßt, perkussioniert wird, was als eine Störung des Liedes gemeint ist, es vielleicht sogar zerstören soll; aber erreicht, ich merkte das im späteren Gespräch auch an, wird das Gegenteil. Denn Schuberts Lied klagt über Nichterfüllung, und genau das wird in dieser Szene laut. Schubert kommt durch die Störung deshalb zu s i c h, die leidende Seele gewinnt hier mehr Kraft, als sie es auch nur entfernt in einem „klassischen“ Konzert könnte, worin sich alle längst auf das Tränchen geeinigt haben, das man sentimentalkokett am Revers trägt; man betrachtet es als einen Diminutiv, den man zu den Geschäftzeiten ganz kommod vergißt. Hier wird das Tränchen nicht nur Träne, sondern ein klagendes Meer. Ganz toll. Ich frage mich allerdings, und fragte das auch Richter, wieso die zeitgenössische Musik dabei so untergehe; das war nicht ganz so stark, aber ähnlich, in dem ersten Stück, das wir hörten, durch das immer wieder Puccini drang. Als ich fragte, mit welchem Konzept die Musiken denn collagiert worden seien, war die Antwort insofern ein wenig dünn, als sie für den Puccini auf den Komponisten abstellte, ohne zu realisieren, daß wir es so mit einer schlechten Verdopplung zu tun haben, wenn der Komponist dem Regisseur, was der tut, vorhertut.
Für ästhetische Fragen blieb aber nicht wirklich Raum, geschweige, sie ernstlich zu diskutieren. Ich hatte auch den Eindruck, sie interessierten die Presseleute nicht; jedenfalls nahm niemand die Steinchen auf, die ich warf. Vielleicht aber einfach deshalb, weil sich aus dem Gesehenen und Gehörten nur in höchst relativer Weise Schlüsse auf das Gesamtergebnis ziehen lassen; man müßte denn mit sehr viel künstlerischer Fantasie begabt sein und sie überdies verwundbar machen, indem man sie zeigt, sie sozusagen vor die anderen hinwirft. Mag sein, daß so etwas mit Recht nicht als journalistischer Akt empfunden wird. Egal.  Das Problem des übrigens perfekt inszenierten Ablaufs ist, aus meiner Sicht, die doch recht beliebig erscheinende Kombination der Musiken, strukturell beliebig, meine ich, nicht etwa im Effekt. Aber der, eben in seiner Perfektion, drängt sich vor – durchaus auch mit Witz, etwa bei dem Monolog eines jungen Mannes an die Begehrte, worin er mit ihr bei Besuchen Neuer Musik „seine Hörgewohnheiten erweitern“ will. Das ist, seitens Richters, ganz sicher Ironie, und ich mußte auch auflachen einmal – aber sie wird bizarr, wenn man bedenkt, daß das, woran das Ohr „gewöhnt“ werden soll, nahezu einhundert Jahre alt ist und seinerseits längst Geschichte schrieb – von Webern bis Dallapiccola und weit noch darüber hinaus. Die Wahrheit ist nämlich anders: Wie kriegen wir wieder den Kitsch aus den Ohren, mit dem sie die Kulturindustrie zugestopft hat, an der wir aber alle irgendwie hängen, und zwar gern und willentlich. Wir sind durch sie sozialisiert. Genau das wird von solchen, ich sag mal Arrangements, gespiegelt. Dabei sind die Einzel- und Ensembleleistungen meist enorm, auch hier steht bisweilen die Wirkung vor der Seele.
Gar nicht, allerdings, bei der Tanzeinlage, die ich vorhin sah. Das war groß. Dieses Paar, das von der ersten Verliebtheit über den Kuß, das intime Beisammen zum Streit, ja zur Szene, die man sich durchaus gewaltsam macht, bis hin zum erschöpften aneinander Niedersinken, Embryonalhaltung er um sie, - dieses Paar macht einen Besuch der Premiere – 14. Juni – geradezu nötig. Zudem sind meine nachdenklichen Bemerkungen sämtlichst ausgesprochen ungesichert, lediglich abgeleitet von dieser Probe. Die Premiere wird ein völlig anderes Stück zeigen können, als ich aufgrund eines zudem unfertigen Ausschnitts sah. In jedem Fall wird es tüchtig Anlaß zu diskutieren und darüber zu reden geben, was das Kunstwerk der Zukunft denn werde, vielleicht ein bißchen auch schon sei. In zwei Wochen werde ich erzählen: vom 19. bis 24. Juni jeden Abend von einem anderen Stück.  INFEKTION!
Festival für Neues Musiktheater
Staatsoper Berlin
Die Premieren:
-
Aschemond ODER The Fairy Queen
Von Helmut Oehring und Claus Guth.
Sonntag, der 16. Juni 2013, 10.30 Uhr.
(In der Staatsoper im Schillertheater).
- For the Disconnected Child
Von Falk Richter.
Freitag, der 14. Juni 2013, 20 Uhr.
(In der Schaubühne Berlin).
- Récitations
Von Georges Aperghis.
Donnerstag, der 20. Juni 2013, 20 Uhr.
(In der Werkstatt der Staatsoper im Schillertheater).
- Hanjo
Oper von Toshio Hosokawa.
Sonnabend, der 22. Juni 2013.
(In der Staatsoper im Schillertheater).
- Europeras 3 & 4
„Kompendium“ von John Cage.
Sonnabend, der 22. Juni 2013.
(In der Werkstadt der Staatsoper im Schillertheater).
>>>>Karten für die Staatsoper.
>>>> Karten für die Schaubühne.>>>> Infektion 2 albannikolaiherbst - Freitag, 7. Juni 2013, 18:51- Rubrik: Oper
[Fotografien (©): >>>> Hermann und Clärchen Baus.
Fotos im Saal, vorm TRAFO Berlin & am Schreibtisch: ANH/iPhone.]Zum ersten: Mit dieser Aufführung fand der Saal des Schillertheaters-als-Musikbühne zu sich.  Ja, es ist beinah nicht zu fassen, von welcher Eignung er sich plötzlich als ein wirklicher Klangraum erwies, nunmehr, mit diesem Stück, dessen orchestrale Besetzung doch denkbar ausgedünnt ist, so sehr, daß jeder einzelne Musiker genannt werden kann – und nach dieser Premiere auch sollte – , sieben Streichinstrumente und ein Flügel vor dem Dirigenten Franck Ollu: Lothar Strauß, Barbara Weigle, Yulia Deyneka und Matthias Wilke, Sennu Laine und Claire So Jung Henkel, Matthias Winkler, Sarah Tysman - - einfach nicht zu fassen, welch eine Klangfülle sich im Saal erhob, daß es wirklich auch laut werden konnte, mit der kompositorischen Einschränkung freilich, die Frank Martin niemals auftrumpfend werden, sondern immer geradezu vornehm gebunden sein läßt, dabei höchst konzentriert auf den Fluß des musikalischen FortGangs eines, der Auffassung des Mittelalters gemäß, unabänderlichen Geschicks, das sich in diesem Stück, in dieser hier tatsächlich Legende, erfüllt und wiedererfüllt. Nicht Überwältigung soll die von Martin doch durchaus gemeinte Klärung - Reinigung - der Hörer:innen bewirken, sondern ihr aufnehmendes, doch stets bewußtes Mitfließen und Betrachten; man kann, besonders in Katie Mitchells Inszenierung, von einem befreiten Brecht sprechen, vielleicht auch von einem um die Transzendenz erhöhten, in die das nicht im Ritual erstarrte, sondern noch empfundene Gebet finden will, da nämlich, wo es Meditation ist. Nur in diesem Sinn schreibe ich von einer kleinen Sensation; de facto ist es eine große, die aber „still für sich selbst“ ist, ginge es eben nicht um Musik, die laut wird und, bei Martin, sowohl Mär als Moritat ist. Der Komponist spricht davon, sie sei wie Kulissen eingesetzt; auch das verweist auf den epischen Charakter des Stücks und bedeutet, daß die Sänger:inn:en immer nur darstellen, nie aber sind, was sie darstellen, nie für immer („immer“ als die Dauer der Aufführung insgesamt verstanden). Genau so behandelt Mitchell sie in den Szenen auch:  Die Personen lösen sich aus dem beinahe antiken Chor, treten als jemand hervor, die und den die Allegorie des zu Geschehenen ergreift, durch den sie hindurchzieht, und treten in den Chor – die, quasi, „große Verbindung“ – wieder zurück, sowie ihr Geschick sich erfüllt hat. Deshalb gibt es weder bei Martin noch bei Mitchell eigentlich „Stars“, deshalb auch kann es im Publikum nicht zur Erschütterung kommen, nicht zur großen Ergreifung, schon gar nicht zu Tränen der Rührung – man muß denn diese Musik wieder und wieder und wieder hören, bis man tief in ihre Binnenstrukturen und das geradezu Verhängnisvolle ihrer Repetitionen eingedrungen ist; erst dann nämlich werden die Möglichkeiten arioser Großartigkeiten gespürt, die hinter denen, sagen wir, Wagners, Puccinis, Verdis nicht zurückstünden, wäre Martin denn deren Wege gegangen. Sie gehören aber nicht zu seiner Strenge; es bleibt an uns, sie zum Beispiel in den gestischen Beharrungen des Klaviers zu ahnen oder in den halb überlappenden Nachseufzungen der Streicher, mit denen sie Sangespartien von den Sängern gleichsam abnehmen und fortführen, nicht selten wie eine Levitation; kurz dringen sie hinein, klingen mit etwas Zögern wie ein paralleler Mit- und Untergrund, aber lösen den Sangpart schon ab, stehen singend, instrumental, allein, und oft übernimmt dann, aus ihren Händen, wieder der Chor.  Das ist, von den Zäsuren der jeweiligen Übergänge von Stück zu Stück, eine, auf seine Weise, a u c h unendliche Melodie, doch ohne irgend ein Auftrumpfen, ohne selbstbefeierndes, dem melodischen Einfall "da capo, da capo!" zujubelndes und ihn wieder- und wiederholendes Brusttrommeln eines genialen Gorillas, der den Nebenbuhler einschüchtern und davondrohen will, - aber auch ohne das Bohrende der bühnenpsychologischen „Analyse“, in deren Verlauf die schließlich von Alkohol und Selbstmitleid zerlösten Charaktere auf Klo Etiketten von Weinflaschen kratzen, will sagen: ohne jeden zersetzenden Exhibitionismus. Sondern Martins Musik wahrt die Entfernung und damit das Legendäre seines Stoffs. Ob wir uns selbst in ihm erkennen, ist an uns selbst gelassen. Wer sich auf diese Musik konzentriert, wer sich nicht von großen Gesten überwältigen lassen muß, sondern in die Binnenstrukturen des Klanges sinkt, dem eröffnet sich fühlbar eine ganz andere Gestik: Mitleid wird zur Tätigkeit, ist, kulturindustriell-kritisch gesprochen, keine künstlich erzeugte, um die Kassen zu füllen. Unter anderem daran liegt es, daß Frank Martin nicht das ist, was man einen wirklich berühmten Komponisten nennen kann. Und unter anderem deshalb wäre der gestrigen Premiere beinah die Champions League ein Unheil geworden; es hat, hörte ich, einige Anstrengungen gegeben, den Abend vor ihm zu bewahren.
Das gelang wahrscheinlich auch, weil Katie Mitchell in Berlin keine unbekannte Regisseurin mehr ist – seit dem der Staatsopernleitung selbst überraschenden, so berechtigten wie riesigen Erfolg ihrer >>>> Inszenierung von Nonos „Al gran sole“ im TRAFO, dem aufgelassenen Berliner Kraftwerk Mitte:  Spätestens seitdem, seit März 2012, wissen wir, daß auch sehr sperrige Stücke, die keineswegs den bequemen Hörgewohnheiten und -wünschen entsprechen, wahre Renner werden können, die dann leider, aus Gründen mangelnden Muts, bzw. durchaus berechtigter finanzieller Sorge viel zu früh abgesetzt werden. Freilich fehlt der Inszenierung des Vin herbé das Spektakuläre des Aufführungsorts; auch diesbezüglich bescheidet sich Martin, nicht ohne aber daß es sehr wohl Verbindungen gibt. Zwar verlegt Mitchell das Stück in ein seiner Entstehungs- und Uraufführungszeit (1942) entsprechendes Szenario, nämlich ein, erzählt der Programmflyer, kriegszerstörtes Theater, worin eine Aufführung eben dieses L Vin herbé geprobt werde, aber der Ort des Geschehens könnte ebensogut irgend ein kriegszerstörter französischer Salon sein; es spielt für die Darstellung ebenso wenig eine Rolle, wie daß „nur“ geprobt werde. Aber die Ästhetiken der Orte – dort die reale quasi musealisierte Ruine des ehemaligen Kraftwerks, hier das gebaute Bühnenbild – ähneln einander, und so ist Katie Mitchells Inszenierungs-Ästhetik imgrunde dieselbe. Das wird von dem Umstand unterstrichen, daß es sich in beiden Fällen um für das Handlungstheater modifizierte Oratorien handelt; Martin selbst stand einer szenischen Realisierung seines Stücks zeitlebens skeptisch gegenüber; keine, die er sah, habe ihn je überzeugt, teilt Uwe Schweikert im Programmheft mit. Hätte der Komponist Mitchells Inszenierung noch sehen dürfen, er hätte seine Ansicht ganz gewiß geändert. Denn wenn Mitchell ihr in ihrer Nono-Inszenierung doch manches szenisch zu grob, ja eigentlich unszenisch geriet, quasi gestische Agitation wurde, wird ihr chorischer Stil hier zu ständig neuen Tafelbildern, gleichsam menschlichen Stilleben, die fließend ineinander übergehen, und zwar mit den allereinfachsten Verwandlungsmitteln; eine quer über das Bühnemvordre gespannte, von zwei der Sänger gehaltene Leine wird zur Reling eines normannischen >>>> Nefs  , das Wehen des Haares im Wind wird von einem von einem Sänger gewedelten Kurzbrett bewirkt, und wenn das Schiff rollt, hebt man je seitlich den Tisch und senkt ihn wieder; der in den Achteln der Musik gemalten Dünung sekundiert der Chor mit langsamem Schunkeln; und daß das Stück eines um den Tod ist, zeigt ständig - und ständig simultan - der als ein zerstörter aufgebaute Bühnenraum. Wobei die Nähe von Bühne und Saal auch ganz feine Inszenierungsgriffe erlaubt, die Frau Mitchell hätte im Kraftwerk gar nicht umzusetzen können.
Plötzlich füllen sehr kleine Gesten ganze Minuten – und auch kleine Requisiten, um an das Spiel der Tücher zu denken, das sie hier von einem breiten gespannten Tuch als das Segel über das Tisch- und schließlich Leichentuch bis zu dem Tücherl durchdekliniert, das den Bräuten je als Hochzeitschleier über den Kopf gelegt wird – alle, alle in Weiß, das für Tristans Hoffnung steht, als er die Geliebte auf seinem Sterbebett erwartet. Und sie kommt auch, doch zu spät:  Es ist von einer ungeheuren Konsequenz, daß das schwarze Segel allein in der Behauptung von Tristans später Gattin Realität wird, also allein in seiner Fantasie. Da aber verlöscht – unmerklich geradezu; man ist schockiert, als es plötzlich fehlt – das Feuer, das in der Mitte des Bühnenhintergrunds allerzeit geflackert hatte: Erinnerung an die Kamine des Mittelalters, aber auch an die offenen Feuer der Kriegs- und Nachkriegszeiten, die in Blechfässern brannten, Sinnbild gleichzeitig des Überlebens wie der lohenden Liebe des Paars, das nun sein Dasein hinweggibt. Sein Leid war, daß es nie sein durfte, die Hoffnung aber, die es über all die Jahrhunderte bleibend vermittelt, daß es dennoch war.
Kaum ein schöneres Zeichen ist die Richard Wagner wahrscheinlich zu bescheidene, Frank Martin indessen nahe, weil grad in ihrer Märchenhaftigkeit strenge Sage, es sei, nachdem die Liebenden je zur Seite einer Apsis zu letzten Ruhe gebettet, aus Tristans Grab eine Brombeerranke hinüber zu dem der Isolde gewachsen, habe sich in es hineingesenkt und sei, trotz mehrfacher Versuche, es auszuroden, zu einem Buschgestrüpp gewachsen. Das ist auch formal streng; bereits im vierten Bild erzählt der Chor, Tristan sei nach dem Liebestrank gewesen, als hätte „ein wilder Brombeerstrauch mit spitzen Dornen und duftenden Blüten (…) seine Wurzeln in seines Herzens Blut“ versenkt; ein bißchen schade, daß das Programmheft nur die deutsche Übersetzung und nicht auch das französischsprachige Original des Librettos an die Hand gibt. Ich nehme an, das hat Urheberrechtsgründe, für die wie so oft ein Urheberwille nichts zählt; bei Nono waren das italienische Original und die deutsche Übersetzung noch zu vergleichen. Aber es gibt ja das Netz – Alors!: Il semblait à Tristan qu'une ronce vivace, aux épines aigües, aux fleurs odorantes, poussait ses racines dans le sang de son cœur et par de forts liens enlaçait au beau corps d'Iseut et toute sa pensées et tout son désir.Und am Schluß: Mais pendant la nuit, de la tombe de Tristan jaillit une ronce verte et feuillue, aux forts rameaux, auc fleurs ororantes, qui s'élevant par-dessus la chapelle, s'enfonça dans la tombe d'Iseut.Anders als Wagner bezieht sich Martin auf die „Urlegende“ Tristans und Isots, darin dem grandiosen „Faust“ Ferrucio Busonis ähnlich. Anders als Wagner deshalb wird die Zeit des wilden Lebens, nach der Flucht aus König Markes Burg, miterzählt, die Entbehrungen der Liebenden, die neben allen zu erwartenden Härten auch Entbehrungen der Liebe sind: gegen eine abermalige Vereinigung stehen Lehenstreue und Ehre; zwischen beiden, eine jede Nacht, liegt nicht nur trennend das Schwert, sondern auch die Gewissensnot darüber, unschuldig schuldig geworden zu sein. In dieser Phase zeigt sich einmal mehr die in ihrer Einfachheit geradezu geniale Fähigkeit der Regisseurin, die zuhandensten Gegenstände symbolisch und zugleich konkret verwandeln zu können: Sowohl die Flucht des Paars als auch Tristans Irrwege im Wald werden auf Stühlen vollzogen, über die man wie über Felsen, Baumstümpfe, klaffende Abgründe steigt.  Was allzu oft, und oft von mir beklagt oder verspottet, pure Bühnenmätzchen sind (meine Oma: „Das soll jetzt so was sein“), gerät unter Frau Mitchells Händen zu geradezu naturalistischen Innenbildern der gemeinten Szenen. Überhaupt nichts in dieser Inszenierung ist überflüssig oder nachlässig; es gibt rein keinen Einfall, der nicht aufs seelenhafteste direkt mit dem Stück verbunden wäre; nirgends, nicht einmal sekundenlang, drängt sich aufgesetzte Ideologie oder Meinung vor, alles wird aus der Musik und dem Libretto entwickelt – wobei es gerade deshalb ein kleines bißchen stört, wenn das Libretto davon spricht, Isolde habe ihren Arm auf Tristans Schulter gelegt, in der Szene legt sie aber die Hand auf; in diesen Zusammenhang gehört auch, daß Isolde „die Blonde“ genannt, Anna Prohaska, ihre Sängerin, aber dunkelhaarig ist; insofern nämlich die zweite Isolde, „die Weißhändige“, Tristans spätere Gattin, ebenfalls blond ist, geht eine Innenspiegelung der Erzählung verloren. Wirklich schlimm ist das selbstverständlich nicht, es sei denn, es mangelt einem an Imaginationskraft. Zumal wir mit ganz anderen, abermals leisen, fast zufälligen, Großartigkeiten mehr als nur entschädigt werden: etwa wenn es zur wie zufälligen ersten Berührung der Liebenden kommt. Sie legt eine ihrer Hände auf seinen Oberschenkel und er, geradezu unmerklich, deckt sie gleichsam schützend mit einer der seinen zu. So etwas, in dieser Diskretion, geht nur in einem Kammerspiel.  Später sinkt sein Kopf auf ihre Schenkel, und sie, das Mädchen, wird zur Mutter, die über sein Haar streichelt. Ebenso diskret-innig die ganze erste – und einzige – Liebesvereinigung der beiden, die, wie die „Mutter“szene, nahezu sexualfrei ist, obwohl ein Akt gezeigt wird. Jedes Moment eines gierigen Begehrens läutert sich nahezu sofort ins auf die Ewigkeit – und schon damit auf den Tod – zielende Zusammengehören – eine Auffassung, in der Frank Martins protestantische Prägung ebenso künstlerische Gestalt wird wie in seiner kompositorischen Strenge. Man muß das nicht mögen, den damit idealisierten Asketismus nicht mögen, um dennoch begreifen zu können, daß wahrscheinlich gerade dieses Element die Legende von Tristan und Isolde hat durch alle Jahrhunderte ebenso präsent bleiben lassen wie aus Platos Gastmahl den Kugelmythos.
In der Tat bewahrt die Idee der unbedingten und immerwährenden Vereinigung unsre tiefsten Kinderwünsche; damit hat sie Teil an der Kraft der Utopie. Genau das wird er gemeint haben, wenn Martin über seinen Tristan schreibt: „daß auch der Tod darin seinen Frieden bringe, nach all den Beglückungen und Ängsten der Leidenschaft“. Daß er von Frieden, nicht etwa von Erlösung spricht, hält sein Le Vin herbé von jeder ideologischen Weltverneinung frei. Unterm Strich wurde einfach eine Geschichte erzählt, die zum einen nicht auf dramatische Effekte fokussiert ist, sondern auf Sukzession; zum anderen hat die zeitliche Entfernung ihre Gültigkeit als Legende bewahrt. Genau das unterscheidet, trotz der Ähnlichkeiten im Prozeß der Distanzierung, Martin von Brecht. Le Vin herbé ist kein Lehrstück, sondern ist „reine“ Erzählung und seine Personen sind wie Treibgut, das die Wellen bisweilen an die Oberfläche des Lebensflusses spülen, aber auch schnell wieder in sich zurücknehmen – in die „große Verbindung“, von der ich zu Anfang geschrieben.  Das hat Konsequenzen für die Sänger:innen; so gleich zu Beginn für Katharina Kammerloher, die als Mutter Iseuts mit sehr großem weiten Ton anhebt, ihre Figur mit aller Präsenz ausstattend, die sich stimmlich und gestalterisch nur denken läßt. Aber sie bleibt flüchtig, hallt nur noch in der Erinnerung nach. Besonders formt es aber Iseut selbst, Anna Prohaska, von der eingangs der Aufführung, um witterungsbedingte Indispositionen der Sänger zu entschuldigen, der Ansager am Mikrophon von „unsrer süßen Anna Prohaska“ sprach, um die Präsenz dieses – ob vermeintlich oder nicht – zarten Publikumslieblings schon mal vorweg und ein bißchen, finde ich, übergriffig zu unterstreichen. Vielleicht lag es auch wirklich an dem grippalen Infekt, daß Frau Prohaska die durchsichtig strahlenden Höhen Sandrine Piaus nicht erreichen konnte, die man >>>> in dieser leider nur noch „gebraucht“ erhältlichen Aufnahme von 2006, der harmonia mundi, hören kann. Allerdings ist diese im Studio entstanden, konnte sich also auf das nur-Musikalische konzentrieren – eine völlig andere Arbeit, als wenn man es mit persönlich-bildlicher Gestaltung zu tun hat, abgesehen davon, daß live-Aufführungen im Moment ihres Werdens nicht nachgearbeitet werden können. - Doch die Rolle selbst ist - für Martins Ästhetik bezeichnend - sehr viel weniger herausgehoben, als der zugrundeliegende Mythos vermuten läßt; nicht von ungefähr gibt der Zaubertrank dem Stück den Namen; er wird eben nicht von den Hauptfiguren hergeleitet. Der einzige, dem wirklich Raum gelassen wird, sich als handelnde Person umfassend zu gestalten, ist der Tristan, in diesem Fall Matthias Klink, dessen Tenor auch sehr gute Kraft hat, aber in den Forte-Höhen manchmal ein bißchen nachgedrückt wirkte. Selbst das, selbstverständlich, kann das Ergebnis einer Tagesverfassung sein; es fiel mir wohl nur deshalb auf, weil Peter Gijsbertsen, der die kurze „Nebenrolle“ (wohlgemerkt, alle Sänger:innen sind alle Zeit auch solistisch im Chor präsent) des Kaherdins sang, am Bett des siechen Tristans unvermittelt schöner, lyrischer, fand ich, klang. Das ist, bitte, kein Urteil, sondern eine Geschmacksempfindung, der ich bei einem nächsten Besuch dieser Inszenierung noch einmal nachhören möchte. Denn sie gehört zu jenen, die man mehrfach hören und sehen sollte, schon deshalb, weil sich uns die ganze Weite dieser Musik, ihr fast kosmischer Reichtum, erst dann erschließen wird, wenn wir sie uns ebenso vertraut machen, wie es uns die großen Werke des vorletzten, vorvorletzten, vorvorvorletzten Jahrhunderts geworden sind: erst dann wird sie uns zueigen werden, und wir werden – zueigen i h r. Und sowieso gilt >>>> das dort. Denn darauf kommt es an, daß u n s die Dinge in sich nehmen. *******
Ach, es wäre so zu wünschen, daß die Programmleitung der Staatsoper, so lange sie noch im Schillertheater spielen wird – ein viel längres Interim, als geplant war -, nach weiteren Stücken Ausschau hält, die derart perfekt auf das Haus passen, das ein riesiges spätromantisches Orchester, so offen hörbar ist das, gar nicht will, sondern dem intimen Klang erlaubt, sich unvergeßlich zu entfalten. Auf Anhieb wüßt' ich sieben. Frank Martin
LE VIN HERBÉ
Ein weltliches Oratorium
Inszenierung Katie Mitchell Co-Regie Joseph W Alford
Ausstattung Lizzie Clachan Licht James Farncombe
Dramaturgie Katharina Winkler
Narine Yeghiyan - Anna Prohaska - Evelin Novak - Virpi Räisänen
Katharina Kammerloher - Stephanie Atanasov - Thorbjørn Gulbrandsøy
Matthias Klink - Peter Gijsbertsen - Arttu Kataja - Ludvig Lindström
Jan Martiník
Mitglieder der Staatskapelle Berlin:
Lothar Strauß - Barbara Weigle - Yulia Deyneka - Matthias Wilke - Sennu Laine
Claire So Jung Henkel - Matthias Winkler -Sarah Tysman
Musikalische Leitung Franck Ollu
Die nächsten Vorstellungen:
29. Mai,
1., 7., 9. und 13. Juni.
Je um 19:30 Uhr
>>>> Karten. albannikolaiherbst - Sonntag, 26. Mai 2013, 16:01- Rubrik: Oper
 „Ich habe noch nie eine derart ästhetische Aufführung gesehen!“ rief meine Begleiterin leise aus, als wir nach vier Stunden das Schillertheater verließen. „Die Kostüme, die Bühne, alles wunderwunderschön. Das einzige, was mir gar nichts gegeben hat, war die Musik.“ Wir gingen durch die Nacht zum X9er-Bus weiter. Ich grummelte in mir, schwieg noch. Denn hier war grundsätzlich etwas schief gelaufen. „Da muß mehr Schmutz rein“, hatte ich schon in der Pause gesagt, aber selbst noch nicht richtig erfaßt, was ich eigentlich meinte, sondern nur dieses Unbehagen verspürt: ein lästiges, das bohrte. Und das, dachte ich, bei Händel, einem musikalischen Meister der dramatischen Manier -
Schon zu Anfang, mit Agrippinas erster „verworfener“ Arie, kam mir alles zu dünn vor, auch zu entfernt, zu ziseliert darum, als hielte man sich einen Kanarienvogel mit Hitlerbart und lauschte verzückt seinem Singchen. Selbstverständlich war mir klar, daß dies nicht nur an den für Musik nicht günstigen Verhältnissen der Interimsbleibe der Staatsoper lag, also am Sprechbühnensaal des Schillertheaters, sondern eben auch an den alten Instrumenten und der für unsere, nicht aber die Ohren des seinerzeitigen Hörpublikums sehr diskreten Besetzungsstärke, der sich die Stimmvolumen der Sänger:innen anpassen müssen und sollten. Wir sind heute, mit unseren völlig anderen internalisierten Hörerfahrungen, eine zu mächtige, zu poppige Pathoskraft gewöhnt, als daß wir die Kammerraserei der Protagonisten dieser Oper noch als besonders exzentrisch oder exaltiert erleben könnten; vielmehr kommt sie uns, alleine schon dynamisch, wie die von Handpuppen vor. Genau dagegen muß eine Inszenierung sich sträuben, dagegen muß sie anarbeiten, wenn sie nicht Oper als historisiertes Divertimento bieten will, was man sich halt anhört als gute Bourgeoisie, um sich akustisch unaufgeregt und ein bißchen retro eincremen zu lassen, auf daß der liebe Gott der gute Mann auch bleiben kann, der er niemals war.  Aber wie denn? „Historisierend“? Nein. Denn abgesehen davon, daß die Akademie für Alte Musik stets darum bemüht ist, mit originalen Instrumenten und Nachbauten solcher Instrumente einen vergangenen Zeiten möglichst ähnelnden Tonraum zu füllen, zeigen Vincent Boussard und sein Team eine in Ausstattung und Bühne sogar ausgesprochen moderne Aufführung. Daran kann es also nicht liegen, daß nicht wirklich Kunst wird, ebenso wenig wie an dem einen und mehr noch dem anderen Mätzchen, zum Beispiel den Herumliegereien und -schiebereien auf und über den Brettern, ja, nicht einmal an der vor allem in den ersten beiden Akten losgelassenen Manier, die Leute dauernd gegen eine Wand oder an ihr entlang laufen zu lassen; das ist moderner Operngemeinplatz und allenfalls ein bißchen peinlich. Im Buffofach ist der Kalauer, den man auf der Bühne als Ulk kennt, durchaus akzeptabel; es lacht halt, wer mag. - Nein, das Problem liegt anderswo.
Meine Begleiterin hatte recht: Diese Inszenierung ist zu schön.  So wunderbar der Einfall mit dem hohen, die gesamte Bühnenbreite transparent vom Zuschauerraum trennenden, luftbewegten Vorhang auch ist, aus so feinsten Perlensträngen, daß sich darauf und durch ihn hindurch mit Lichtspielen arbeiten läßt, sei es durch direkte, sei es durch Rückprojektionen;
- wie klug auch immer, wenngleich seit Renaissance der Barockoper bereits Zitat-für-sich, also nicht wirklich ein Einfall, das Geschehen sich von der Hauptbühne herunter- und direkt vors Publikum spielen zu lassen, wo dann tatsächlich Leben in die Sache kommt; ins Publikum mitten hinein traut man sich dann aber doch nicht;
- und wie auch immer, vor allem, virtuos die Sänger:innen zu singen und darzustellen vermögen;
es wird nur ergriffen, wer es sich vorgenommen hat, es zu werden. Sowas setzt man dann gegen den wirklichen Eindruck auch durch, schon, weil René Jacobs dabei und weil die Akademie für ihre vorzüglichen Interpretationen berühmt ist und weil die Sänger:innen in der Tat auserlesen sind. Nicht also, daß der Kaiser wirklich nackt durch diese Inszenierung ginge. Nein, das tut er nicht. Sondern er hat, sozusagen, zu viel an, und nicht nur zu viel, sondern sich vor allem in der Garderobe vergriffen. Alles in dieser Inszenierung ist gekleidet, nämlich aufs edelste und nicht nur die Menschen. Gekleidet ist die Bühne, gekleidet sind die Wände, gekleidet ist der Vorhang, der eigentlich Kleid ist; selbst die bisweilen an Nordlichter erinnernden Lichtspiele sind Kleider, und Kleider, letztlich, sind die Gesten, sind die Gesichter und die Leidenschaften, die sie ausdrücken. Alles löst sich im Glamour auf, einem hochgemotzten und in nur-Glanz polierten immerschönen Schein – dem der Warenwelt. Boussards und seines Bühnenbildners Vincent Lemaires Agrippina huldigt genau dem: der Warenästhetik, die wir aus den Hochglanzmagazinen kennen. Die ist, logischerweise, bis in ihr Innerstes affirmativ. Denn sie kennt ein Innerstes nicht. Sie kennt nur Oberfläche. So wird die Agrippina an der Staatsoper zu einem Musical, das die Revue-Ästhetik des Friedrichstadtpalastes für den gebildeten Bürger umgeläutert hat. Man kann auch sagen, ist aber wahrscheinlich faktisch falsch: Die Eintrittskarten sind hier teurer; das rechtfertigt es auch für unsereins, intellektuell guten Gewissens hineinzugehen. Daß die Kostüme von Christian Lacroix designt worden sind, tut ein übriges für Akzeptanz. Der Mann, wurde mir erzählt, sei ein berühmter Modeschöpfer. Der Agrippina hilft das nichts. Ich dachte nur: Ui, dann ist das aber teuer.
Vielleicht hätte er, Lacroix, das gewußt; das Regieteam jedenfalls wußte es nicht, das, was jeder Modefotograf schon gleich zu Anfang lernt: Man inszeniert so etwas nicht in den Beletages. Wirklich zur Geltung kommt Glamour nur vor Abriß. „Der Mond in der Gosse“ heißt ein großer Film Jean-Jacques Beineix'. Wo alles schöner Schein ist, nehmen wir auch das wirklich Schöne nicht mehr wahr.
Sogar das aber wäre noch akzeptabel - weshalb sollen sich Leute nicht gedankenlos vergnügen? -, rührte nicht Boussards Konzept an die Musik selbst und an die Inhalte dieser Oper.
Sie ist nämlich satirisch und kritisch, ja die Oper der schlechten, willentlich schlechten Charactere schlechthin. Jede geplante und erreichte Bosheit, auch Unmenschlichkeit, hält man sich hier als Tugend der Persönlichkeit zugute. Das wahrscheinlich von einem beim Vatikan in Ungnade gefallenen Geistlichen geschriebene Libretto, das aufs enthüllendste die Mechanismen der Macht teils in den Blick nimmt, bewundert sie nämlich auch. Das ist nicht ohne Macchiavell und teilt sich mit dem Volk in seiner Freude über gelungene Gesetzesübertretungen – ein durchaus italienischer und auch katholischer Mentalitäts-Umstand, der einem zum Beispiel heutzutage Berlusconi begreiflich macht. Dieses wäre mit der Agrippina herrlich nachzuzeichnen gewesen, pervers herrlich, selbstverständlich. Statt dessen haben wir es den ganzen Abend über mit dem Schein und dem immer n o c h schöneren Schein zu tun: mit schönen Schuhen und Kleidern von Frauen - nicht ungenial, den ersten Auftritt der Poppea mit einem hohen Stuhl, auf dem sie steht, zu verherrlichen, denn ihr fließendes Gewand umfließt ihn ganz - ; mit schönen Gewändern auch von Männern, mit den schönen Wänden, mit dem immerschönen Vorhang, und selbst, wenn dahinter das psychedelische Rot, das immer mal wieder, ja, wie eine Sonne scheint, Blut gemeint haben mag, das Flecken hinterlassen würde, sehen wir nichts als gläserne Granatäpfel leuchten, artifizielle, die auch im Inneren nicht bluten. Damit erklimmt das Verhängnis dieser Inszenierung ihren eigentlichen Gipfel, - nein, sie klimmt nicht, sondern surft hinauf und überzieht die Musik mit einem Toffee, in dem sie tändelnd erstickt, man möcht' fast „händelnd“ schreiben. So kriegt sie vor lauter schickem Süß gar keine Luft mehr und kann sich um so weniger behaupten, als Jacobs sehr zu recht die ausgefeilten Rezitative betont, die schon für Händel ein Widerstand gegen den Evergreen waren, den er zugleich bedient hat. Anstatt unsere Ohren aufs Rezitativ zu lenken, damit auf das Kammerspielhafte der händelschen Dramaturgie, blendet Boussard die Augen, die man aber der Schönheiten wegen nicht schließt. Statt dessen hört man weg, freut sich aber, wenn mal eine Arie auftrumpft. Damit ist man dann genau wieder beim Friedrichsstadtpalast.
Für Leute, die sich nur unterhalten lassen wollen, ist das, mag sein, famos, für alle andern ärgerlich. Die kommen sich als unter Preis behandelt vor. Na gut, vom Entertainment sind wir sowas gewöhnt. Schlimm ist es deshalb nur für Jacobs' konzentrierte Arbeit, die eine ebensolche Intensität dem Hörer abverlangen kann, und auch schlimm für die Sänger:innen. Doch standen sie alle selbst in dem Leim, auf den sie gehen mußten – mit Ausnahme Dominique Visses, dem einzigen Buffo unter den Countertenören, die ich kenne, einem wahren Oleg Popow der Szene:  , sowie Bejun Mehtas, dessen sängerische Lyrismen sich bisweilen behaupten konnten, obwohl Ottono fast schon ein Schwächling der Romantik ist. Aber er ist eine wirklich gute Haut, so daß hier wider die Inszenierung so etwas wie Wahrheit wurde, und zwar immer wieder, und Gerechtigkeit.
Alex Pendas Agrippina hingegen konnte, was ihr gegeben ist, nicht annähernd so Klang werden lassen wie etwa die obwohl in ihren Möglichkeiten nicht so privilegierten Sänger:innen der >>>> Monteverdi-Trilogie an der Komischen Oper Berlin und, was ein besonderer Jammer ist, die stimmliche, so helle Größe der eitlen und zugleich rührenden Koketterien von Sunhae Ims mehr als nur entzückenden Poppea ging nahezu gänzlich unter, schon gleich in der Perlenszene des ersten Akts, der wir vielleicht den Vorhang dieser Inszenierung verdanken. Bezeichnenderweise bekamen die Sänger:innen immer erst dann Präsenz, wenn sie die Bühne verlassen hatten und vor dem Orchester agierten. Da ahnte man dann, was Pendas Agrippina hätte werden können. Für Barockopern ist es ja überhaupt eine Frage, ob man die Musiker im Graben oder nicht tatsächlich mit auf der Bühne positionieren sollte. So wird das in der Gegenwart nicht selten - und jedesmal mit großem Gewinn - (wieder) praktiziert. Ich erinnere mich sehr wohl an >>>> Jacobs' grandiose Marienvesper, mit dem Combattimento kombiniert, am selben Haus, wenngleich Unter den Linden, aber auch, eben dort, seiner Semele von Händel; Stunden wurden einem da ebenso zu Minuten wie in >>>> Grauns Cesare e Cleopatra. Da setzte sich auch, >>>> Alessandro de Marchi am Cembalo, Jacobs' Auffassung der Rezitative nachdrücklich durch. Hier hingegen war vor lauter schönem Schein nichts mehr davon zu hören.
Mag sein, daß sich Boussard, Lemaire und vielleicht auch Lacroix gedacht haben: Alle Figuren dieser Oper operieren mit falschem Schein; tatsächlich ist er fundamental für ihre Intriganz. Also zeigen wir das mit allem Glitter, mit dem ein Herrscherhaus seine Menschen und wohl auch sich selbst blenden kann. Nur ist auf einer Bühne die Wiederholung realer Sachverhalte nicht einmal eine Wiederholung, sprich: Verdopplung. Es sei denn, Boussard wäre radikal gewesen wie Jeff Koons. Anders als dieser will er aber immer geschmackvoll noch bleiben und gibt deshalb dem falschen Schein den nächsten falschen Schein, der sich den Kitsch nicht traut, hinzu. So subtrahiert sich der eine vom anderen nicht, sondern verstärkt ihn, anstatt daß auf ein Mittel gesonnen wird, die nun besonders starke Blendung zu durchbrechen. Ich etwa, der Gedanke kam mir beim Abwasch, hätte ausprobiert, alle Sänger:innen über Mikrofon singen zu lassen, jedenfalls der tragenden Figuren; da hätte auch schon mal grob übersteuert werden dürfen. Ich hätte die Balance riskiert, die Boussards Team auf jeden Fall wohl wahren wollte, und René Jacobs sowieso. Eine Blasphemie, ich weiß. Doch sie hätte den satirischen, zum Teil sogar kritisch ätzenden Character des Stücks wiederbetont, dessen Protagonisten es, ganz wie dem Regisseur, genau darum zu ist, noch dort geschmackvoll zu wirken, wo sie das Mieseste antreibt, das ihnen zudem, abermals Machiavell, ihr Selbstbewußtsein ölt. Das ja nebenbei schon mal einen Doppelmord in Auftrag gibt. Da müssen wir von Kaiser Claudius' Nachfolger, Agrippinas Sohn, um den ihre Intrigen sich drehen, noch überhaupt nicht sprechen: An der Komischen Oper hat ihm Barrie Kosky mit drei Schüssen, die Nero selbst abgibt, die Maske vom Gesicht genommen. Es ist nicht falsch, wenn Regisseure für Inszenierungen in ein- und derselben Stadt sich einmal anschaun, was mit verwandten Stücken die Kollegen tun. Große Namen schützen nicht. Sonst wäre alles eitel. 
***[Besprochen ist die 6. Aufführung an der Staatsoper Berlin
seit der Premiere am 4.2.2010. - Eine besondere Erwähnung,
wieder einmal, verdient das Programmbuch. Es erzählt über
die Oper mehr, als leider realisiert worden ist, ja, erzählt
von einer eigentlichen, möglichen Agrippina von Händel.
Das gilt auch für die in ihm farblich beeindruckend wie-
dergegebenen Bilder Vincent Lemaires.
Für 7 Euro ist das Buch zu haben.] *****
Georg Friedrich Händel
AGRIPPINA
Inszenierung Vincent Boussard Bühnenbild Vincent Lemaire
Kostüme Christian Lacroix Licht Guido Levi
Alex Penda - Marcos Fink - Jennifer Rivera - Bejun Mehta -
Sunhae Im - Christian Senn - Dominique Visse - Gyula Orendt
Akademie für Alte Musik, Berlin
René Jacobs
Die nächsten Vorstellungen:
5. Mai 2013, 18 Uhr
6. Mai 2013, 19 Uhr
>>>> Karten albannikolaiherbst - Samstag, 4. Mai 2013, 09:35- Rubrik: Oper
[Probenfotos: >>>> Wolfgang Runkel.
Fotos aus dem Saal: ANH/iPhone.]
Um einen perfekten Otello hören und sehen zu können, hat man nach Frankfurt am Main zu reisen, wenn auch erst wieder im Juli, oder man lebt sowieso dort und darf in die Oper einfach mit der UBahn fahren oder braucht sogar nur zu Fuß gehn.
Ich kann nicht nur, sondern m u ß das so schreiben, nachdem ich am 28. März der dreiundzwanzigsten Vorstellung dieser Inszenierung beigewohnt habe. Daß sie so gar nichts von Repertoire hatte, weil nicht die Spur von Routine fühlbar wurde, sondern, obwohl längst andere, als bei der Premiere, Sänger:innen diese späte Oper Verdis gestalteten und obwohl das Dirigat durch Riccardo Frizza sowie die „Abendspielleitung“ von Orest Tichonov übernommen worden sind, ist schon wunderbar für sich, und mit welch höchster Intensität musiziert und gesungen worden ist,
sei es dank des nicht nur einfühlsamen - : das sagt sich gern mal so dahin -, sondern vor allem leidenschaftlichen, klanglich grad auch im Stürmen furchtbar herrlichen Mitagierens des Frankfurter Opernhaus- und Museumsorchesters,
sei es des mal drohenden, mal fordernden, mal ausgelassenen und dann wieder durchaus hämischen Chores halber, dem ich bei der Sturmszene des ersten Akts allerdings noch ein wenig mehr Gewalt gewünscht hätte - andererseits geht der Mensch im Sturm ja grad unter -,
sei es vor allem wegen der Sänger:innen:besetzung, in der es sogar eine Art Wunder gibt, die eine alte, als Huldigung für Johanna Heiberg niedergeschriebene Forderung Søren Kierkegaards absolut einlöst... -:
sei es wes' immer - -
- - Eraths Inszenierung ist von einer derartigen Klarheit, daß sich seine und Dirk Beckers, seines kongenialen Bühnenbildners, Auffassung dieses späten Meisterstücks Verdis auf nächste Ausführende „einfach“ übertragen läßt: So zugleich typisiert, wie aber individualisiert eben auch, sind nahezu sämtliche Rollen. Und fast durchweg wird auf Theatermätzchen verzichtet. Das eben auch politische Eifersuchtsdrama bedarf nicht irgend eines symbolistischen Herumabstrahierens, um den konkreten Geschehen eine Allgemeingültigkeit zu verleihen, die die conditio humana im Blick hat und nicht, wie elend oft bei Wagner, manipulierende Ideologie will.  Genau deshalb, weil dies verditypisch ist, sind Vergleiche mit Wagner oder gar Mutmaßungen, Verdis Spätwerk sei eine Art Bekenntnis zu dem Bayreuther Weihekomponisten, restlos absurd; der Umstand durchkomponierter dramatischer Verläufe ist eine äußerliche Ähnlichkeit, die sich viel mehr aus der musikästhetischen Logik des sich abschließenden 19. Jahrhunderts herleiten läßt; zudem wird der Gassenhauer, mit dem Verdi gleichwohl nach wie vor spielt, der auch zu seinem riesigen, insgesamt, Werk- und also Lebenserfolg nicht wenig beigetragen hat, kaum mehr im Focus des schon alten Mannes gewesen sein. Statt dessen ging es sowohl im Otello wie im gleichermaßen grandiosen Falstaff allein um die dramatische Konzentration. Verdis Verismo wird dabei in keiner Weise angetastet, eher im Gegenteil verstärkt. Das gilt auch für die ganz sicher interessanteste Figur der Oper, Jago – den wahrscheinlich ersten tatsächlichen Nihilisten der Operngeschichte.  Es geht bei ihm eben nicht nur um Rache für eine scharf empfundene Zurücksetzung. In dem puren Manichäismus von gut und rein, Desdemona, dort und böser Jago hier geht sein Character nicht auf, schon gar nicht ist er ein Klingsor, den eine Schwäche „entmannt“ hat. Vielmehr spricht aus ihm der schwer Traumatisierte, wo Otello, bis fast ganz zuletzt, noch von Ruhm und Kriegsehre faselt. Jago steht für den Soldaten, der herausquellende Därme sah, abgeschnittene, abgeschlagene Extremitäten, Gefolterte, Vergewaltigte, und er, als Militär, heißt das gut, darin viel verwandter dem von Gott abgefallenen Nikolai Stavrogin aus Dostojewskis Dämonen als irgend einem romantizistischen Ritterbild, dem Otello anhängt wie Wagner. Im Wortsinn ist Jago pervers; seine Lust ist das Wehe des andren, für die er auch eigenes Leiden inkauf nimmt. Treue, Ehre, Demut (die im Soldatischen Gehorsam heißt) – all diese für Wagner, zumal auf seine verlogene Weise, fetischisierten Begriffe – sind in Jago längst ebenso zerfallen wie in der wirklichen Welt, ja, er kommt einem mitunter wie ein Reflex gleichermaßen Max Stirners wie Lautréamonts vor, die Verdis Zeitgenossen waren. Er ist Machiavell genug, um die Hohlheit der kriegerischen Phrasen zu erkennen und also zu benutzen, und der Menschen, die sie im Mund führen; die Hohlheit auch des Liebesbegriffes; eine Verbindung, die sich, in der Tat, von Eifersucht zerstören läßt, ist es nicht wert, daß sie Bestand hat. Man kann sagen: Jagos Intrige exekutiert sie. Insofern ist sein abgefeimtes Lügengewebe aufklärerisch: wie Nietzsche tritt er hinab, was sowieso schon stürzt. Und hat seine hochmütige, durchaus intellektuelle Wollust dabei. Daß er darunter auch leidet, ein Kind war er ja auch einmal, macht ihn komplex: zumal, daß dieses Leiden ein Teil solch einer Wollust ist.
Marco di Felice präsentiert den Mann, wie der sich selbst sieht: extrem markant, auch in seiner von allen Männern dieses Abends tiefst- und weitestreichenden Stimme, männlich überhaupt, ja machistisch, auftrumpfend, eroberhaft eitel, doch ohne eine Spur von Selbstüberschätzung: darum gewinnt er sein böses Spiel. Wohl nicht von ungefähr erinnert seine Erscheinung einerseits an den Colonel Kurtz aus >>>> Coppolas „Apokalypse now“, andererseits an Mussolini. Voll Verachtung für die zumal sentimentale Schwäche auch und gerade seiner Geschlechtsgenossen, Cassios etwa, vor allem Rodrigos, kommt ihm dessen pubertäre Schwärmerei nur allzu recht. Für Otellos Selbstglorifizierung hat er nur Hohn, denn er und nicht dieser hat „das Grauen gesehen“, so bei Coppola, „I've seen horrors...“: Deshalb kann Jago nicht nicht, sondern will nicht lieben und packt die Glorifizierung an ihrer Wurzel: dem verdrängten Gefühl des Minderwerts.
Den hat Erath gerade dadurch, daß bei ihm Otello n i c h t schwarzgeschminkt wird, grandios herausgearbeitet: indem er ihm nämlich einen schwarzen Doppelgänger beigibt, einen sozusagen verdrängten, der auch immer wieder wegwill; aber die Türen sind verschlossen. Otello b l e i b t schwarz, ob er will oder nicht, er kann so weiß sein wie möglich. Darin liegt etwas mehrfach Beklemmendes, liegt auch eine Selbstlüge: indem er aus der Sklaverei freikam und schließlich für Venedig als geachteter Feldherr kämpft, ist er doch als Krieger gegen die Sarazenen auch ein Verräter am eigenen Volk, an, zumindest, der eigenen Kultur.  „Sarazenen“ meinte übers Hochmittelalter hinaus die gesamten arabischen bis türkischen Völker des nordafrikanischen bis vorderasiatischen Raums, nicht nur die Mauren, von denen sich - doch schon das griechische μαῦρος, „mauros“, meinte „dunkel“ - das Wort Mohr abgeleitet hat, das noch Shakespeares Vorlage im Titel trägt. Dabei lassen sowohl dieser selbst wie auch Boito, Verdis Librettist, den Umstand außer acht, daß „Moro“ eigentlich >>>> nur der Nachname eines weder mit den Mauren noch ganz allgemein mit Menschen dunkler Hautfarbe verwandten venezianischen Arikstokraten war. Bei Shakespaere wie bei Verdi ist er ein dunkelhäutiger Aufsteiger, mit Marx könnte man sagen: Klassenverräter: Die Verleugnung seiner Hautfarbe schlägt aggressiv gegen alle andren, die sie haben, um. Man muß sich nur vor Augen führen, daß bis übers 15. Jahrhundert hinaus der Sklavenhandel ein gängiger Posten der venezianischen Ökonomie war. Wenn Otello „die Türken“ bekriegt, so tut er dies als ein mit welchen Ehren auch immer ausgestatteter Domestik eines „Herren“volks, das Otellos eigene Ethnie auf das schlimmste diskriminiert, ausbeutet, schlachtet. Indem schon Shakespeare von seinen, Otellos, „wulst'gen Lippen“ sprechen läßt („the thicklips“/Boito: „gonfie labbra“), läßt er ihn das Stigma seiner Herkunft sichtbar behalten, das Desdemona aus „weißer“ Sicht verunreinige. Entsprechend hat die Operntradition Otello auch immer wieder auftreten lassen, rassistisch zur Farce geschminkt. Nicht so aber Erath. Bei ihm ist das Andere, das Fremde und im allgemeinen Ansehen „Niedere“ nur uns, den Zuschauern, sichtbar, und zwar im für alle übrigen unsichtbaren Doppelgänger, der für Otello etwas ist, das er niemals loswird.  Er ist, sozusagen, der Schatten einer Vergangenheit, die ihm quälende Schmach bleibt. Hier, genau hier liegt die Begründung seiner dann losbrechenden Eifersucht: Da ihm, dem eigenen Beschwören zufolge, alleine Desdemona die wahre seelische Heimat ist, würde ihr Verlust ihn vernichten. Eben da hakt Jago ein und setzt ihm die Spritze, die den längst eingekapselten Virus bloß aktiviert. Mit ihm infiziert war Otello schon vorher: Er gehört zum Frauenbild ihrer beider Kultur, auch, übrigens, zum monotheistischen Besitzdenken - Besitz fühlen - des abend- wie morgenländischen Ehekonzepts.
Hinreißend, wie Erath diesen Virus sich nun ausschütten läßt. Er befällt gleichsam jedes Organ Otellos, bis der Schmerz so groß und die tatsächliche Krankheit, die ihn bewirkt, derart quälend geworden ist, daß der Befallene nur noch rast. Das führt uns Frank van Aken nicht nur mimisch vor, zunehmend verwühlt und zu Berge stehend sein Haar, die Gestik wilder und wilder, sondern vor allem auch sängerisch; je wüster er sich nämlich geriert, desto lyrischer, weil eben leidend, wird sein Tenor. Der ganze Mann bricht auseinander, will sich zwar fassen – daher die abrupt wirkenden Versöhnungsgesten zwischendurch -, aber kommt gegen den Wahn nicht mehr an. Deshalb paßt es auch so, daß van Aken mit der Stimmenmacht de Felices nicht wirklich mithalten kann: Otellos Heldenarien, in Wahrheit, glauben sich selbst nicht. Das ist folgerichtig von Anfang an so gesetzt: Tribun ist immer sein Widersacher, den er noch lange für einen Freund hält. So tritt wieder und wieder sein „schwarzes Ich“ auf die Bühne stumm zurück, aber nicht, wie man sich ein schlechtes Gewissen personifiziert vorstellen mag, sondern in enormer Schönheit der Erscheinung, die dennoch wieder und wieder, und eben deshalb, unterworfen sich erniedrigen muß. Welch ein Einfall jenseits alles Aufgesetzten!
Wie großartig das durchgeführt wird, zeigt der 3. Akt, in dem sich der Schwarze anfangs ein wenig grundlos wieder vorn an die Bühne legt. Was soll das jetzt? dachte ich – und vergaß es derart sofort, daß ich beinah erschrak, als sich der gebrochene Mann am Aktschluß wieder erhebt, aufsteht und geradezu strahlend dasteht, doch nur strahlend als eine Möglichkeit, eine, die vielleicht gewesen wäre, hätte es nicht die unselige Geschichte und Selbstüberhebung des, bleiben wir mal im Klischee, „weißen“ Mannes gegeben und seiner brutalen christlichen Kirchen. Deren Grausamkeit die der islamischen freilich nicht nachstehn.
Tragisch, unter anderem, ist an dem Stück die E c h t h e i t des otelloschen Leidens, das aber Selbstvergötzung mitbewirkt hat; schon sie hat dem Mann den klaren politischen Blick getrübt. Jago ist dem Mohren nur ein ebenso falscher Freund wie die Seerepublik selbst, der er dient. Denn beide sind ihm nur um den Preis der Selbstverleugnung zuhanden, die schließlich seine Auslöschung will.
Eraths Inszenierung zeigt das bereits im Bühnenbild und schon ganz zu Anfang. Wenn wir den Opernsaal betreten, steht die Bühne voller Soldatenstiefel, die, selbstverständlich, in Reih und Glied. Mittendrin hockt, düster glänzend, der Mohr, halb vom - hellen - Feldherrenpelz umdeckt, links hinter ihm aber, auf einem Gerüst, steht ein – Bambi. Genial, diese bis zum Schluß völlig unkommentierte Dekoration. Über Desdemona verrät sie mehr als jede Analyse, nämlich über die Wunschprojektion, die sie verleiblicht hat, indem sie sie erfüllt. Deshalb versagt die Frau hier nicht minder als der Mann, ja, Desdemona ist das geradezu geborene Opfer – das zurechtge prägte, meint das, destilliert aus stiller Einfalt und Ergebung. Jago muß es nur nutzen. Wie irre Otellos Eifersucht schließlich ist, wird besonders hier in Frankfurt deutlich, weil einem solchen Geschöpf jeglicher Eros abgeht. Leah Crocettos Desdemona-Erscheinung ist komplett kindlich, gütig kindlich, zärtlich kindlich und stellt keinerlei, schon gar „nymphomane“, Forderungen, die einen Mann in Probleme bringen könnten. 
Anfangs enttäuscht das, weil jedenfalls der männliche Opernbesucher von einer Desdemona, der solch eine Leidenschaft gilt, ein völlig anderes Bild mitbringt. Das kierkegaardsche Wunder, von dem ich oben schrieb, besteht nun aber gerade darin, daß einen Frau Crocettos stimmliche Gestaltung der Partie jeglichen solchen „Anspruch“ vergessen läßt, ja, plötzlich versteht man sogar, wenn von ihrem Liebreiz geschwärmt wird, und man fühlt die Hand des Mitleids-selbst, die Desdemona Otello begütigend, wenn auch hilflos bleibend, auflegt. Dazu paßt es ungeheuer, daß auch sie an den Füßen Soldatenstiefel trägt, paßt so wegen des zugleich auf Wahrheit deutenden Widerspruchs. Das ist gar keine erwachsene Frau, sondern ein liebes- und schwarmvoller Backfisch, der sich in den Schuhen Erwachsener versucht, die aber doch zu groß sind, um ihr auch nur von ungefähr einen Gang zu verleihen, der wirklich circisch lockte.
Tatsächlich ist Desdemona fast noch unreifer als Otello, beinahe täppisch, doch eben voller – ecco! – Hingebungsbereitschaft und so genau das Frauchen, das sich der Monotheismus idealisiert hat; damit steht sie aber zugleich für alles, was sich „der Mann“ versagt und von sich abspalten soll. Wenn Desdemona im 4. Akt, der fast ganz nur daraus besteht, von der alten Trauerweise unmittelbar in ihr „creda per noi“ und attacca ins Avemaria übergeht, creda per me, das direkt ins letzte Beisammen mit ihrem Mann führt, dann bringt Frau Crocettos herzrührender, gestisch aber stillgestellter, sozusagen duldender Gesang ein männliches Wunschbild von Frau in die Welt, das alles, was das herrschende Geschlecht sich nicht durchgehen lassen darf, bzw. durfte, auf diese Figur konzentriert. In Verdis katholischem Umfeld wird sie damit zur Jungfrau Maria selbst, Pietà, die noch nach der Geburt ihres Kindes Unbefleckte und damit zur idealen italienischen Mutter als einer heilig Unberührbaren; die Renaissance sah die Rolle der Frau zumindest für die gehobenen Stände noch anders als Verdis Zeit; sein und Boitos Jago ist auch deshalb so mächtig und nicht nur einfach ein Bösewicht, weil er in Desdemona das Marien-Ideal sich gerade dadurch weitererfüllen läßt, daß auch die Oper sie opfert. Die Ideologie der christlichen Reinheit bleibt selbst vom Bösen unangetastet, ja wird von ihm garantiert. Auch das zeigt - wie regressiv das ist - der aufs Gerüst gestellte Bambikitsch. Tatsächlich ist Desdemona ein Dummchen mit einem aber sehr großen Herzen - und mit so tiefem, daß sie und Otello darin ertrinken.
Dem die Musik gegeben zu haben, und jeder Person ihre eigene – nicht zuletzt das schafft des alten Verdis Verismo Allgemeingültigkeit sogar jenseits seines objektiven wie subjektiven, nämlich psychologischen Realismus; eben dies trennt ihn ein für alle Male von Wagner, dem ideologischen Reaktionär. Verdi ist noch in der Klage, noch in der christlichen Affirmation kritisch. Was über die erzählte Handlung (den „Plot“) hinausgeht, ja - langt, strahlt aus eben ihr heraus. Es ist ihr transzendentes Ergebnis, das zu der Geschichte schließlich noch hinzukommt: als eine mythische, als solche aber aus ihr gewordene Erzählung, neben der die reale - gesellschaftliche, muß man sagen - zugleich den Bestand wahrt. Insofern überstrahlt, in höchstem Sinn modern, des alten Verdis Kunst die des alten Wagners um Dimensionen. Eraths Frankfurtmainer Otello-Inszenierung läßt einen das direkt erfahren: wie vor den Kopf geschlagen schon in der ersten Pause sitzt man da.  Zudem ist Eraths und Deckers Reduktionismus, dies ein weiteres Staunen, in keiner Weise karg, sondern elegant und zugleich prall, die Kühle des Lichts wiederum hitzegesättigt, vulkanisch, und die Farben entfalten eine venezianische Pracht, ohne daß sie ausgestattet werden müßte. Das Regieteam verdoppelt rein gar nichts. Für den militanten Pomp der Republik genügt die Musik, die beim Sturm wie durcheinandergerät, wie in der Kneipenszene die Partien durcheinandergeraten, wie in Jagos Gesängen ständig die Tonarten wechseln, so daß sie keiner fixieren kann, und eine andere gebeugte Frau, Jagos Gemahlin, bereitet der erhobenen den Fall m i t, um, als er geschehen, ihr im beiderseitigen Gebeugtsein die Solidarität zu erweisen: so gesehen, ist der Otello auch eine Erzählung vom Handeln regredierter Frauen. Derart realitätsnah komplex laufen die psychodynamischen Prozesse, so simpel aber dreht sich, als Menge, das Volk. Unfaßbar gut, wie Verdi das in den Chor kriegt und mit welch einfachen Mitteln Erath es szenisch realisiert – etwa, wenn aus nur ab der Schulter aus der Bühne ragenden Leuten, mithin einer Mannschaft, Poller für Schiffstaue werden, am Kai; so im 3. Akt. Da sie nach hinten singt, hört man die Menge aus der Ferne. Grandios. Oder wie sich Jago des Otellos Feldherrnmantel umlegt, nicht, um sich sein Amt anzumaßen, sondern, um zu bedeuten, wer hier tatsächlich längst führt und taktisch führen auch sollte; wer so wenig Distanz zu den eigenen Gefühlen hat, sich derart von ihnen bestimmen läßt, daß er sogar den Freund verstößt, dem Einschmeichler aber das Ohr neigt, darf die Verantwortung für andere Menschen nicht länger tragen, nicht für ein Heer, nicht für eine Flotte. Das eigentlich Schlimme am Otello ist, daß Jago eigentlich recht hat und das Recht, um sich zu zeigen, der Intrige bedarf: furchtbarster Grund für Jagos perverse Credo-Arie. Wie gar nichts sonst steht er, Jago, stellvertretend für die Serenissima und damit für den Krieg, den eben nicht Otello, sondern e r repräsentiert: seinen Abgrund, aus dem, und aus nichts sonst, er besteht. Aus dem puren Interesse: jenseits aller Moral.  „Die Welt ist so verderbt, Zaunkön'ge hausen, wo's kein Adler wagt!“ Das ruft Richard III einmal aus; von hier aus entschlüsselt sich Jagos (Kriegs-)Recht und bindet ihn abermals an Mussolini und abermals zugleich an den Colonel Kurtz. Otello hingegen liegt da wie ein Tor, über den die Politik hinwegging, Desdemona aber als ihr eigentliches Opfer, dessen jene - wenn sie der Macht ist - immer bedarf; als „Bauernopfer“, könnte man sagen, stünde dahinter nicht basal das Frauenbild der monotheistischen, patriarchalen Ideologie. Mit einer selbstbewußten, gebildeten, s e l b s t wollenden, gar eigenständigen Frau wäre Otellos Leben anders verlaufen; er hätte aber solch eine gar nicht „genommen“; sondern er selbst wollte ihr Opfer, darin mit Jago völlig, wenn auch unbewußt und daran leidend, einig.
Er führte, der Zaunkönig, selbst die Hand.
Deshalb fühlen wir, so im Programmbuch W. H. Auden, Mitleid mit Otello, doch haben keine Achtung vor ihm, die - als eine ästhetische - Jago gelte. Das ist nicht ohne Zynismus formuliert, und zwar gerade, indem er, Auden, das entstehende Leid fokussiert, aber die Bereitschaft übergeht, mit der sich Menschen für politische Ideologien opfern, deren eine Spielart die organisierte Religion ist. Auch von der bleiben schließlich nur Stiefel zurück, darin noch die Füße der in die Luft gesprengten Soldaten. Es gehört zur Größe dieser Inszenierung, uns dies von Anfang an vor die Augen zu führen und immer wieder daran zu erinnern. Otellos Schicksal ist traurig, tragisch aber Desdemonas, die noch im Sterben, statt daß sie begriffe, vergibt. Jago aber, an der hinteren Bühne, steht da, die Hände in den Taschen, und zeigt uns den Rücken, ohne daß er sich rechtfertigen müßte. Denn „you have no right to call me a murderer“, sagt Colonel Kurtz. „You have a right to kill me. You have a right to do that, but you have no right to judge me.“  Besuchen Sie diese Inszenierung unbedingt. Die Oper Frankfurtmain wird sie noch einmal am 4. und 7. Juli dieses Jahres zeigen, doch ist zu hoffen, ja, fast ein bißchen zu verlangen, daß Johannes Eraths Inszenierung in die Spielzeit 2013/14 weiter übernommen wird. Sie gehört – mit >>>> Götz Friedrichs Rosenkavalier von 1993 und dem mit 1968 sogar noch viel älteren >>>> Barbiere di Sevilla von Berghaus' und Freyer zu den seltenen Opern-Interpretationen, die nicht altern. Man denkt über Eraths Otello noch sehr lange nach und braucht deshalb einige Tage, um eine Erzählung zu schreiben, die dem Erlebten auch angemessen ist.
Ein bleibendes Rätsel wird freilich bleiben, weshalb am 28. März der Applaus so verhalten ausfiel. Fühlte man sich zu sehr – erkannt? Oder war der Intensität nicht gewachsen, der uns das gesamte Ensemble einschließlich Orchester und Dirigent ausgesetzt hat? Denn wahrlich! Dieser ist kein netter Abend, der sich fürs Sehen und Gesehenwerden eignet, noch um mit interesselosem Wohlgefallen die Pausenschnittchen zu genießen. Sondern große, größte Kunst: das Gegenteil von „Unterhaltung“. Giuseppe Verdi.
OTELLO.
Dramma lirico in quattro atti.
Text von Arrigo Boito nach Shakespeare.
Regie Johannes Erath - Szenische Leitung der Wiederaufnahme Orest Tichonov – Bühnenbild Dirk Becker - Kostüme - Silke Willrett - Licht Joachim Klein - Dramaturgie Norbert Abels - Chor Matthias Köhler - Kinderchor Felix Lemke.Frank van Aken - Marco di Felice - Leah Crocetto - Jenny Carlstedt - Beau Gibson - Simon Bode - Bálint Szabó - Franz Mayer - Kihwan Sim.
Chor und Kinderchor der Oper Frankfurt, Frankfurter Opern- und Museumsorchester. Riccardo Frizza
Die nächsten Aufführungen:
4. und 7. Juli 2013, je um 19.30 Uhr.
>>>> Karten.  albannikolaiherbst - Dienstag, 2. April 2013, 16:18- Rubrik: Oper
E un diluvio di fiamme a poco a poco
scioglie;
scioglie, quasi cometa, il crine ardente
per minacciar la morte.
(:Giovan Leone Sempronio, Chioma rossa di bella donna,
dtsch. von Simone Prior:)
und eine Flut aus Flammen nach und nach
löst;
löst, fast wie ein Komet, das brennende Haar,
um den Tod anzudrohen.
Große künstlerische Ereignisse finden nicht selten in sehr kleinem Rahmen statt; etwa zur >>>> „Kleinen Nachtschicht“ gestern um halb zehn fanden sich noch weniger Hörer ein als zuvor in >>>> Sciarrinos Vanitas-Spiel , bzw. waren sie dageblieben, das nicht, wie Messiaens Quartett für das Ende der Zeit, um die letzten Dinge kreist, sondern ums Verstummen dieser Dinge, wobei „Ding“ der verräterisch falsche Begriff für etwas ist, das wir unser Leben nennen. Um dieses Leben aber rankt Messiaens unheimliche und rätselhafte und schließlich wie davonschwebende Komposition für Klarinette, Violine, Violoncello und Klavier, wobei die Klarinette ein klangverschobener Part für die Bratsche ist, das Todesinstrument an sich, auf dieses nämlich bezogen: Hat man das im Ohr, hört man etwas anderes als das, was tatsächlich hörbar wird; genau dem aber „hinter den Dingen“ galt des tiefchristlich gläubigen Messiaens Musik seit je. Man mag es gar nicht glauben, daß er - so geradezu für die Moderne „klassisch“ ist er längst - erst 1992 verstarb. Das „Quatour pour le fin du temps“ wurde am Anfang die Vierziger im „Mannschaftsstamm- und Straflager“ Görlitz zuendegeschrieben, dessen Kommandant, auf Intervention eines Dolmetschers und eines Pfarrers, dem Komponisten nicht nur zu komponieren erlaubt, sondern auch dazu beigetragen hat, daß sich einer der Ausführenden der vor den Gefangenen stattfindenden Uraufführung ein Cello besorgen konnte. Die ganze Geschichte können Sie >>>> dort lesen.
Die Aufführung gestern war ohne Zweifel der Höhepunkt des Abends. Messiaens Quartett galt und gilt seit seinen ersten Interpretationen außerhalb des Lagers als ein Schlüsselwerk, mythisch fast, der Neuen Musik. Das war auf das unheimlichste spürbar, und zwar gerade nach Sciarrinos ständig verebbenden, aus völliger Stille anhebenden, zu Stille werdenden Klanglinien, die leider, ihre Semantik, ein wenig unter der Inszenierung der einzigen Menschenstimme, einer Sängerin, litten; sie sang vortrefflich, und wäre, was das Programmheft Librettopart für Librettopart tut, auch im Bild der Aufführung realisiert worden, der Eindruck ingesamt wäre ein anderer, sehr viel noch intensiverer gewesen als nun, da die großartig intonierende Rowan Hellier als eine Mischung aus Weibsclown und Marionette ihren Part statisch-manieriert vorführen mußte, in am Anfang permanenter, wie mein Freund G. das nannte, Kackstellung (er meinte die auf, z.B., süditalienischen Stehklos) bis zur dreifach fett dem Publikum aufs Brot gestichenen Vegetierung am Boden - als Figur eine rein seelenlose Behauptung, die der Szene selbst jede Kraft absaugte, die sie gehabt haben könnte: nämlich eines alten stummen Paares Schauen in den Spiegel (worin nichts ist, das wir sehen) und Betrachten der eigenen Bilder als zweier beklemmender Videoinstallationen auf Leinwand; man hält sie anfangs für fotografierte Portraits, die sich aber unvermerkbar, anfangs, rühren, dann schon den Kopf drehen, zueinander und zur Szene selbst der Marionette hinunter. Das, in der Tat, ist von enormer Eindringlichkeit. Es wäre diese Schlichtheit aber auch der Sängerin zu geben gewesen, ihr im Zusammenspiel mit Cello und Klavier, ja vielleicht wäre es besser gewesen, man hätte Frau Hellier g a r nicht inszeniert, sondern als Instrument unter Instrumenten vortragen lassen und alles Szenische auf den Lebensrückblick der beiden Alten konzentriert, hätte einfach der Leere einmal vertraut, die das Geschwundene hinterläßt - vanitas, Eitelkeit, h e i ß t eben eigentlich „Leere“ - und das in seiner Schlichtheit vorzügliche Programmheft weiß das auch. Überhaupt ist i h m viel mehr als der tatsächlichen Inszenierung zu entnehmen, wie das Stück hätte aussehen können: Etwa, indem man die auch italienischkundigen Hörern nicht durchweg verständlichen Barocktexte, alle sind sie nur kurz, tatsächlich auf die Wand projeziert hätte. Das Programmheft folgt hier einsichtig einer Ästhetik, die wir aus einigen Filmen Syberbergs kennen; davon bleibt im Raum nicht die Spur. Statt dessen werden auch die beiden stummen Alten in Übermondänes hineingesteckt und gleichsam travestitisch, aber statisch, vorgeführt, obwohl doch, wovon intensiv die Musik erzählt, auf jeden Menschen zutrifft - viel beklemmender von Gregor Fuhrmann verkörpert, seiner strengen, konzentrierten Erscheinung, der Feinheit seines Cellospiels, während Jenny Kim als Person nicht aufgefaßt werden konnte, weil sie ganz hinter dem Flügel verschwand. Musikalisch beide großartig, so, wie Hellier, für die aber außerdem unklar bleibt, weshalb man ihrer Frisur zu allem personal-Clownesken noch das „Saubere“ eines BundDeutscherMädchen-Mädchens verpaßt hat. Gerade für Sciarrino, der auf Konzentration des Klanges aus ist, auch auf Ausdünnung, nur das Nötigste zulassend, scheint Manierismus mir so wenig passend zu sein wie die Äshetik des Absurden oder Bizarren Theaters. Wahnsinnig schön dafür - Klaus-Heinz Metzger schrieb einmal von wahrer Musik, allerdings meinte er Webern - der Cello-Kantilene völlig schnörkellose Lobpreisung Jesu im Quartett.
Dennoch gab es auch im Sciarrino immer wieder Momente, die sich direkt ums Herz, wie zu eng angezogene Schlösserketten, legten: etwa der Blicke halber, mit denen die Alten ins Publikum schauen, oder in der quasi Rührlosigkeit, mit der sie vor dem (für uns) leeren Bild stehen. Das hätte, auch in Alltagskleidung, völlig ausgereicht, ja hätte diese Inszenierung enorm angehoben. So aber wurde sie selbst, die Leere, zur Angst vor der Leere: Angst, daß die Musik vielleicht doch nicht trägt, wenn man sie alleinläßt. Eine grundlose Angst. Sie trägt sogar derart, daß jederlei theatralischer Firlefanz ihr furchtbar abträglich ist. Musiktheater muß nicht mehr „agieren“, wir leben im 21. Jahrhundert und haben eine differenzierte Operngeschichte durchlebt; freilich kann und soll sie agieren, wo die Musik den Raum gibt oder sogar dazu auffordert.
Da war dann nach der Pause die für mich unerwartete Aufführung von Messiaens Quartett die eigentliche Oper - allein dadurch, daß Geige, Cello und Klarinette extrem eng aufeinandersaßen, hinter ihnen das Klavier, und um die Musiker herum Sessel frei, ohne Regel, im Raum verteilt, auf die sich setzen konnte, wer mochte; ebenso auf die lange, niedrige Holztribüne. Hier wurde man nun Teilnehmer-selbst an einem Stück. Unglaublich, wie zugleich konzentriert und gelassen das war, wie einbezogen und dennoch bequem: Kammermusik im allerbesten Sinn des Wortes, intime, so intim, wie auch Sciarrino es verlangt hätte. Zumal wir so wenige waren. Ein Häuflein wie zufällig aus dem hohen Schnee draußen hier Hineingeschneiter, kaum mehr als bei der Lesung eines unbekannten Lyrikers, ja, geradezu familiär, und das in einer Millionenstadt an einem ihrer allerbesten Häuser mit allerbesten Musikern zu einem der berühmtesten Stücke der Welt. Das eigentlich Besondere war daran aber, wie unversehens der Sciarrino mit Messiaen legierte, wie unfaßbar das zusammenging - als würde sich der eine im andren nun erfüllen. Toll. - Ach! A r m, wer nicht dabeiwar.
Doch gibt‘s noch eine Chance: Am 28. März, in also sieben Tagen, wird genau diese Konstellation wiederholt werden. Zwei Tage vorher allerdings wird die „Kleine Nachtschicht“ im Anschluß an Sciarrino Morton Feldmans, eines seinerseits Meisters der Stille, Crippled Symmetrie zur Aufführung bringen. Das könnte eine sehr ähnliche Wirkung entfalten. Salvatore Sciarrino
VANITAS
Natura morta in un atto
Inszenierung Beate Baron
Stimme Rowan Hellier - Violoncello - Gregor Fuhrmann
Klavier - Jenny Kim
Frau Friederike Frerichs - Mann Hans Hirschmüller
Die nächsten Aufführungen:
26., 28. März
2., 3. April.
Je um 20 Uhr.
>>>> Karten.
Olivier Messiaen
QUATOUR POUR LA FIN DU TEMPS
Tibor Reman - Petra Schwieger - Gabriella Strümpel - Günther Albers
Die nächste Aufführung:
28. März, 21.30 Uhr.
>>>> Karten.
albannikolaiherbst - Freitag, 22. März 2013, 12:49- Rubrik: Oper
 Gab mir die Mutter Mut,
nicht mag ich ihr doch danken,
daß deiner List sie erlag.
Frühalt, fahl und bleich,
haß ich die Frohen,
freue mich nie!
Hagen, Akt II, Uferraum.
Weshalb funktioniert diese Inszenierung nur bedingt, ja im Ersten Akt eigentlich gar nicht?
Die Grundidee nämlich des Regieteams um Guy Cassiers - er selbst, Enrico Bagnoli und Tim van Steenbergen - ist hinreißend. Und lese ich dazu die klugen Aufsätze des Programmhefts, etwa Michael P. Steinbergs Nachdenken über das, sozusagen, bildnerische Leitmotiv der Inszenierung - Jef Lambeaux‘ Fries Les passions humaines von 1899/90 -, so wäre an sich eine, nach Chereaus von 1976, vielleicht sogar grundlegende Wiederinterpretation von Wagners Tetralogie zu erwarten gewesen, zumal im Zusammenwirken mit Daniel Barenboim, dessen seit den Neunzigern allein in Berlin dritter Ring dies ist. Aber vielleicht, daß er ihn zu oft dirigiert hat unterdessen, weltweit, als daß die Partitur ihm selbst noch Überraschungen böte? Ich weiß es nicht. Im Beisammen mit Cassiers‘ Inszenierung jedenfalls wirkte die Premiere am Sonntag wie etwas auf mich, das ein Ring auf gar keinen Fall sein sollte: vor allem im ersten Akt geradezu statisch und die Musik, als weihte sie sich selbst, dabei aber, trotz der eleganten, mitunter auch beeindruckenden Lichtinstallationen, bisweilen seltsam handgestrickt. Gerade der objektiv schon lange erste Akt hatte etwas derart Gestelztes, daß meine Konzentration in dem überdies arg überheizten Haus schnell litt; trotz ihrer klaren Sangesstärken sprang von den handelnden Personen sehr wenig auf mich über - ja sie wirkten derart grob, daß ich gar nicht mehr wußte, weshalb ich mich in auch nur irgend einer Form noch weiter mit ihnen beschäftigen sollte.  Besonders das Liebespaar, besonders Brünnhildes und Siegfrieds vorgeführte - ausgestellte - Leidenschaft schien mir in keiner Weise glaubhaft zu sein, zumal dieser „Held“ von dermaßen elender Einalt ist, daß nur noch die ihm eigene Brutalität damit gleichkommt. Die aber soll für etwas stehen, dessen tragischen Niedergang uns nahegehen, vielleicht auch uns belehren soll, indessen die Dämmerung uns bloß zu einer Erlösung verhilft, weil wir nun endlich nachhause können.
Das angeblich Edle in Siegfried, von dem das Programmheft erzählt, ist nämlich nichts als Augenwischerei; unterm Strich ist dieser Mann ein roher Schlagedauf mit niedrigem IQ, der die ihm notwendigerweise fehlende Bildung, aber auch jedes vielleicht ihm noch mögliche Feingefühl durch die Vorliebe ersetzt hat, ihm lästige Köpfe abzuschlagen. Alleine der Bizeps und Minderbegabung machen den Helden aus ihm. Wenn man eines solchen Leid und mit ihm das der Menschheit mitempfinden soll, dann braucht es eine Regie, die auf den Menschen eben auch setzt, zu denen er nun mal gehört, eine, die sein notwendig Gewordenes in den Blick nimmt und erklärt; für seine galoppierende Tumbheit kann er ja nichts. Aber Cassiers Regie geht darüber schick mit Lichtspielen weg, hat nur sich selbst und ihr - eigentlich historisierendes - Konzept im Auge, nicht aber wirklich Schicksale, die, immer, persönliche sind. Daß Siegfried für ein Gutes stehe, ist schon bei Wagner nichts als Behauptung, auf die sich und auf den Konsens eines Publikums zu verlassen, definitiv keine Basis für eine Regie ist. Auch muß der bei weitem interessanteren, weil weniger flachen Figur dieses Paars, der aus ihrer zumal erotischen Vaterbindung herausgestoßenen Brünnhilde, irgend ein psychisch schlüssiger Grund gegeben werden, dafür, daß sie sich ausgerechnet in diesen Schlägertypen verliebt. Daß er durchs Feuer zu ihr kam, reicht nicht, schon gar nicht, um ihr Lust und Liebe, so steht das in Wagners Libretto, abzuzwingen. Hinter dieser Formulierung lauert Vergewaltigung, lauert Schändung, etwas, das nach der ihrerzeitigen Moral nur durch die Ehe auszugleichen war. Brünnhilde selbst spricht es aus: „doch meiner Stärke/magdlichen Stamm/nahm mir der Held,/dem ich nun mich neige.“ Das ist die - inverse - Aussage einer niedergeworfenen Amazone: niedergeschlagen zu werden, aber, ist die Penetration des Matriachats. Insofern ist Siegfrieds folgender, wenn auch ihm unbewußter, weil durch einen Vergessenstrank begründeter Betrug eine geradezu doppelte Verletzung Brünnhildes, Verhöhnung nämlich. Auch wenn Wagner selbst diese Dynamik nicht klargewesen sein sollte, erklärt sie Brünnhildes Rasen mehr als genug und damit auch ihr gattenmörderisches Bündnis mit Hagen. Nach der rohen, geistlosen Logik geradezu aller handelnden Personen fordert sie deshalb den Ausgleich. Welch eine Tragik hinter so etwas wirkt, kann man in Kleists Penthesilea lesen; auch hier ließe es sich inszenieren. Aber man muß dann auf den Menschen sehen, nicht nur auf das vorgeblich druntergebreitete Tableau der Geschichte. 
Die Historisierung dieser Götterdämmerungs-Interpretation, ihr Tableauhaftes also, verhindert indessen nicht nur eine nachvollziehbare Psychologie, sondern vor allem auch den Brückenschlag in unsere Gegenwart. Wo er dennoch versucht wird, erweist er sich als schnell zusammenstürzendes Kartenhaus, etwa bei den für Cassiers technoiden Gibichungen. Doch taugt Wagners Götterdämmerung zu einer Parabel über das ausgehende 19. Jahrhundert ohnedies nicht wirklich, schon, weil die Industrialisierung hier gar nicht mehr vorkommt, die rohe Mechanik des erblühenden Kapitalismus, von der in Niflheim das Rheingold noch erzählt. Aber auch die eruptive Entwicklung der Humanwissenschaften, die künstlerische Entdeckung des Symbolischen und scheinbar Irrationalen hat vor der heldischen Tumbheit keinerlei Platz, geschweige denn die Feinsinnigkeit und Klugheit einer Marquise von O....; dabei ist Kleists Novelle schon ganze Jahrzehnte vor diesem vierten Tetralogieteil erschienen. Also muß von alledem, wenn es historisch wirklich sein will, das Inszenierte miterzählen. Es reicht nicht, daß die Musik dies tut; vielmehr, was die Musik erzählt, kann von einer Inszenierung ganz ebenso zertreten werden, wie Siegfried seine Gegner zermalmt. Dessen Minderbegabung zum edlen Telos zu machen, das tragisch scheitere, ist ein eklatanter Fehlweg; ihn einzuschlagen, bedeutet, die Musik zu banalisieren, ja, zu verkitschen - eine Gefahr, die bei Wagner sowieso naheliegt. Sondern seinen brutalen Holzschnittfiguren muß ein differenziertes - reifes - Leben immer erst verliehen werden. Bei Cassiers jedoch bleiben sie alle, von Hagen aber abgesehen, quasi mit dem Vorschlaghammer ausgestanzt. Ein bißchen komplexer schimmert freilich auch Gunther, nämlich wenn er seine Schwäche erkennt, wie überhaupt Wagners dunkle Figuren deutlich mehr Aura haben als die hellen, ob Ortud oder der verzweifelte Telramund, ob später Klingsor, ja ob selbst Alberich. Das liegt daran, daß sie Gebrochene sind oder Zerbrechende, doch immer noch Aufbegehrende, daran, daß sie etwas durchzustehen haben; ihr Scheitern und seine Gründe sind negative Utopie. Das gilt besonders für Hagen. Der heldische Glitter hingegen ist falsch und in Siegfrieds Fall überdies, und ganz besonders, dumm.  Cassiers historisierende, zugleich abstrahierende und doch auf psychedelische Bildeffekte setzenden Tableaux sollen zeigen, wie sich die Gewalt der Zusammenhänge fortsetzt. Zusammenhänge sind aber ohne glaubhafte, das heißt: ambivalente, Menschen nicht zu haben. Jede Conclusio ist billig ohne sie. Denn das Stanzige der vorgeführten Personage, ihre bei „gut“ wie „böse“ primitive Beschränktheit läßt Entwicklung gar nicht zu. Deshalb läßt uns Cassiers Deutung auch kalt. Wir können nichts mitfühlen, so mitreißend die Musik auch komponiert und aufgeführt ist. Das eben ist so perfide, daß eine solche Inszenierung in die Musik selbst zurückschlägt. Ob Walhall dann brennt oder nicht, ist uns da nur wurscht, und wir verlassen das Opernhaus mit der öden Erkenntnis, viel Lärm um nichts, alles hohle Pathetik - zumal bei langsamen Tempi sich der Kitsch betont, der überdies von dieser Inszenierung erzeugt wird. Die Raffiniertheit der Partitur wird erstickt, und das, was Wagners eigentliche Meisterschaft war: nämlich das Seelenleben der Figuren in das Orchester zu legen, geht zugrunde. Dabei müßte eine Inszenierung ihm nur lauschen und folgen, müßte Bilder für die Musik erfinden, statt den Figuren ein erklügeltes Konzept aufzupropfen. Wie gut eine Regie das kann, hat in den Neunziger Jahren >>>> Barenboims, Kupfers und Schavernochs Ring ein- für allemal gezeigt; hinter Chereaus sogenanntem Jahrhundertring stand dieser ganz sicher nicht zurück.  Bei Cassiers statt dessen wird und wird auf der Stelle getreten und ewig weitergetreten und die Musik zur selbstgefälligen Behauptung, deren Auftrumpfungen nur noch unangenehm, weil häufig ziemlich klebrig sind. Die für eine solche Oper unglückliche Akustik des Hauses tut ihr übriges dazu: Das Schillertheater ist Sprechbühne und modelliert auf Markanz; das läuft dem von Wagner intendierten Mischklang grob zuwider. Bildlich gesprochen, macht es aus Ahnungen Gewißheit. Aus dem Ungefähr herüberwehende Leitmotive werden plötzlich Melodien, deren ständige Repetition einen, monierte Adorno einmal, dauernd am Ärmel zupft, kurz: Es wird die Intelligenz der Hörer beleidigt. Und das von einer auf der Bühne versammelten Horde Minderbegabter, die zwar nicht lallen und stottern, aber immer erst schießen, bevor sie (Eddie Constantin) fragen.  Dennoch gibt es tiefe Momente - solche, die ein hinter den Geschehen wirkendes Unheil unvermittelt spürbar machen. Für diese steht, fast ausschließlich aber, Mikhail Petrenkis Hagen. Seine Düsternis ist von erstem Auftritt an nachvollziehbar schmerzhaft. Das liegt nicht nur an Petrenkis Stimmkunst, seinen großen Gesang zu Character zu machen, sondern auch daran, daß Cassiers ihm das, librettohalber, gestatten muß. Er, Hagen, ist die Personifizierung der pervertierten, also umgedrehten, fehlgeleiteten Utopie; vielleicht ist er sowieso eine der wenigen Figuren des Rings, die sich tief nennen lassen, weil sie ihrem Leid auch Worte geben können: ein Bewußtsein nämlich, und zwar hier vor allem in dem brütenden Traumdialog mit seinem Vater Alberich.  Den, Alberich, macht Cassiers leider zu einer Karikatur, bzw. einem B-Movie-Monster, das drittels Batmans Joker ist, drittels Ringherrns Ork und drittels Elmstreets Freddy Krueger, kurz: nur Trash. Gegen so etwas anzusingen hat ein Sänger keine Chance, auch dann nicht, wenn er Johannes Kränzle heißt, dessen zwischendrin outrierte Clownerie sein fürchterliches „Sei treu“ einfach überulkt, das die ganze Tetralogie, und zwar mehrfach unheilvoll verschlungen, bis in das reale Hitlerreich und darüber hinaus mit geradezu Sprichwörtlichkeit belastet hat. Ich meine die Nibelungentreue. Abermals wird einer Erkenntnis, wär sie auch nur Erschrecken, der Weg zugeschüttet.
Hagen aber b l e i b t eine Person, weil genau in der objektiven Ambivalenz zwischen normativem (einem seinerzeitigen) Recht, persönlicher Tragik und politischem Kalkül. Ihn also werde ich, Petrenkis Hagen, fortan nicht mehr vergessen, diesen einzigen Intellektuellen zwischen lauter restringierten, und restriktiven, Bündeln brutalsten Instinkts, von denen er sich selbst dann noch ergreifend abhebt, wenn er am Ende der Oper völlig unorganisch auf die schon brennende Bühne poltern soll und es halt auch tut, um sein „Zurück vom Ring!“ abzuhaken und sich ungelenk in die Fluten zu stürzen. Leider muß er in dieser Inszenierung dazu erst einmal Tribünen erklettern. Von denen wird gleich die Rede noch sein; sie sind wohl hier als Deich gemeint. Die Szene selbst ist Affentheater.  Nämlich gerade der Ring des Nibelungen ist eine Aufforderung an Regisseure, mit dem Schwarzweiß der wagnerschen Charactere ein- für allemal aufzuräumen. Erst, wenn dies gelingt, kann die Tetralogie eine Aussagewürde erlangen, die auch für heute Gültigkeiten von moralischer, nicht nur von ästhetischer Kompetenz hat. Deshalb muß man diese Tetralogie, das geht gar nicht anders, zwar mit dem fraglose Genie ihres Schöpfers, und aller Achtung davor, gegen ihn inszenieren - immer Franz Liszts Ausruf eingedenk, welch ein Genie in diesem schlechten Character stecke; etwa kann man Wagners Werk nach wie vor nicht von seinem Antisemitismus freistellen. Genau darin, sich dem aussetzen zu müssen, liegt eine Chance. Sie macht uns Ambivalenz begreifbar. Den Umgang mit ihr nennt man Reife. Der Schlüssel dafür liegt in den Personen, nicht in Tableaux, an denen das leitmotivische Fries allerdings einigen Anteil hat, nämlich auch dann, wenn es über Projektionen auf Glasfaserflächen verflüssigt wird. Diese Verflüssigung müßte den Personen eingeflößt werden. Ansatzweise wird das auch versucht, etwa, indem Cassiers und Bagnoli das Fries mit der Ästhetik der >>>> Nichtgeborenen Anselm Kiefers, bzw., in den Kostümen, >>>> Liliths am roten Meer kombinieren.  Auch diese Idee ist eigentlich grandios. Doch eben nur die Idee, die auch nicht nur deshalb scheitert, weil es außer Hagen und, gegen Ende, Gunther nicht wirklich Personen auf der Bühne gibt, sondern sie scheitert sogar bildintern. Wer mit Kiefer arbeitet, darf nicht kleinteilig werden; das aber, letztlich, sind diese Lichtinstallationen. Vielleicht wollte man sich nicht auf ein einziges, wie auch immer wandelbares Bild verlassen, sondern für die Szenenwechsel Kulissen haben, die sich verrücken lassen. Außerdem sollten sie wahrscheinlich transportabel sein; immerhin ist dieser Ring eine Coproduktion mit Mailand. Doch führt solch eine Praktikabilität zu einigem Absurden, zum Beispiel, wenn die nicht sehr hohen Tribünen, auf die der Chor bisweilen gestellt wird und deren mit Menschenteilen angefüllten, einsehbaren schubladenartigen Vertikalflächen an die Schreine erinnern, in denen in katholischen Kirchen heilige Leichname liegen, - wenn diese Tribünen mehr oder minder willkürlich mitten in den Szenen hin- und hergeschoben werden. Das nimmt nicht nur die Konzentration aus dem jeweiligen Geschehen, sondern hat überdies den unangemessenen Charme von Schülertheater. Der Brünnhildenfelsen trägt dazu noch einiges bei, der abgegriffener auf eine Bühne gar nicht gestellt werden kann.  Keine noch so raffinierten Lichtspiele, die über die Glasfaser-Projektionsflächen laufen, lassen von einer derartigen Handwerkers Hobbynaivetät absehen, erst recht nicht die Monster- bzw. Cyborgbilder, in denen man dummerweise immer nur Sänger erkennt, die ihren Mund aufreißen. Sowas sind harte Eigentore, ganz abgesehen von den rein illustrativen Momenten, die zum Auftreten einer Walküre Bilder von Pferden projezieren, die stilistisch, selbstverständlich Leitmotiv, aus dem Fries stammen könnten. Schon da, wenn man überlegt, ob Spanische Schule oder doch nur eine Haflingerkoppel, ist grundsätzlich etwas schiefgelaufen.
Wozu denn überhaupt Cyborgs? - Weil, Cassiers Konzept zufolge, die Gibichungen eine Sippe seien, die am synthetischen „Neuen Menschen“ experimentiere. Aha, erkennen wir, nachdem wir (erste Pause) im Programmheft davon gelesen, d a r u m die Körperteile in den Schubladenschreinen: ein bißchen Frankenstein, ein bißchen Kritik an der Gentechnologie, so weiß man doch gleich, wer hier schlecht ist. Nicht nur die Götter.
Klar, logo. Doch damit geht eine höchst fatale Gleichung auf, eine bereits bei Wagner angelegte: böse ist gleich schwach, der Schwache böse per se. Genau deshalb greift er auf Rankünen zurück. Der Intellektuellenhaß zeigt seine Hörner, vielleicht, weil ein viel denkender Mensch nicht so richtig empfänglich für die musisch-moralische Manipulation ist, die alleine den geistig zurückgebliebenen Siegfried als einen Guten unterstellt oder gar als einen, wie das Programmheft will, „Edlen“. So richtig leicht ist das mit Intellektuellen nicht zu machen. Die schaudert sowas eher.
Aber davon abgesehen, wo findet sich denn Frankensteins Labor im Libretto? Nirgendwo. Dennoch tut das Programmheft, diesmal durch Erwin Jans, zum Bösen noch den Inzest hinzu; auch das weiß sich selbstverständlich auf einer maingestreamten Seite. Es werde, können wir lesen, „nahegelegt, daß sich die Gibichungen aufgrund ihrer Isolation durch Inzest geschwächt“ hätten.
Jetzt stutzt man allerdings.
Wie? - - - ja: „w i e?“ ruft der ein bißchen mit dem Stück Vertraute in seinem Inneren aus und möchte schon da etwas verzweifeln. Der Inzest sei nicht vielmehr die Abkunft eben Siegfrieds, dem bis in seinen Namen Sproß eines Geschwisterpaars? Statt seiner sind die Gibichungen inzestuös? Dabei vermöchte doch die Genealogie des Siegfrieds Geistesschwachheit ein bißchen zu erklären...
So kommt nun zwar zur groben Stanzung die Verwirrung, aber bitte, der Regisseur hatte halt eine Idee. Man kann sie ihm ja lassen, den Wagner bringt das nicht um. Doch szenisch sollte sie was bringen. Das tut sie aber nicht; nicht einmal die von hier aus naheliegende, sozusagen rassistische Entwicklung zum sogenannten Lebensborn hin, also zu Hitler, läßt sich damit begründen, da Brünnhilde ja eben göttlicher - historisch gesehen, monarchischer - Herkunft ist. Wie soll denn das einen Neuen Menschen ergeben? Also muß man das irgendwie biegen, Brünnhilde biegen, die nun, nach ihrer „Übermannung“ durch Siegfried, zu einem Hausmuttchen gemacht wird, das brav die Rückkehr ihres tumben Gemahles erwartet. Das ist einerseits ziemlich banalfeministisch und macht zum anderen den peinlichen Brünnhildenfelsen, als eine Gute Stube nämlich, gleich noch doppelt peinlich. Außerdem geht das in überhaupt keiner Weise mit der vor die Hörer:inne:n geknallten Gesellschaft empathielos-technoider Cyborgs zusammen, die Cassiers als drohende Zukunft eigentlich im Auge hat: als Ergebnis einer Menschheit, die nach dem Untergang des Mythos sich Katastrophen selbst schafft, weil, so wieder das Programmheft, es nach den Göttern nichts mehr sei mit Transzendenz. Das Dumme ist nur, daß auch vorher mit ihr nichts gewesen ist, es sei denn, daß Cassiers unter Transzendenz das sich durchsetzende „Recht“ des Stärkeren versteht. Abgeklatschter geht‘s nicht, zumal die Botschaft, es komme nach den Göttern, was mit ihnen schon war, den ökonomischen Aufwand wirklich nicht rechtfertigt, dessen die Neuinszenierung eines Rings des Nibelungen bedarf. Es geht allerdings sehr gut zusammen mit der Statik dieser Interpretation und letztlich, leider, auch mit dem Fries. Die Menschen werden‘s treiben, wie‘s schon die Götter trieben: deren „passions humaines“ waren schon die ihren. - Was sind wir da ergriffen!  Trotzdem, es gab auch spannende Momente, vor allem ab dem zweiten, dem lebendigeren Akt, und sowieso jedesmal, eben, wenn Hagen auftrat; ja, gegen Ende des Stücks gewinnt sogar Gunther ein gewisses, durch Reifung, Format; bis zu seinem Tod aber blöde bleibt Siegfried. - Bezeichnend übrigens - mir ist das, das ist gleichfalls bezeichnend, früher so nicht aufgefallen -, wie geradezu spontanbaggernd Siegfried, auf Fingerschnipp nach Vergessenstrunk, auf die ihm doch ganz fremde Gutrune zuklotzt und, quasi, „eyy ficken, Alte!“ sagt - in Wagners Verdrängungslürik klingt das so: „Ha, schönstes Weib!/Schließe den Blick!/Das Herz in der Brust/brennt mir sein Strahl:/Zu feurigen Strömen fühl‘ ich/ihn zehrend zünden mein Blut!“, woraufhin er sich zu ihrem Bruder wendet und nach dem Namen der Frau fragt. Der gibt ihn ihm - und damit gibt er s i e. Den Namen von etwas zu wissen, bedeutet, mythologisch gesprochen, immer schon die „Sache“ zu haben. In einem mythischen Spiel sollte man das wissen. - Gutrune selbst nennt ihren Namen nicht.
Daß Cassiers über solche Zusammenhänge tumb wie Siegfried hinweggeht, ist eine der Hauptschwächen seiner Inszenierung. Immerhin wird Brünnhilde nach und durch Siegfrieds Tod die Lockenwickler wieder los und läuft auch bei Cassiers zur walküren Form neu auf; wo Iréne Theorin als liebende Frau nicht so richtig funktioniert, weil zwischen den Partnern, sie nicht minder grobschlächtig als er, überhaupt kein Eros funkt, wird sie, die Sängerin, als Anklägerin tatsächlich groß und hat sich ihre Braviwogen rundweg verdient, die sie nachher überhäuften. Die innige Gestaltungskraft jedoch, durch Wärme, mit der zum Beispiel Waltraud Meier diese Rolle füllte, geht ihr schlichtweg ab. Ihre Stimme hat Stahl, aber sie kann nicht schmilzen und also auch nichts schmelzen. Ihr Partner, immerhin, Ian Storey, gab seinem Siegfried Männlichkeit. Das ist schon mal was, wenn dieser unangenehme Typ nicht auch noch wie ein aus dem Leim gegangener Kastrat daherkommt. Aber der wirkliche Star des Abends war Hagen.  Nachdem alle Musiker abgefeiert waren, gab dann eine übers Regieteam hagelnde Buhlawine dem Unbehagen einen geradezu wütenden Ausdruck. Nicht, so hoffe ich, weil eine Inszenierung danebenging - es ist ein wichtiges künstlerisches Recht, daß man scheitern darf -, sondern weil wir spürten, wie groß dieser Ring hätte werden können, wie hinreißend Cassiers und Bagnolis bildliche Grundidee ist, wie perfekt sie sich auf die Götterdämmerung legen könnte, um ihr neue Tönung zu geben, daß aber, statt, wie >>>> Jonas Wergelund fordert, g r o ß zu denken, klein gedacht worden ist. Darunter haben dann a l l e zu leiden, die Sänger, das Orchester, selbst ein Dirigent vom Range Barenboims. Alle sie wurden in einen Holzschnitt verbannt - oder, um im Bühnenbild zu bleiben, in ein pompös mit buntem Lichtspiel schickgemachtes Fries.
Ich geb es zu, im Ersten Akt nickte ich zweimal ein; einmal weckte mich der dumpfe Knall meines am Boden aufkommenden Notizbuchs. Peinlich, aber irgendwie nicht meine Schuld, der ich dieses Stück geradezu auswendig kenne und ziemlich genau weiß, auf was als nächstes zu achten wäre. Da ist man frustriert, wenn da nichts kommt, und wird dann furchtbar müde. Vielleicht aber nudeln sich Stücke, derart geniale Würfe sogar, mit den Jahrzehnten einfach ab. Man wächst vielleicht aus ihnen hinaus und sollte dann nicht mehr hineingehn. Ich bitte Sie deshalb, meine Kritik mit diesem Vorbehalt zu lesen. 
*******
Richard Wagner
GÖTTERDÄMMERUNG
An der >>>> Staatsoper im Schillertheater Berlin.
Inszenierung Guy Cassiers - Bühnenbild Guy Cassiers, Enrico Bagnoli
Kostüme Tim Van Steenbergen - Licht Enrico Bagnoli - Video Arjen Klerkx, Kurt D'Haeseleer
Choreographie Sidi Larbi Cherkaoui - Chor-Choreographie Luc De Wit
Choreinstudierung Eberhard Friedrich - Dramaturgie Michael P. Steinberg, Erwin Jans, Detlef Giese
Ian Storey - Gerd Grochowski - Johannes Martin Kränzle - Mikhail Petrenko - Iréne Theorin - Marina Poplavskaya - Margarita Nekrasova - Aga Mikolaj - Maria Gortsevskaya - Anna Lapkovskaja
Tänzer
Ilias Lazaridis - Laura Neyskens - Ruth Sherman - Christophe Linéré
Staatskapelle Berlin, Staatsopernchor
Daniel Barenboim.
Die nächsten Vorstellungen:
6., 10., 31. März, um 18 bzw. 16 Uhr.
10. und 21 April, 18 bzw.16 Uhr
>>>> Karten.
 albannikolaiherbst - Mittwoch, 6. März 2013, 10:29- Rubrik: Oper

Es gibt Opern, die sich zur Überhöhung eignen, ja nach ihr rufen, nach einer gewissen Form der Abstrahierung, des Versetztwerdens in Überzeitlichkeit, um den >>> Begriff eines „Ewigen“ bewußt zu vermeiden, etwa bei und für Wagner, auch für Schoecks große Penthesilea etwa, nach Kleist; es gibt Opern, die anders gar nicht zu realisieren sind, allenfalls als Bizarrerien, absurdes Theater und die so schon vom Komponisten und dem Librettisten angelegt sind; solche, mit denen man das machen kann; an der Komischen Oper der Falstaff hat das einmal sogar für Verdi gezeigt; aber es gibt Opern, bei denen so etwas gründlich schiefgeht, schiefgehen m u ß, dazu gehört sogar Strauss‘/Hofmannsthals Rosenkavalier; derart nahe am Individuum sind sie gebaut, und zwar am speziellen, einem, das sich nicht für allgemeine Aussagen - allein u m der Allgemeinaussage willen - eignet. Dazu gehört, für mich, ohne Zweifel Benjamin Brittens Peter Grimes. David Aldens Inszenierung der English National Opera London hat sich daran gehalten, fast durchweg, nur in einzelnen Hinsichten abstrahiert sie ein bißchen, etwa bei mit allerdings nicht immer bedeutungsklaren symbolischen Handgesten der Darsteller. Im übrigen ist sie auf eine schlagende Weise naturalistisch; man könnte von einem Fotorealismus sprechen, besonders im einfach nur hinreißend, gespielt wir gesungen, musizierten zweiten Akt der Oper, wenn wir die metallgraue Nordsee sehen, in bleigrauen Tönen über ihr die Wolken geballt, aber Sonne dringt hindurch und fällt mächtig und warm und wie ein Versprechen auf den Poller, ja verführerisch, so sehr, daß Ellen Orford sich ihres Mantels entledigt, glücklich; und wie sie versucht, auf das gestörte Heimkind ein wenig ihrer Zuversicht zu übertragen - alleine dafür lohnt sich der Besuch dieser Inszenierung; man wird diese Szene nicht mehr vergessen.
Das liegt auch an der enormen Präsenz Magdalena Kaunes, über die ich >>>> bereits früher schrieb und die ich, es möge mich zerknirschen, Magdalena Kožená wegen fast vergessen hatte; an sich gehörte sie, Kaune, in >>>> meine Liste idealer Marschallinnen mitten mit hinein. Ich erinnere mich nun auch, daß ich versucht hatte, ihren Namen bei der Besetzung für >>>> Kreneks Eurydice ins Spiel zu bringen, leider ohne den nötigen Nachhall, bzw. war es schon zu spät gewesen. Sie jedenfalls, Michaela Kaune, war der nicht nur heimliche Star dieses Abends, nicht nur ihrer körperlichen - gestisch, Ausdruck, weiblicher Aura - Präsenz halber, sondern wie sie die Töne anschwellen läßt, anstrengungslos, hat man den Eindruck, aber angestrengt, nämlich nie nachlassend, in der Menschlichkeit, der sie den Ausdruck verleiht, und wie das den ganzen Saal füllt, strahlend, überstrahlend, dabei dennoch in der sanften Hoffnung ihrer Rolle demütig, erfüllt geradezu, ja, von einer bescheidenen, aber nicht einen Schritt der Meute weichenden Zivilcourage, das ist zum SichVerlieben, Li e b e n !, gut.  Ich hätte ihr eine Rose überreichen mögen, aber dazu bedarf es eines andren Momentes, der jenseits andrer Menschen ist, abseits jedes Zeugen. - Oh, schwer hatte es Peter Grimes!  Dieser wie sein Sänger, Christoph Ventris. Während aber jener sein Lebensziel verfehlt, hat sein Sänger mehr als nur bestanden, auch, wie die übrigen Mitwirkenden, vor allem auch der Chor, gegen Runnicles und seines Orchesters hochexpressives, dabei völlig durchsichtiges Musizieren, das Bässe zu heben vermag, wie ich sie selten aus Orchestergräben hörte: Der Sturm, der draußen über die Küste hereinbricht, tobt wirklich und amalgamiert wirklich mit dem Haß der Menge, und die Versprechen, die von der Sonne auf die aber nur zeitweise wieder geglättete Meereswut gestrichen werden, haben wirklich den Schmelz und versprechen wirklich das Glück und sind wirkliches Sentiment aller Menschen. Es ist ungeheuer, was Runnicles da mit seinen Musikern macht oder was sie für ihn machen; alles, was große Oper auszeichnet, ist da, nur einmal ging‘s im schweren Blech schief, dritter Akt ungefähr Ende Bild 1, aber selbst das wirkte wie beabsichtigt, gehörte in diese Mischung aus Verzweiflung, verhinderter Liebe, Sorgsamkeit und die von fast aller Seelen einer anderen Seele zurückgespiegelten Gewalttätigkeit der Natur, an der sie hier alle hängen in dem kleinen Fischerort an der harten See. Wie furchtbar sie ist, und wie furchtbar, deshalb, ihre Menschen werden, erzählt ein- für allemal Montagu Slaters Libretto: In ceaseless motion comes and goes the tide.
Flowing, it fills the channel broad and wide.
Then back to sea with strong, majestic sweep.
It rolls in ebb, yet terrible and deep.
Nein, Grimes hat es nicht leicht. Er ist ein harter, unerbittlicher, wortkarger Mann, der aus dem Elend herauswill, den großen Fang machen will, „ich werde euch fluten mit Fischen!“ beschwört er, der Gemiedene, wegen seines Willens Gemiedene, seiner Unangepaßtheit, seiner Unbedingtheit, die ihn auf einem Fang seinen Lehrjungen verlieren läßt; und erst, als der ertrunken und er, Grimes, keine Hilfe mehr hat, den großen Fang nach London zu bringen, kehrt er um, schüttet den Fang ins Meer zurück, weil für einen allein das Boot zu schwer ist, um es noch lenken zu können. Man spricht ihn in der Gerichtsverhandlung frei, verbietet ihm aber, sich einen nächsten Lehrjungen zu nehmen, was für ihn, für seinen Willen, unannehmbar ist und worüber er sich hinwegsetzt. Die Rede geht klatschend, tratschend, denunzierend um: er mißhandle seine Jungs und werde auch diesen noch zu Tode bringen. Da stürzt der Junge von der Klippe, und auch der außer der liebenden, besorgten Ellen Orford einzige Mensch, der ihm beigestanden, wendet sich nun ab: „Sail out till you lose sight of land, then sink the boat./ D‘you hear? sink her!/ Good-buy, Peter.“ Und der gestoßene, gescheiterte Mann, nunmehr für immer verstummt, tut es. In die herbeigekommene Menge weiß dann Mr. Swallow zu berichten, die Küstenwache habe weit draußen ein Boot sinken sehen. „Once of these rumours“, kommentiert das mitleidlos die mitleidlose Auntie.
Christopher Ventris heller Tenor und seine immer halb tumbe, halb aufbegehrende Gegenwart geben Grimes Tragik einen furchtbaren, für uns furchtbaren, Ausdruck: Es gibt für einen wie ihn keinen Ausweg, er sagt das mal selbst, daß es nur der Tod sei, was ihn erlösen könne; an das zarte Genrebild, das er in einem sehr kurzen Moment des Loslassens, zweites Bild des zweiten Akts, vor seinem zweiten Lehrjungen, direkt bevor der abstürzt, halluziniert, glaubt er ja selbst nicht - ja, man kann sagen, genau deshalb, weil er sich diese Schwäche durchgehen ließ, kommt auch dieser Junge zu Tode. So ist alles, was Grimes tut, Kampf; für die ersehnte Zartheit hat er in sich gar keinen Raum.  Er selbst ist wie das Element, von dem er lebt; so rücksichtslos ist sein Griff auf die Jungens, so harrsch, ja ohne jede Empathie, ganz, wie gegen sich, Berserker, der selbst die liebevolle Berührung Ellen Oxords nicht erträgt, als wäre auch die bereits ein Angriff auf seine Seele - wobei zu den musikalischen Höhepunkten dieser Inszenierung ganz unbedingt die Parallelführung von Gemeindegesang in der Kirche und draußen den Versuchen Ellen Orfords zählt, einen Kontakt zu dem verstörten Jungen zu bekommen, und ebenso, wie Runnicles in die jahrmarktige Ausgelassenheit der Feier zu Beginn Akt III das vorhergehende instrumentale Sea Interlude immer noch und noch weiterklingen läßt, wie wenn es von einer Welle mehrmals noch angehoben würde über die Burleske hinweg, in der die Dörfler ihre Säue herauslassen, - und überhaupt, wie hier mit Überlappungen von Klängen gerarbeitet wird, die zu bisweilen erschütternden Verzerrungen werden: Das betrifft insgesamt Runnicles‘ Legierung der orchestralen Seestücke mit je der folgenden oder vorhergegangenen Szene. Ich habe den Grimes bereits einige Male gehört, nie bisher war das derart überzeugend ausgeführt.
Pervers ausgedrückt, ist in dieser Inszenierung die Gestaltung des Furchtbaren makellos, mit Ausnahme allerdings der Burleske von Akt III, 1. Für den gemeinten und hier auch notwendigen Realismus ist es ebenso wenig glaubhaft, daß der Anwalt morgens mit heruntergelassenen Hosen vor den Leuten erscheint, wie sich niemand der vor verklemmt puritanischer Gehässigkeit sich an jederlei Unglück anderer labenden Mrs. Sedleys Hand auf das Gemächt legen würde, vor aller Augen, noch würde diese einem Mann wiederholt den Oberschenkel in die Hoden hauen. Insgesamt geht dieses Bild also schief; auch denkt man, wenn plötzlich alle, bei ihren Vergeltungsrufen, Union-Jack-Wimpelchen flattern lassen, jaja, kennen wir, die Selbstbezichtigungsfreude ist nun auch in England angekommen, toll. Aber die intensive Konzentration des zweiten Bildes macht solche Mätzchen schnell vergessen, ein trotz der Musik bis zum Wiederauftreten der Menge fast stummer, sprachstummer Akt; alles, was hier nun geschieht, ist Ausdruck der letzten erreichten Hilflosigkeit, und schließlich spricht wieder, wenn auch durch den Chor, ganz alleine noch das Meer.  Ebenso makellos, nicht selten beeindruckend, die übrigen Sänger, vor allem Albert Pesendorfers Fuhrmann; hinreißend, wie schnell sich sämtliche Mitwirkenden in die Regie dieser „Berliner Premiere“ eingeschmiegt haben - was das ist, eine Berliner Premiere, darüber habe ich >>>> an anderer Stelle geschimpft, aber wenn eine Inszenierung von solcher Gültigkeit ist, werden meine Argumente zu einem Kartenhaus; auch im Fall von >>>> Nonos Gran Sole war das schon so.
Also gehen Sie bitte >>>> in diese Inszenierung hinein.
*******
Benjamin Britten
PETER GRIMES
Oper in einem Prolog und drei Akten
Libretto von Montagu Slater nach George Crabbe
The English National Opera, London
Inszenierung David Alden - Bühne Paul Steinberg
Kostüme Brigitte Reiffenstuel - Licht Adam Silverman
Chöre William Spaulding - Choreographie Maxine Braham
Dramaturgie Angelika Maidowski
Christopher Ventris - Michaela Kaune - Markus Brück - Rebecca de Pont Davies - Hila Fahima - Kim-Lillian Strebel - Thomas Blondelle - Stephen Bronk - Clemens Bieber - Dana Beth Miller - Simon Pauly - Albert Pesendorfer - Thomas Schneider - Stefan Stefanow - Bram de Beul - Maja Siebenschuh - Heiner Boßmeyer - Aram Youn - Holger Gerberding - Björn Struck - Aram Frank - Robert Neumann - Tadeusz Milewski
Chor und Orchester der Deutschen Oper Berlin.
Donald Runnicles
Die nächsten Vorstellungen:
Di 5. Februar, Sa 9. Februar, Mi 13. Februar, Fr 15. Februar 2013,
je um 19.30 Uhr.
>>>> Karten
[Veröffentlicht am 27. 1. 2013.]
 albannikolaiherbst - Dienstag, 5. Februar 2013, 08:15- Rubrik: Oper
[Fotografien zur Wiederaufnahme (©): >>>> Monika Rittershaus.
Weitere Fotografien aus den Programmheften und dem Netz, da je mit Nachweis.
Außerdem aus dem Saal: ANH/iPhone.] Richard Strauss‘ Rosenkavalier ist - Leser:innen Der Dschungel wissen es - Seelenstück für mich. Das macht es, wenn ich eine Inszenierung bespreche, heikel, weil ich jede an einer inneren messe, die sich in mir aus Carlos Kleibers musikalischer Auffassung, Götz Friedrichs ewiger Inszenierung an der Deutschen Oper Berlin, sowie einer Aufführung an der Semperoper aus einer VorZeit synthetisiert hat, in der ich noch keine Musikkritiken schrieb; aber ich habe das Programmbuch noch: es war dort, am 15. März 1992, die 53. Vorstellung seit 1985 in einer auch schon längst gewandelten Inszenierung nach Joachim Herz. Ich archiviere seit den frühen Achtzigern sämtliche Programmhefte und -bücher der von mir besuchten Inszenierungen; allein für den Rosenkavalier ergeben sie, nebeneinander, zwei Handspannen Länge, die, über Wien, eine Landkarte von New York City bis nach Palermo ergibt. So versessen wie auf dieses bin ich, abgesehen vom Tristan und vom Falstaff, auf kein anderes Stück des, nennen wir‘s mal, „bürgerlichen“ Repertoires. Seltener gespielte, mir ebenso wichtige Komponisten, Britten etwa und Schoeck, sowie Dallapiccola, lasse ich bewußt hier aus.
Bereits der Länge dieser Einleitung können Sie entnehmen, wie gefährlich ungerecht meine Meinung im Fall des Rosenkavaliers ausfallen kann; an sich müßte ich befangenheitshalber von öffentlichen Stellungnahmen Abstand nehmen. Andererseits sorgt eben diese Befangenheit, die ich, mir des Kitsches durchaus bewußt, meines Herzens Engagement nennen möchte, für die Glut, die ich auf meine Leser:innen zu übertragen versuche. Je persönlicher, meine ich, eine Rezension ist, desto mehr kann Sie Ihnen geben, gerade auch, weil sie sich ebenso angreifbar macht, gleichsam die Hemdbrust öffnet, wie eine besprochene Aufführung selbst. Eine nahezu jede nämlich, auch wenn sie scheinbar mißlang, ist von leidenschaftlicher Arbeit, der auch Seelenarbeit sämtlicher Beteiligten, geprägt. Die Kritik in ihrer - je schein-objektiver, um so härter - urteilenden Selbstfetischisierung vergißt das allzu oft: der hinauf- oder hinabgestreckte Daumen ist eines der beiden Teufelshörner der Verdinglichung. Ihr zu entgehen, bedarf es ihrerseits eines künstlerischen Prozesses: Die Kritik selbst hat Kunst zu sein, als Teil nämlich des besprochenen Kunstwerks. Dies also vorweg, hörte ich an der Staatsoper Berlin vorgestern abend die sechzigste Vorstellung seit der von mir ebenfalls besuchten Pemiere des 26. März 1995 - siebzehneinhalb Jahre, also, ist Nicolas Briegers Inszenierung bereits alt; ich habe bereits mehrfach, in Der Dschungel zuletzt >>>> dort, über sie geschrieben und deshalb, bevor ich die Neuaufführung sah, gedacht, daß ich es kurzmachen und allein noch über die Sänger:innen sowie das Dirigat schreiben könne. Das war ein Irrtum. In guten Fällen bedeuten Neuaufnahmen sehr alter Produktionen Reifungsprozesse; bisweilen greifen sie sogar - wenn auch meist in den Details - in die frühen Konzeptionen ein. Mir scheint, dies ist hier in einem besonderen Maß geschehen, ohne, leider, daß mitgeteilt wird, wer die neuen Ideen geliefert. Dabei sind sie frappierend, einige jedenfalls, wie ihre Umsetzung besonders. Deshalb muß ich spekulieren und will das auch tun: daß sich die junge Sophie, als Innenwendung ihres Widerstands gegen das rigide Verheiratetwerden, mit der Schere mehrmals in die Innenhand sticht, etwa, ja, sie hineinbohrt, hat es meiner Erinnerung nach vorher ebenso wenig gegeben, wie den anderen Stich, nunmehr Sophies und Octavians, mit dem nach ihrem ersten Ineinanderblick beider Liebe beginnt - an einem Dorn der überreichten Rose nämlich. Die zwei jungen Menschen lutschen dann am Daumen ihre kleinen Wunden aus, die sie ganz woanders - ja, empfangen haben, muß ich schreiben. Das ist eine in ihrer Feinheit ungeheure Szene, die Briegers politisch orientierte Interpretation in ein geradezu Ewiges transzendiert. Es geschieht ja uns allen, wenn uns >>>> des Furchtbaren tiefst beglückender Pfeil trifft. Gerade daß es diesmal nicht beim Blick-allein bleibt, der >>>> Anagnorisis nämlich, sondern konkretisiert wird, rückt die Personen ins für immer Menschliche. Das ist ein hochparadoxer Vorgang, weil gerade in der Konkretisierung Verallgemeinerung wird, wie sich zugleich der Abstaktionsvorgang, den diese bedeutet, restlos persönlich macht. Das, in der Tat, habe ich in keinem meiner bisherigen Rosenkavaliere gesehen. Wobei ich geneigt bin, die Idee für >>>> Magdalena Koženás zu halten, allein, weil ihre sich radikal identifizierende Schauspielkunst das Wunder hinbekommt, aus einer Hosenrolle tatsächlich einen Jüngling von siebzehn Jahren zu machen, und zwar mit sämtlichen testosteronalen Überschüssen, die so ein junger Mensch hat, allem Pathos, aller Innigkeit, aller Unabgeklärtheit des lebenstürmenden Drangs. Genau das strahlt auch aus ihrem Gesang. Wenn sich dann dieser junge Mann, der doch in Wirklichkeit eine Frau von unterdessen 38 Jahren ist, zur Zofe Mariandl umgezogen hat, bleibt sie auf der Bühne der in einen vielleicht ebenfalls siebzehnjährigen kokotten Backfisch verkleidete siebzehnjährige, teils vom eigenen Witz belustigte, teils aber sichtlich genervter Junge. Koženás derart umfassend gestaltete Unmittelbarkeit fängt aber schon zu Beginn des ersten Aktes an, wenn sich Octavian nach der gemeinsamen Nacht am Boden ausstreckt und in seinen Zehen die erlebte Lust - sie ist aus Wollust und zartester, fast scheuer Verliebtheit gewoben - noch immer nachzuckt. Dieses zusammen mit ihrer stimmlich grandiosen Präsenz macht die Koženás bereits zum zweiten Wunder, das mich diese Staatsopern-Inszenierung hat erleben lassen. Das erste war >>>> Laura Aikins, der seinerzeitigen Premierenbesetzung, Sophie: Sie hob damals den Ton, und mir schossen, ich übertreibe nicht, die Tränen in die Augen.  Da war etwas Himmlisches im Gesang, von dem Hofmannsthals Dichtung auch spricht, von dem aber niemand erwarten kann, daß es sich in dieser Welt jemals realisiere. Ebendas aber, damals, geschah. Damals stand Aikin eine als Octavian tadellose Iris Verrmillion zur Seite, aber eben keine phänomenale - ganz so tadellos „nur“ wie vorgestern abend Anna Prohaska. Wunder, selbstverständlich, lassen sich nicht einfordern. Zumal liegt wiederum Prohaskas Stärke im Realismus ihrer psychologischen Personenzeichnung. Hier spricht kein Engel durch Sophie, sondern sie ist eine junge Heranwachsende unter der Knute des Patriarchats und will ihre Ansprüche geltend machen, ohne doch zu wissen, wie. Daher die in die eigene Handfläche, ja, ein Cutting, fehlgeleitete Aggression. Nicht durch Sophie also wird das Wunder laut, sondern es erscheint ihr, nämlich in der Gestalt des silberglänzenden quasi Bautwerbers; ihre Jugend kann noch nicht sehen, wie menschlich-einfach auch der ist, ganz wie sie selbst. Der nun nur allzu gern den Retter gibt, kaum weniger anmaßend schon als der Ochs und gradlinig allein aus Gründen seiner Jugend.  Diese dann, Jugend - und notwendigerweise, muß man schreiben -, wird schließlich vor der Marschallin Größe die Knie beugen.
Auch diese freilich lebt in der Ambivalenz des bürgerlichen, bzw. spätfeudalen Vorscheins. Ihre Größe aber ist ihre Haltung, der, eigentlich, Hofmannsthals Lebwohl gilt: Die anbrechende Zeit wird nur noch schachern. Das Geniale an dem Libretto ist, daß der Dichter in Frau v. Werdenberg eine Geschichtsära zugleich mit einer Lebensära enden läßt; in der Marschallin hat, was Niebelschütz, >>>> in wiederum s e i n e m großen Abgesang, Anciennität genannt hat, ein letztes, bei Hofmannsthal viel weniger politisches als intimes Erblühen - Entblühen aber, eben.
Ob sie es weiß? Es gibt Indizien dafür, daß sie es allein für eines ihres Lebensalters hält - was in den meisten Inszenierungen des Stücks dazu führt, daß die Partie zu alt besetzt wird. Tatsächlich befindet sich die Frau ganz im Gegenteil auf der Höhe ihres Geschlechts; von Klimakterium kann, ja darf noch gar keine Rede sein, damit die Figur nicht versehentlich in die Dynamik des Ochs‘ gerückt wird, gleichsam als Beispiel neben ihn gestellt, wie man es „besser“ mache. Darum geht es allenfalls am schwankhaften Rande. Anders als er, der mit seinem Namen schachert, hat sie Lebensgeschichte-selbst im Blick, spürt sie, kann nicht anders, als sich ihr auszusetzen. Das meint vor allem, daß sie der Naivetät nicht mehr entspricht, die sie zugleich vermißt; doch schon am Morgen nach der Liebesnacht begegnet sie ihr mit Form: „Ein jedes Ding hat seine Zeit“, sagt sie zu Octavian und möchte mit ihm frühstücken, der er doch immer nur noch weiter in ihren Leib sich verschwärmen möchte. Genau hier ist die Differenz - genial von Hofmannsthal - schon im Detail erzählt. Die Fürstin Werdenberg ist eine verheiratete Frau, die, bekäme sie welche, Geschenke ihres Liebhabers verstecken müßte und das auch tun würde. Deshalb sieht sie das Ende dieser Affaire schon voraus. Bitter ist das, weil sie selbst verliebt ist, zugleich, und weil die Unbedingtheit ihres jugendlichen Geliebten so süß ist - „süß“ aber auch in einem Sinn, der Frauen eine bestimmte Art Mann süß nennen läßt. Sie streichen ihm beim Küssen zugleich wie Mütter übern Kopf. Womit Frau v. Werdenberg allerdings nicht rechnet, das ist, wie schnell die Trennung dasein wird - die sie doch selbst herbeiführt. Schließlich schickt sie selbst den Jungen als Rosenkavalier zur Sophie; es wäre dafür keine Not gewesen, ja, s i e - wer anders sonst? - gibt auf die künstliche Rose noch diesen Tropfen Öls, der Aikin ihre engelischen Höhen erreichen ließ und auch von Prohaska, selbstverständlich, bemerkt, aber von ihr schon mit einer noch unbewußten Skepsis besungen wird, die ihrer eigenen Reifung die Marschallin vorausnimmt.  Das wirkt bisweilen, und zwar zu recht, zickig - nämlich, ohne schon die Größe eines fraulichen Empörtseins über das zu haben, was man ihr als Heiligen Stand der Ehe aufheucheln will. Noch begreift sie nicht recht, daß der eigene Vater sie aus Aufsteigergründen grob auf den Markt stellt. An Aikins Sophie wäre das damals, nachdem sie Octavian gesehen, auch gar nicht mehr herangegangen - weshalb sie dem Rosenöl- selbst Stimme geben konnte. Prohaska hingegen gibt sie ihrer Wahrnehmung des Rosenöls. Das ist, wie fein auch immer, ein Unterschied von Dimensionen, der ganze Inszenierungen bestimmen und auch umwerfen kann. Ein Regisseur, und sei er noch so eingriffslustig, kann da nur kapitulieren.
Vor der Erscheinung aber auch. Was ein wenig der Dorothea Röschmanns Marschallin Problem ist, zugleich aber auch eine mich fast überraschende Stärke. Zwar, sie hat nicht den stupenden Eros der Würde Karen Armstrongs  , wenn auch sie eigentlich für diese Partie schließlich zu alt gewesen ist, und schon gar nicht den zum Niedersinken anbetungswürdigen der Gwyneth Jones‘, 1976 bei >>>> Carlos Kleiber und Otto Schenk: Jones, zusammen mit Elisabeth Schwarzkopf war wohl die ideale Marschallin, an der sich alle späteren Interrpretinnen, so ungerecht das auch ist, messen lassen müssen. Was Dorothea Röschmann dem hinzugibt, ist paradoxerweise etwas, das Hofmannsthal von der Würde gerade bedecken lassen will: den Schmerz. Bei dem Dichter soll er allein über die Form spürbar werden, mit der die große Frau ihm begegnet. Röschmann statt dessen - die seinerzeit, in der ersten Aufführungsserie mit der Aikin-vom-Himmel, die kleine Rolle der Modistin sang - nimmt sie, die Form, zurück, die ja Vermittlung immer auch ist, und gibt dem Schmerz einen geradezu direkten Ausdruck, sowohl schon im ersten Aufzug wie vor allem, wo sie einmal sogar die Fasson ihres Gehens verliert, im dritten. Indem sie mehr von sich zeigt, als ihr die Anciennität eigentlich verstattet, und indem man dies mit den Marschallinnen der Armstrong, Jones und Schwarzkopf sieht, wird ihrerseits die vorgezogene Abgeklärtheit zurück in den Schmerz genommen, die diese Frau über die angeblich schon nahende Zeit des Älterwerdens vielleicht ein bißchen zu weise sagen läßt: Allein man muß sich auch vor ihr nicht fürchten.
Auch sie ist ein Geschöpf des Vaters,
der uns alle geschaffen hat.„Älter werden“ ist freilich höchst relativ; für die meisten Frauen meines Umgangs wurde, ihrem Vernehmen nach, die Jahreszahl dreißig als entscheidend empfunden; eben das, meine ich, wäre bei poetisch wahrer Besetzung mitzubeachten. Es geht um den Abschied von der Naivetät, will sagen: von der Jugendlichkeit, viel mehr, als tatsächlich ums Altwerden: Kurz holt Röschmann im ersten Aufzug die ihr selbst einst überbrachte Brautwerber-Rose hervor und tut sie aber schnell wieder weg, tut also das Mädchen wieder weg, das sie einmal gewesen. Was wir hier spannenderweise erleben, ist nicht etwa ein Reifungsprozeß des jungen Octavians oder des noch-Mädchens Sophie, sondern eben der Marschallin. Indem sie sich jetzt als alte Marschallin imaginiert, balanciert sie in sich das Mädchen, das sie eben auch noch ist - „Wo ich doch immer die gleiche bin“ -, mit der reifen Frau aus. Genau das ist der Prozeß, an dem uns Hofmannsthal und Strauss teilhaben lassen. Weil das tatsächlich zutiefst intim ist, braucht die Marschallin die Würde. Da ist es mehr als gewagt, ihren Schmerz allzu sehr auszustellen, zumal im dritten, dem ab seiner zweiten Hälfte höchst öffentliche Aufzug. Daß Röschmann der Konventions-Verstoß dennoch wirklich gelingt, ist um so mehr eine staunenmachende Leistung, als ihre äußere Erscheinung der Jones‘ und Schwartzkopf Schönheit, vor der man sowieso nur verstummt, eben nicht hat - ein um so größeres Handicap, als Joachim Herzogs Kostüme den untergehenden Adelsstand verpopanzen wollen. Um eben das zu vermeiden, hat seinerzeit Götz Friedrich nicht, wie mit Carlos Kleiber auch Otto Schenk, historisierend das Rokoko, sondern die Zwanziger/Dreißiger Jahre ins Interieur inszenieren lassen:  Obwohl auch das historisiert und seinerzeit zu einigem Widerspruch geführt hat, hob es das Geschehen in die Zeitlosigkeit und konzentrierte den Blick auf die Marschallin selbst, indessen Briegers Blick kritisch politisieren will. Das historisiert die Inszenierung nun aber erst recht, nämlich auf die politische Machtübernahme durch den Aufsteiger-Kapitalismus, dem jeder Preis, auch der der eigenen Tochter, recht ist, wenn das Geschäft reüssiert. Röschmanns Schmerzbetonung nimmt diesen Aussagewille, siebzehn Jahre später, wieder zurück, quasi, als wollte sie uns zeigen, worum es im Rosenkavalier denn eigentlich gehe. Denn welche Erkenntnis, die wir nicht ohnedies schon hätten, haben wir von >>>> Briegers Lehrstückansatz? Ich mag meinen Einwand nicht wiederholen, der Link mag genügen. Die Sängerinnen der Aufführung des 23. Dezembers, die der wiederneue Anlaß dieser Überlegungen sind, kritisierten ihn sowieso besser als ich: sinnlicher nämlich und eben darum „wahrer“. Die Sänger innen, das muß betont sein. Denn Jürgen Linns Ochs hatte durchaus Schwierigkeiten, sich gegen die stimmlich massive Strahlkraft all dieser Frauen durchzusetzen; schon das ließ die Figur sich in ihrer lächerlichen Selbstüberhebung völlig verlieren; daß Linn seine Partie gerne ‚weanert‘, was zu der Partie auch paßt, machte es ihm dabei nicht leichter. Hinzu kommt, daß der Ochs für den jungen Octavian gar nicht wirklich Gegner sein kein, was abermals nichts mit dem Alter, sondern alleine mit Haltungen zu tun hat; der >>>> Graf Mandryka, wiewohl im etwa selben Alter, wäre als Mitwerber von einem durchaus anderen Kaliber gewesen. Der freilich hatte das Glück, in der blutjungen Arabella einer Sophie zu begegnen, die in der Seele bereits Marschallin w a r. - Ochsens Grobschlächtigkeit jedenfalls ist bei Hofmannsthal/Strauss ein sehr bewußt gesetzter Kontrepart zu den Frauen; kommt er nicht in gleich stimmlichem Maß durch, gerät die Balance dieser Oper ins Wanken. Interessant war in dieser Aufführung, wie dadurch der reiche Emporkömmling Faninal betont wurde, den Michael Kraus stimmlich mit geradezu Männlichkeit füllte, so daß man sich fragte, was der berechnende Mann eigentlich von dem Ochs noch will, wenn doch der sehr viel handlichere, weil zukunftsträchigere Octavian zur Verfügung steht. Damit die Psychologie der Oper stimmt, muß sich Faninal dem Ochs unterlegen fühlen. Überstrahlt er ihn, ist ihm das kaufmännische Kalkül, das die Nobilitierung seines Vermögens betreibt, nicht mehr wirklich abzunehmen. Da wird die wie auch immer durchschaubare Aufsteiger-Pfiffigkeit des vorausbilanzierenden Kaufmanns, die ihren ökonomischen Wert sehr wohl kennt, zur domestiken Unterwürfigkeit eines Lakaien, dem keiner mehr abnehmen kann, daß er die kommende Weltordnung repräsentiert. Ebenso wenig akzeptabel wären für einen solchen Mann die Übergriffigkeiten der lerchenauerschen Dienerschar, die Brieger nicht nur jeden erdenklichen Unfug in Faninals Haus anstellen läßt; nein, die dürfen auch unwidersprochen eine Hausarbeiterin nackt auf die Bühne scheuchen und im Entrée wohl auch vergewaltigen. Das ist in Briegers Inszenierung von Anfang an mehr als ein nur läßliches Ärgernis gewesen, vielmehr ein strohdummer Macho-Unfug, der die vielen Jahre leider überlebt hat, ohne daß ihn zumindest männliches Erregtsein begründen würde. Tatsächlich ist er pur ideologisch gemeint: So schlimm hat es der Adel getrieben, jajaja, so rechtlos war das Gesinde. Daß es gerade im Rosenkavalier auch um die gesellschaftliche Konvention geht, verliert solche Agitation aus den Augen. Wenig glaubhaft überdies, daß sich der Ochs, er selbst, von seinen Dienern sowas bieten ließe. Er mag vertraut mit ihnen sein; Kumpel aber sind sie ihm nicht, dessen verblasene Eitelkeit sich auf nichts so viel einbildet wie auf seine Herkunft. Sein Dünkel mag grob ungeschlacht sein, ist aber immer noch Herablassung. Genau daran will ihn die Marschallin schließlich auch fassen: Er ist, mein ich, ein Kavalier? Da wird Er sich halt gar
nichts denken.
Das ist, was ich von Ihm erwart.Und ist gleich um so fassungsloser, daß er den Verzicht nicht begreift, seinen, der zu leisten wäre, wie den ihren, der geleistet i s t. Wunderbar, wie da die Röschmann genau das aus sich heraussingt - die verwundetste Marschallin, die ich jemals sah:  Nicht von ungefähr kommt es aber auch, daß direkt davor Ochsens „Weiß bereits nicht, was ich von diesem ganzen qui pro quo mir denken soll“ zu den schönstgesungenen Stellen des Abends gehörte; da wurde Jürgen Linns Baß auf dem Bett der hier freilich parallelgeführten Streicher wirklich einmal weit. Letztlich war insgesamt das Orchester sein Problem
Denn Simon Rattle dirigiert diesen seit Donald Runnicles schon durch viele Hände gegangenen Rosenkavalier gnadenlos sinfonisch, was dem leicht mal zu zuckrigen Schmelz ähnlich gut Pari bietet wie einst Kleibers klangexzentrisches Modellieren oder Karajans stark forcierte Tempi taten; besonders hebt er, Rattle, einzelne Orchesterfarben, ja Instrumente hervor, gestaltet das dankenswerterweise nicht von quatschigen Pantomimen illustrierte, sondern vor herabgelassenem Vorhang musizierte Vorspiel des dritten Aufzugs wie eine, hinreißend, sinfonische Dichtung. Daß er sich im übrigen seine Sänger:innen wie als ihrerseits auf virtuose Instrumente verläßt, geht indes auf die Textverständlichkeit. Das war nicht nur bei Jürgen Linn ein Problem. Rattle hebt die Sänger:innen nicht, sondern setzt ihre Ebenbürtigkeit mit dem Orchester voraus, obwohl der Komponist selbst geahnt hat, es sei bisweilen moderierend vorzugehen: „ Es ist dem Ermessen des Dirigenten überlassen, an Stellen, wo die vorgeschriebene Streicherbesetzung die Deutlichkeit des auf der Bühne gesprochenen Wortes beeinträchtigt, die Anzahl der spielenden Pults zu ermässigen", schreibt Strauss eingangs seiner Partitur. Daß dies für ein nicht für Musik, gar für die Aufführung hochraffinierter Kompositionen, sondern fürs Sprechtheater gebautes Haus - die Iterimsheimstatt der Staatsoper - ganz besonders gilt, sei nur nebenbei bemerkt. Denn wir Liebenden wissen ohnedies fast jede Zeile auswendig, und wen diese Oper erstmals wirklich ergreift, wird sie spätestens beim dritten Mal auswendig wissen. Damit das passieren kann, sollte man aber nicht so viel in die Musik hineinquasseln, wie es das ältere Ehepaar rechts neben mir tat. Der Mann fing dann auch noch zu schnarchen an - in der vierten Reihe des wirklich nicht großen Schillertheaters ist das absolut inakzeptabel. ***Schließlich das große Terzett:  - seltsam gebunden im Tempo plötzlich und saugefährlich, dieses fast largohafte Lento („ mäßig“ getragen steht in der Partitur über Takt 285). Momentelang hatte ich den Eindruck, daß die eine Sängerin um Zehntelsekunden auf die andere wartete und spürbar aller drei Ohren auf das Orchester spitzten, wodurch - wie bei manchen Mahler-Einspielungen Bernsteins - sich die Legierung löste; „nicht schleppen“, wollte ich, abermals mit Mahler, flüstern. So auch ging Rattle in das Schlußduett hinüber, was konsequenterweise nicht den Beginn der neuen Liebe betont, den dieses Duett besingt, sondern den Abschied der Marschallin: „So sind sie halt, die jungen Leut“, sagt Faninal, als er an der Marschallin Arm hinaustritt, und sie, nunmehr auch Dorothea Röschmann, kann das berühmteste, heikelste und bedenklichste aller „Jaja“s singen, die jemals zu Ton gebracht worden sind. Sie tut es abermals mit - nun bereits gefaßtem - Schmerz. Wenn dann, zudem, der kleine Diener auf die schließlich geleerte Bühne trippelt, um nach dem Taschentuch zu schauen, das die Marschallin fallenließ, ohne daß es ihr diesmal ein Octavian aufgehoben, geschweige es an sein Herz gesteckt hätte, dann fühlen wir, sehr bald wieder wisse diese große Frau für ihr Tücherl eine nächste Verwendung.  DER ROSENKAVALIER
Oper von Richard Strauss
Dichtung von Hugo v. Hofmannsthal
Inszenierung Nicolas Brieger Bühnenbild Raimund Bauer
Kostüme Joachim Herzog Chöre Frank Flade
Dorothea Röschmann - Jürgen Linn - Magdalena Kožená - Michael Kraus
Anna Prohaska - Carola Höhn - Torsten Hofmann - Anna Lapkovskaja
Tobias Schabel - Torsten Süring - Michael Smallwood - Stephan Rügamer
Narine Yeghiyan - Michael Markfort - Tobias Schabel - Torsten Süring
Mario Klischies
Staatsopernchor und Kinderchor der Staatsoper Unter den Linden
Staatskapelle Berlin, Sir Simon Rattle Keine weitere Vorstellung in dieser Spielzeit.
 albannikolaiherbst - Montag, 24. Dezember 2012, 08:54- Rubrik: Oper
[Fotografien (©): >>>> Wolfgang Runkel.
Fotografie im Saal: Shasharad Lowan (iPhone).]
In einer musikalisch wunderschönen Einstudierung und Ausführung musizieren, unter der Stabführung Erik Nielsens, das Frankfurter Opernhaus- und Museumsorchester und die beachtlichen Sänger:innen an der >>>> Oper Frankfurtmain Händels berühmten Cäsar - ein wenig manchmal, aber, vielleicht, zu getragen in den Tempi, zu durchgehend getragen; bisweilen wünschte ich mir ein wenig mehr Raserei statt der auf Korrektheit konzentrierten Gebundenheit, kurz: hätte das Temperament, auch auf die Gefahr der einen und/oder anderen Unsauberkeit hin, gerne deutlich befeuert, wäre also ein paar mehr Risiken eingegangen - auch wenn das bisweilen, wie in dem berühmten Zwiesangsspiel des Cäsars mit dem Horn („Va tacito“), noch stärker als vorgestern abend an der Instrumentalisten Grenzen gegangen wäre - die überspringt man allemal mit Ausdruck, der für die weltliche Barockoper wichtigsten Kategorie überhaupt, nämlich der mithin Antipodin einer klassischen „Harmonie“, die uns die griechischen Tempel schon immer für pastellen weismachen wollte und will, wenngleich sie in wenig vornehmen, doch dafür flammenden Farben weithin über das Meer geleuchtet haben. Die Oper des Barocks muß brennen. Für den „guten bürgerlichen Geschmack“ ist da kein Raum, sondern die prozessuale Essenz dieser Ästhetik ein Satz Georges Batailles, demzufolge der Manierismus das F i e b e r wolle. 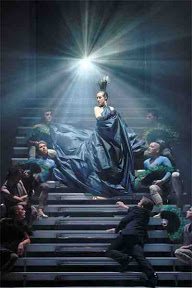 Statt ein solches loszulassen, versucht Eraths Inszenierung bis etwa Mitte Akt II, zeitgenössisch „cool“ zu sein, womit er uns offenbar diplomatische Begegnungen von Kriegsparteien vorstellen will, in denen die Bedingungen von Kapitulationen ausgehandelt werden - möglichst, dem Anschein nach, frei von Emotionen; man gibt sich den Anschein der kalkulierenden (Selbst-)Beherrschung und verstellt sich, um die politischen Ziele jeweils durchzusetzen. Zu falschen Unterwerfungsgesten kommt die intrigante Volte; niemandem ist zu glauben. Tatsächlich handelt auch Cleopatra so, die, als Dienerin verkleidet, den Cäsar umstrickt, um sich nach Pompeos Niederlage gegen Tolomeo, ihren Bruder, die Krone zu sichern. Doch verfängt sie sich im eigenen Verführungsnetz, das sie als Lidia erst, dann bereits in der Erscheinung einer pompös-revuehaft auftretenden Tugendgöttin über den Eroberer auswirft: Ihre Maske wird zum Wesen. Eingewoben in diese Bataille (!) amoureuse à deux sind die politischen Ranküne der übrigen Beteiligten zur Macht: ob Cornelias, der Witwe des, um Cäsars Gunst zu erwirken, von Tolomeo ermordeten Pompeos, ob dessen rüden Generals Achilla, ob Sestos, Cornelias Sohnes, den Eraths Inszenierung anfangs als seine Tochter zeigt, die sich dann als Mann nur verkleidet - inszenatorisch ein wirklich bewundernswerter Kunstgriff, der die Besetzung des Cäsars mit einem Bariton statt einem Counter vollkommen schlüssig macht. Diese musikalisch höchst ungewöhnliche Transskription - im Regelfall werden wie für eine Hosenrolle Frauenstimmen eingesetzt - wird phänomenal gut realisiert, auch wenn eine männliche Stimmlage nicht jede Arie Cäsars mit Händels raffinierter instrumentaler Begleitung organisch amalgamieren läßt. Da aber Erath besonders das Geschlechterverhältnisse im Blick hat, bekommt diesem Cesare der ganz entschieden männliche Zug ausgesprochen gut; er setzt sich nicht nur plausibel, sondern höchst selbstbewußt an die Stelle der dem Barock eigenen „fiebernden“ Künstlichkeit. Das funktioniert wahrscheinlich auch deshalb so gut, weil Michael Nagys Bariton eine Klarheit verstrahlt, die eigentlich für englische Tenöre typisch ist, so daß die in Männerstimmen möglicherweise zu geziert wirkenden Koloraturen geradezu natürlich klingen; Nagy bringt sie völlig unangestrengt zu Gehör, ja geradezu lässig. Und dennoch kann sich die eigentlich mögliche Wirkung nicht recht entfalten. 
Das liegt nicht an dem Sänger. Das liegt nicht an den anderen Sängern. Auch am Orchester liegt es nicht. Sondern an der Inszenierung allein.
Es liegt, eben, an ihrer gewollten Coolness, die vor allem von den Räumen ausgestrahlt wird. Die haben einiges von dem Weiß des Frankfurter Architekturmuseum zur Zeit seiner Eröffnung: Alles ist schön anzusehen, aber leblos. Es war ja auch gar nicht fürs Leben gedacht, sondern für ein Repräsentieren, das seinerzeit der Stadt einen ziemlichen Schuldenberg hinterlassen. Dekorationen kosten viel Geld, zumal dann, wenn jeder Fleck, den eine, und sei's eines Kindes, Hand auf der Wand hinterläßt, ein schönes Aussehn beschädigt, in dem der Mensch nur stört. Solche Dinge - und Interieurs - sind für den Augenschein allein. Für ein interesselose Wohlgefallen, allenfalls, sind sie gemacht, das staunen soll, nicht aber nutzen.
Als Inszenierungsidee, die das Parkett im Auge hat, ist das einerseits konsequent, verhindert aber andererseits ein Überspringen der eigentlich waltenden Emotionen: Die Maske geht auf das Publikum über, das aber, da selbst nicht wirklich beteiligt, sondern eben nur zuschauend, Cleopatras/Lidias Wandlung, die VerfallenWerden ist, nicht teilen kann. Deshalb rief ich „mehr Schmutz!“ in der Pause meiner Begleiterin zu, „da muß mehr Schmutz hinein!“ Allzu moderiert - zu, vorgeblich, zivilisiert - kamen die machtintriganten Geschehen daher. So bleibt, zum Beispiel, Pompeos abgeschlagener Kopf fein im - klar, weißen - Kasten, sonst käm ja Blut auf den Boden. Dann muß im Architekturmuseum schon wieder eine teure Sonderkolonne her, um zu putzen. Da schimpft dann der Stadtkämmerer, bevor er, verzweifelnd, irgendwann das Handtuch wirft. Yannis Koulennis ließ vor Jahren, in seinem legendären Elektra-Bühnenbild an der Lindenoper Berlins, ein halbes geschlachtetes Rind, das noch tropfte, seitlich in die Szene hängen. So etwas hatte ich sofort im Kopf, daß genau sowas nottat, weil alleine die Kühle eben nicht ausreicht, sondern im Zuschauer aufschießende Emotionen, wenn sie denn überhaupt entstehen, sofort ins verhaltene Wohlbenehmen zurückstopft, egal, wie blutig ihr Hintergrund sei. Wenn Erath dann, ab etwa Mitte des zweiten Akts, die Szene plötzlich doch zulangen läßt, sind die Emotionen längst zu erfroren, um die plötzlich nun doch entbundenen noch schockhaft genug erleben zu lassen - zumal sie abermals, nunmehr kulturhistorisch, gefiltert werden, nämlich zitathaft: Unversehens befinden wir uns nicht mehr auf dem diplomatischen Nachkriegsparkett, sondern zu halbamüsiertem Erstaunen im Kintop der ungefähr 50er bis 60er Jahre, worinnen sich Cornelia, um der bis zur angedrohten Vergewaltigung übergriffigen Liebeswerbung Achillas zu entgehen, mit ganzen Haufen Zelluloidstreifen das Leben nehmen will - ja, insgesamt wird die Handlung in ein Hollywood-Studio verlegt  , , und Cleopatras große Aria Piangerò la sorte mia findet vor den riesigen - klar, weißen - Stores statt, auf die die Besetzung dieser Operninszenierung als laufender Abspann einer Cinemascope-Sandale projeziert ist. Als Bild-Einfall ist das wirklich großartig, rückt uns aber Cleopatra abermals fern, die überdies in ihrer Verzweiflung wie Lucia di Lammermoor wirkt; man hat geradezu die Callas vor Augen, viel stärker, vor allem, als die hier eigentlich gemeinte Elisabeth Taylor >>>> Joseph L. Mankiewiczs‘, die ja ebenfalls, und zwar im Film wie im Leben, für eine große Leidenschaft stand, wenn auch nicht für Cäsar, sondern den Antonius des bis zum Haß geliebten Richard Burtons. Kunstästhetisch ist noch problematischer, daß eine solche Historisierung die über die Coolness des Bühnenbilds hergestellte Distanzierung aus nunmehr andrer Perspektive einfach nur wiederholt. Das läßt eine eigentliche Erschütterung, nämlich auch Mitleid - das Sym/Pathos jeder großen Oper - nicht zu, wie intensiv auch immer ihr Gesang sei. Die postmodern glatte, feinsinnig vom Wissen gebildete, so anspielungsreiche wie elegante Auflösung in Zitate widerstrebt ihm, so daß von dem thrillerhaften Kassenreißer, der gerade diese Oper Händels einmal gewesen ist, nichts, aber auch gar nichts übrigbleibt. Das geradezu shakespearsche Königsdrama, das seine Toten stapelt, verpufft in der Uneigentlichkeit. Auf diese Weise wahrt sich der gute bürgerliche Ton noch dort, wo entführt, gedemütigt und geköpft wird; die entfesselten Emotionen werden zum reinen Divertimento; allenfalls, daß man sagen kann, hier solle uns zum Zweck eines aber ebenfalls schon historisch gewordenen, sagen wir, klassenkämpferischen Erkenntnisgewinns etwas nach Art der brechtschen Lehrstücke vorgeführt werden. Nur, welchen Denkgewinn hätten wir davon? In jedem Fall geht das Kathartische verloren, das Leonard Bernstein noch im Auge hatte, als er bemerkte, aus jeder Aufführung einer Mahlersinfonie gehe man gereinigt hervor. Wie sehr sich die großartigen Sänger also anstrengen mögen, ihre Leidenschaft und Leistung wird nur vorgeführt wie von Artisten in einer Arena. Virtuosentum als Futter, bevor man sich den wichtigen Dingen des Lebens wieder zuwendet, etwa der täglichen Ökonomie. Kunst wird zum Durchhaltefilm - was zu Eraths nostalgischem Hollywoodblick höchst prekär aufschließt.
Mag sein, daß Erath genau das angestrebt hat, Händel eben brechtsch zu nehmen, sagen wir: nach dessen Begriff des epischen Theaters. Doch listet das Programmheft sämtliche realisierten und, soweit bekannt, noch unrealisierten Cleopatra-Spielfilmprojekte seit 1899 auf, als wenn sich der Regisseur hätte rechtfertigen wollen: So wenig Vertrauen, offenbar, hat er in seine Ideen, die, wären sie denn in sich selbst und nicht bloß historisierend begründet, das Zeug zu einer wirklich großen Inszenierung gehabt hätten, eine, die tatsächlich und im guten Sinn der Kunst rücksichtslos, allein sich selbst, verpflichtet gewesen wäre. Die Bildkraft hat er allemal, zumal begleitet von der Bühne Herbert Murauers, die sich klein, nämlich niedrig öffnet und dann nach oben hin zu einem wirklichen Saal erweitert, ja wirklich einem Palast, der, abgesehen von der repräsentativen Weiße, einen nicht geringen Teil seiner Wirkung aus der gleichzeitigen - und permanenten - Präsenz des niedrigdeckigen Eingangsbildes mehrere Etagen über der Szene bezieht, sowie von den riesigen Stores, mit denen immer wieder gespielt wird - aber auch hier gibt es, leider, Redundanzen, etwa wenn, abgesehen von der Abspannprojektion, Cleopatra zu Piangerò ganz ähnlich mit ihnen interagiert, wie es im Ersten Akt bereits Sesto getan. Daß es auch anders geht, zeigt das Gespinst, zu dem Cleopatra/Lidia es in der ersten tiefen Liebesszene mit Cäsar werden läßt, indem sie es um sich und ihn, beide liegend, als Kokon herumschlingt:  Man kann sagen, sie spinne den Geliebten darin ein - eine Bildmetaphorik, die Erath zugunsten seiner Spielfilmmätzchen leider nicht weiterverfolgt. Auf der Linie der zitierenden Coolness liegen ebenfalls der eigentlich unnötige Lift, durch den man auf- und abtritt, sowie der Umstand, daß sich Cleopatra in ihrer badeschaumgefüllten Wanne völlig angekleidet wäscht bzw. sich wellnesst; zur Coolness, immer, gehört die Prüderie.  Jedem Frankfurtmainer Kauf- und Bankmann wird das, wenn in Begleitung seiner Gattin, gut gefallen haben, der nämlich ganz vor allem; dank dem Regisseur entgeht man(n) auf diese Weise dem Rechtfertigungsdruck und darf dennoch das autoerotische Spiel genießen, das Brenda Rae mit ihren in der Tat schönen Füßen treibt. Dazu noch das in seiner Närrischkeit nervende häufige Erklettern der zum Aufzug hochführenen Leiter, deren einzig sinnvolle Funktion darin besteht, im zweiten Akt zur Treppe einer Revue zu werden, auf der in echtem Hollywood, nämlich als Göttin der Tugend, die schlepperauschend herabsteigende Cleopatra/Lidia einen jedem Friedrichstadtpalast zur Ehre gereichenden Auftritt hat, selbstverständlich im strahlenwerfenden Lichtschein des Filmprojektors, zu ihren Seiten kniende Männer; auch dies ein mächtiges, wenn auch, eben, klischiertes Bild, das uns darüber im Unklaren läßt, aus welch anderem Grund als dem, daß sie halt wieder abgehen müsse, die Göttin sich schließlich umwendet. Dabei läßt sie den schmachtenden, geradezu liebeshysterischen Cäsar zurück, der sich auf die aus der bis auf einen Spalt geschlossenen Lifttür noch nachschleppenden Schleppe geworfen hat. 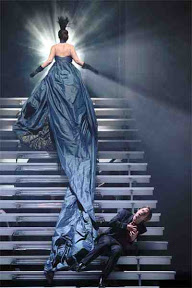 Das will zu dem männlichen Mann nicht recht passen und lebt schon deshalb nicht einer inszenatorischen Schlüssigkeit halber, die immer auch Psychologie zu sein hat, sondern steht als rein behauptetes Bild da: kraft der vorgeführten Faktizität eines Bildes. Erst recht unklar ist, weshalb das Podest, das nach einer imaginären, weil nur gemeinten Verwandlung den Gefangenenwagen vorstellt, von nach angenommener halb Sklaven- halb Henkersmanier oberleibsentblößten Männern vermittels kräftiger Seile nach links hin weggezogen wird, aus der Szene aber nach rechts rollt.  An solchen Mätzchen (meine Oma im O-Ton: „Das soll wohl sowas sein“) wird eines der Hauptprobleme von Eraths Arbeit deutlich: Jedes einzelne Bild, in sich, ist gelungen, ja wäre Keimzelle einer ganz eigenen, jeweils anderen Inszenierung; die Bilder aber untereinander legieren nicht. Auch ist die Szene direkt nach der Schlacht irgendwie nur behauptet, ein bißchen is' was durcheinander, ein paar Lanzen und Helme liegen herum, aber auch das bleibt so hygienisch wie die Idee vom sauberen Krieg. Man weiß zwar, was gemeint ist, das ist auch nicht schwer, aber es ist nicht. Daher der sich immer wieder vordrängende Eindruck von Beliebigkeit.
Trotzdem. Wer eine Erschütterung gar nicht erwartet, sondern einfach hören möchte, wohlgefällig interesselos, wie schön Händels geniale Partitur ist, und wer sich gerne schöne Menschen ansieht, ohne sie auch berühren, gar selbst berührt werden zu wollen, der sollte die Frankfurter Aufführung nicht verpassen - schon deshalb, weil die Besetzung Cäsars mit dem Bariton Michael Nagys eine nicht nur mutige, sondern tatsächlich vortreffliche Entscheidung ist jenseits der üblichen, meist ökonomisch geleiteten Fragen, ob nun Altus oder Mezzo, Sopran oder Counter. Der Frankfurter Cesare gibt Händels großer Musik, ihr aber allein, etwas Neues hinzu - eine Möglichkeit nämlich. Das ist viel, ja sehr viel mehr, als man von Inszenierungen der Opernrepertoire-Literatur normalerweise erwarten kann. Und wer sich anfangs langweilt, wen solche Inszenierungs-Coolness nervt, der kann ja gut die Augen schließen.
Ich habe das Frankfurter Haus einmal eine Regenoper genannt; auf keiner anderen Bühne, in der Tat, vermag es so in Strömen zu gießen; dabei denke ich nicht nur, wenn auch vor allem, an den hiesigen - absolut grandiosen - >>>> Lear Aribert Reimanns von 2008. Auch dem recht trockenen Ägypten gönnt Frankfurt einiges, woher auch immer gekommen, Wasser. Gemeint ist wohl das Meer, auch wenn wir notwendigerweise mehr an eine große Pfütze denken müssen. Egal. Ob diese, ob nun jenes, zu den gelungensten Szenen der Inszenierung gehört die deftige Wasserplatscherei in, glaube ich, Akt III. Nässe ist nämlich niemals ironisch, sondern immer nur naß. Das ist rein unmittelbar.  Darum gelingt das Bild, ja, es läßt uns sogar die allein von cleaner Correctheit verschuldete elektrische Zigarette wieder vergessen, vermittels derer der mainmetropole Kulturkonsum sogar dem Jugendschutz genügt, und zwar schon in der ersten Szene. Prädikat wertvoll, also, möchte ich sagen: Da beißt die Maus kein Zweifel ab.
Es bleibt nunmehr, wegen einer mir von der Vodafone aufgenötigten Arbeitsunterbrechung zwei Tage später - ich schreibe dies an einem mir fremden Computer, zumal mit völlig anderem System, deshalb die Verspätung, - ... bleibt nunmehr von der bis auf wenige Bilder verblassenden Inszenierung immerhin die sängerische Schönheit erhalten, auch die ihrer körperlichen Präsenzen, neben Michael Nagys, der frappierend meinem hochbegabten Freund >>>> Broßmann ähnelte - was macht denn Sascha hier? dachte ich und kam von dem Eindruck gar nicht mehr los -, Cäsar namentlich Paula Murrihys, Tanja Bamgartners und der des völlig sicher überzeugenden Counters Matthias Rexroths, sowie der - na sowieso - Cleopatra Brenda Raes, die vor allem stimmlich zunehmend Gestalt gewann und schließlich, je näher ihrem Sieg, alles, wirklich alles an Schönheit und Sang überstrahlte. Sogar Broßmann, ähm, Nagy... sogar also Cäsar wurde dagegen ein kleines bißchen klein.
[Premiere: 9. Dezember 2012.
Besucht wurde die dritte Aufführung am 16. 12. 2012.]  Georg Friedrich Händel
GIULIO CESARE IN EGITTO
Dramma per musica in drei Akten
Text von Nicola Francesco Haym
Regie Johannes Erath Bühnenbild Herbert Murauer
Kostüme Katharina Tasch Licht Joachim Klein
Video Bibi Abel Dramaturgie Malte Krasting
Michael Nagy - Sebastian Geyer - Tanja Ariane Baumgartner - Paula Murrihy - Brenda Rae - Matthias Rexroth - Simon Bailey - Dmitry Egorov
Frankfurter Opern- und Museumsorchester
Erik Nielsen Die nächsten Vorstellungen:
21.12.2012, 23.12.2012, 25.12.2012, 31.12.2012
12.01.2013, 26.01.2013, 04.05.2013, 11.05.2013
>>>> Karten.
 albannikolaiherbst - Dienstag, 18. Dezember 2012, 18:58- Rubrik: Oper
[Fotografien (©) aus urheberrechtlichen Gründen gelöscht):
>>>> Iko Freese.]
Mozarts Zauberflöte ist eine heilige Kuh. Wer sie anrührt, hat mit dem Volkszorn, aber auch dem der Priester zu rechnen, sprich der Sachverwalter der sogenannten ernsten Musik, womit die klassische und sogenannte klassische gemeint ist. Mir ist die Problemlage wohl bewußt. Aber selbst, wäre ich gutwilliger, als ich aufgrund meiner Erfahrungen sein kann, werde ich nicht verstehen, weshalb man diese „Oper“ genannte Aneinanderreihung klassischer Schlager, nämlich historischer Evergreens, unbedingt auf die Bühne bringen will - noch immer und mit dem hartnäckigen überzeugt sein Wollen, es handle sich um große Kunst. Wahrscheinlich trifft wie so oft die banalste Erklärung am besten: weil es das Publikum will und weil man an sich selbst das kindliche Gemüt so sehr mag. Schließlich regrediert‘s sich am besten gemeinsam. Dabei sind schon die drei in diesem opernhaften Medley leider auch noch singenden Jungen einfach nur zum Arschversohlen: anstatt sie die Älteren altklug herumleiten zu lassen, möchte man sie - aber sofort - hinaus an die frische Luft schicken, grad jetzt, wo‘s so geschneit hat. Rein unerträglich ihr scheinweises Gehabe, dem die drei Regisseure an der Komischen Oper auch noch zeichengetrickselte Flügel verleihen. Verdammt noch mal, will ich da rufen, geht Fußball spielen, Jungs, stellt meinetwegen Unfug an, Klingelstreiche oder hackt Computerprogramme, irgend sowas, aber hört damit auf, Euch genau so klebrig zu benehmen wie diese abgedroschen von ihrer Macht besessenen beiden einzigen - und auch nur näherungsweise - Erwachsenen dieses Stücks, nämlich die Königin der Nacht und Sarastro - die eine Figur so schauderlich wie die zweite.
Dies aber nun, wahrscheinlich, hat die Theatergeschichte verschuldet, nicht Mozarts in der Zauberflöte weniger kindliches als kindisches Gemüt. Er habe, heißt es, einer zeitgleich herausgekommenen Konkurrenzoper wegen, den Gang der Erzählung kurzfristig umschreiben müssen, so daß aus der anfangs „guten“ Mutter Paminas, zu deren Rettung die zwei männlichen Helden immerhin mit Zauberutensilien, eben auch der Flöte, ausgestattet werden, schließlich die böse, in dieser Inszenierung, Spinne wird.
Und Sarastro, der das Mädchen entführt hat, wird ein guter Weisheitsopa. Dramaturgisch ist das geradezu bizarr unaufgelöst; man könnte von galoppierendem Dilettantismus sprechen - wäre es nicht eben von Mozart geschrieben. Jedem anderen hätte man dafür auf die Finger gehaun. W i e schief Schikander, der Librettist, und Mozart dieser Sarastro geraten ist („Zur Liebe will ich dich nicht zwingen, doch geb ich dir die Freiheit nicht“ - so einem kann man doch nur eins in die Fresse hauen, anstelle ihn als guten Papa einer Heilsgesellschaft zu vergötzen), - das allerdings zeigt die Berliner Inszenierung recht gut, vielleicht aber nur des gewählten Zeitbezugs halber. Jedenfalls sitzt Sarastro auf seinem mechanischen, ja mechanoiden Thron wie ein Jules-Verne-Patriarch der Gründerzeit, und seine „Tempelritter“ erinnern allemal mehr an die grauen Zeitdiebe aus Michael Endes Momo als an die verfreimauerte Gralsgesellschaft, die Mozart vor Augen gehabt haben mag, um sich vielleicht bei seinen Gläubigern Liebkind zu machen, und später Wagner, im Parsifal, ganz ebenso heilsschaurig wieder aufgenommen hat. Wirklich geheuer geht es bei Andrade, Barritt und Kosky tatsächlich nicht zu - eine der Vorzüge dieser, nun ja, ich weiß nicht, ob sie sich so nennen läßt, Inszenierung; letztlich ist sie mehr Animation, als daß so etwas wie Personenführung noch eine Rolle spielte. Wobei auch das Wahrheit hat: Indem die Sänger sekundengenau auf die Animationen reagieren müssen, sind sie absolut in das Zahnradwerk der ästhetischen Produktion, nämlich in die industrialisierte Gesellschaft zu ihrer mechanischen HochZeit eingebunden, den Günderjahren, aus denen die hier bühnenbildnerisch immer wieder zitierten Zwanziger/Dreißigerjahre ihr Material beziehen: aus Collagen eines versimpelten Max Ernst, aus dem Stummfilm und einigen vorausgenommenen Reflexen auf die viel später hippgewordne Angela-Davis-Ikonographie, der wir an diesem Haus bereits >>>> in einer anderen Inszenierung begegnet sind. - Auch Chaplins Modern Times stand Pate.
Wirklich, was tun mit dieser Schlager-Oper, in der hin und wieder auch mal gute Musik vorkommt? Wie greifen die gleich drei Regisseure das verkorkste Ding also an?
Erst einmal, ich sagte es schon, ersetzen sie Inszenierung durch - als solche aber nicht erkennbare - Computeranimantionen; sie sind bewußt auf grobe Schnitte angelegt, so daß man meint, es sei hier tatsächlich noch gezeichnet und das Gezeichnete mit der tatsächlich noch handgedrehten Kamera aufgenommen worden. Die Sprunghaftigkeit der Bildabfolge und ihre gewollte Naivetät verleihen dem Bühnenbild sein Chamois, rücken Szene und Handlung in eine Vergangenheit, die das sowieso schon regressive Geschehen noch um ein Weiteres verkleinert. Zum anderen wird die Bühne dadurch, sozusagen, zweidimensional: gespielt, wenn überhaupt, wird an und in der Wand. So ist auch schon der Vorhang nicht mehr der eines Theaters, sondern bereits eines Lichtspielhauses. Indes, drittens, die vielen gesprochenen Passagen durch - eigentlich von Moritaten abgeleitete - Stummfilm-Plaketten ersetzt sind, deren Funktion sich in den Sprechblasen der Comics fortgesetzt hat, erlaubt sich ein ungebrochenes, will sagen: nicht-ambivalentes Predigen weiter, dem man als moderner Mensch sonst eher skeptisch gegenüberstünde. Zumal sichert der Bildwitz des Publikums Sympathien. Alles ist irgendwie ironisch, aber irgendwie auch ernst gemeint; über die eigentlich albtraumhaften Widersprüche wird die Decke des Entertainments gezogen. Meine Begleiterin des Abends brachte es auf den Punkt: „Das ist alles sehr sehr kreativ.“ „Tja“, möcht‘ man drauf sagen, „eben“.
Es gibt allerdings eine besondere Stärke - es ist sogar eine Größe - dieser Inszenierung. Nämlich nicht nur, daß die Ikonographie erlaubt, des Stückes oft ziemlich bemühte und selten wirklich schauspielerisch, nämlich mit Sprechtheaterkultur, vorgeführte Partien zu streichen; vielmehr werden die Moritatenbilder und eckigen Sprechplaketten durch eine ganz andere Musik begleitet, als Mozarts Oper sie vorsieht, und zwar so, wie zu Stummfilmzeiten: durch ein live gespieltes Klavier. Dafür nehmen die Regisseure zwei auseinander entwickelte Klavierfantasien Mozarts her, nämlich KV 396 und 397, bei denen es sich nun wirklich um gute, ja beste Musik handelt, die dem Stück jetzt plötzlich die ihm fehlende Tiefe fühlbar zukommen läßt - aber eben nur in diesen Stummfilmplaketten-Szenen.
Diese werden zu geradezu Einsprüchen gegen all das oberflächliche, weil scheintiefe Tändeln und vor allem gegen den gesamten Weisheitsschmock, den diese teils lächerliche, teils grauslich verklebte Zauberoper uns zumutet. Genau dieser Trick aber funktioniert allein wegen des praktisch ausgeführten Bezugs auf den Stummfilm; es ist sicher keine auf Dauer tragfähige Lösung, vermittels derer die Zauberflöte auch für reife Menschen gerettet werden könnte. Dennoch war ich für die „Unterbrechungen“ enorm dankbar, weil sich schließlich, wie „kreativ“ auch immer, die bildzeichnerische Aufeinanderfolge der Gags doch irgendwann totläuft, so daß ich spätestens in der zweiten Hälfte des Abend von Herzen müde wurde und wahrscheinlich auch dreiviermal minutenlang die Augen schloß. Wobei das, zugegeben, s c h o n hübsch ist, wenn um der vereinten und um eine völlig unübersehbare Kindermenge bereicherten, teils auch von ihr gequälten Papagenas und Papagenos Haus ein rosa Elefant im Orbit kreist, der an den Hinterstümpfen Nylons und Strapse trägt. Es geht davon aber auch, in der Fülle dieser dauernden, oft intelligent, aber inflationären Witzigkeiten und Witze, das eigentlich Bedrohliche, des Mechanoiden nämlich, verloren, das Andrades, Barritts und Koskys Inszenierung auszeichnen könnte; davon ein Ausdruck unter vielen, der unmittelbarste nämlich, ist die hergestellte Nähe von Papageno zu Buster Keaton - will sagen: Das wirklich Bedrohliche - die Hörner, die der Regreß zeigt - stammt weder von Mozart noch von Schikandeder, sondern wird der Oper von den drei Regisseuren beigefügt, dankenswerter- wie berechtigterweise, doch über das UnbedingtWitzeMachenWollen immer gleich wieder zugedeckt. Als Profi weiß man selbstverständlich, was ein im und durch das Medienzeitalter auf Entertainment dressiertes Publikum mag und erwartet. Früher nannte man solch eine Charakterdisposition „vergnügungssüchtig“, aber dieses Wort ist vergessen, soviel Merkwertes darüber von Theodor W. Adorno auch notiert worden ist, den man ebenfalls vergessen hat oder von dem man nicht minder froh ist, ihn nicht mehr zur Kenntnis nehmen zu müssen. Statt dessen darf man das Revuetheater wieder richtig gut finden. Es ist der Einträglichkeit wirklich egal, ob im Schillertheater Musicals aufgeführt werden oder eine Verdiinszenierung aus der Staatsoper in den Friedrichstadtpalast verlegt wird. Alles ist sowieso eines, jedenfalls gleich wert; das ist das Credo der Zeit. Dem kann es seicht genug gar nicht sein.
Mozarts Zauberflöte gibt dem Bedürfnis nach Seichtheit ein gutes klassisches Gewissen; man darf sich in dieser Oper auf ungebildetste Weise hoch gebildet fühlen. Immerhin galten schon dem Nazarener, nach wie vor kultureller Bezugspunkt des Westens, die Kinder als Vorbild, etwa Markus 10, unerachtet des Umstands ihrer meist ziemlich rigorosen Art, Fremdes auszugrenzen und nach Möglichkeit auch zu beschädigen - wogegen wir eine Erziehung stemmen - Humanismus genannt -, die nach Jesu sentimentaler Kinderverbrämung überflüssig ist. Die Zauberflöte setzt an die Stelle von Erziehung den Scheinhumanismus der Prüfung, die auch dogmatischen Glaubensdikaturen als handhabbarer Ausweis dient. In der Zauberflöte wird unter einen gewalttätigen Mädchenentführer demutsvoll das Knie gebeugt. Wenn dann - für ewig, auch das ist monotheistische Eschatologie - die Königin der Nacht in die Finsternis gestürzt wird, spielt es selbstverständlich keine Rolle mehr, daß sie Paminas, der eigentlich zur Schändung - der Zwangsverheiratung würde die Vergewaltigung folgen - Geraubten, Mutter ist. Will man etwas spekulieren, haben Mozart und Schikaneder den Sturz des mythischen Matriarchats reinszeniert, über das sich nun „die Väter“ stellen - Michael Endes graue Männer, Koskys Jules-Verne-Patriarchen -, um eine lange, sehr lange Geschichte der Frauenunterdrückung einzuleiten, bzw. zu prolongieren. Des Teufels Huf, wohin man sieht, rosa aber bemalt, mit Blümchen umkränzelt und richtig viel Puderzucker drauf; Schokolädchen baumeln noch herunter. Bekanntlich liebt es die Gewalt, kleine Kinder mit ihr anzulocken und sich vertraut zu machen.
Gestalterisch, bei einem solchen Animations-Vaudeville, haben die Sänger, außer auf die bewegten Zeichnungen zu achten, schauspielerisch nicht so arg viel zu leisten; es reicht, wenn sie tüchtig outrieren, ja grade das ist verlangt. Man ist eh nur typisiert. Um so wichtiger wird die sängerische Leistung, von der vor allem Christof Fischessers sehr weiter, ausdrucksstark tönender Baß in der Erinnerung bleibt. Zu den schönsten, auch musikalisch tiefsten Stellen dieser Inszenierung gehört aber, ohne jeden Zweifel, Maureen McKays, also Paminas - ich will sie einmal „Eurydike“-Arie nennen („Ach, ich fühl‘s, sie ist verschwunden“). Wie hier dieser Sängerin Klage allein nur die Höhen nimmt, ist von sängerisch poetischster Kraft. Da zeigt Mozart auch in der Zauberflöte wieder, was er konnte und zu übermitteln verstand; hier ist seine Komposition ganz unseicht auf der Höhe seines fünf Jahre älteren Figaros, vielleicht, weil eine Erdung in Gluck mitschwingt und, von noch viel früher her, von Monteverdi.Wiederum glänzt und perlt Beate Ritters Königin der Nacht in den Koloraturen, aber im eigentlichen Text wirkt die Stimme zu flach, vor allem aber zu jung für solch eine gemeinte Dämonin, die dann, was ein Inszenierungsproblem ist, gegenüber der Massivität der ihren Einfall in Sarastros Tempel begleitenden Wut mit der von Paul Barritt entbundenen - gerade in ihrer Emblematik riesigen - Bildwelt überhaupt nicht mehr mithalten kann, so daß sie, Ritters Stimme, in dieser Flut nicht untergeht, nein, schlimmer, zum Mäuschen wird, dem man sie, die reißende Glut rächenden Wütens, nur noch dann abnehmen kann, wenn man sowieso aufs Bravorufen gebügelt ist. Peter Sonns Tamino schließlich ist lyrisch, angenehm, manchmal etwas unscharf in den Konturen; frappierend allerdings, wie sehr er, besonders im Profil, David Lynchs Jeffrey Beaumont aus „Blue Velvet“ ähnelt; freilich, wem das auffällt, der erwartet dann mehr, als Sonn wahrscheinlich geben kann oder die drei Regisseure ihn geben lassen wollten. Makellos Henrik Nánási, des neuen Musikchefs des Hauses, Dirigat.
Unterm Strich, auch wenn das Ende der Inszenierung plötzlich und eigentlich sinnlos aus der übrigen Ästhetik herausbricht und das Stück mit einem, sagen wir, mauen Kuß beschlossen wird, den sich Paminas und Taminos Lippen geben, was gegen alle Bildkraft wirklich in die Knie geht, da hilft auch der sich massiv präsentierende Chor nix - unterm Strich ist diese Arbeit Andrades, Barritts und Koskys ein dennoch höchst diskutierbarer Rettungsversuch eines mißlungenen, vor allem verlogenen Musiktheaters - wenn man die Zauberflöte überhaupt noch bringen kann, dann, in der Tat, s o. Oder eben gleich als eine Märchenoper für Kinder; den meinen, jedenfalls den kleinen, knapp sechsjährigen, würde es gefallen, dem knapp Dreizehnjährigen aber schon nicht mehr, weil er die verlogene Kinderseligkeit von Erwachsenen längst mit dem einem Jugendlichen eigenen Realismus durchschaut.
>>>> Trailer.Wolfgang Amadeus Mozart
DIE ZAUBERFLÖTE.
Große Oper in zwei Aufzügen.
Libretto von Emanuel Schikaneder.
Musikalische Leitung Henrik Nánási
Inszenierung Barrie Kosky, Suzanne Andrade
Animationen Paul Barritt
Konzeption »1927« (Suzanne Andrade und Paul Barritt) und Barrie Kosky
Bühnenbild, Kostüme Esther Bialas Dramaturgie Ulrich Lenz
Chöre André Kellinghaus Licht Diego Leetz
Maureen McKay - Peter Sonn - Beate Ritter - Christof Fischesser
Dominik Köninger - Ariana Strahl - Stephan Boving - Ina Kringelborn
Karolina Gumos - Maija Skille - Christoph Späth - Carsten Sabrowski.
Drei Solisten des Tölzer Knabenchores. Die nächsten Vorstellungen:
Dez '12: Mo 3., Di 4., Sa 8., Fr 14., Sa 22., Mi 26., Mo 31.
Jan '13: Fr 4., Fr 25. Feb '13: Do 7. Mär '13: So 3., Fr 22.,
Apr '13: Sa 27.
Mai '13: Sa 4., Do 9., Sa 11., Do 16., Sa 25., Jun '13: Fr 7.
Jul '13: Do 4.
>>>> Karten. albannikolaiherbst - Sonntag, 9. Dezember 2012, 15:12- Rubrik: Oper
|
|
Für Adrian Ranjit Singh v. Ribbentrop,
meinen Sohn.
Herbst & Deters Fiktionäre:
Achtung Archive!
DIE DSCHUNGEL. ANDERSWELT wird im Rahmen eines Projektes der Universität Innsbruck beforscht und über >>>> DILIMAG, sowie durch das >>>> deutsche literatur archiv Marbach archiviert und der Öffentlichkeit auch andernorts zugänglich gemacht. Mitschreiber Der Dschungel erklären, indem sie sie mitschreiben, ihr Einverständnis.
NEU ERSCHIENEN
Wieder da - nach
14 Jahren des Verbots:
Kontakt ANH:
fiktionaere AT gmx DOT de
E R E I G N I S S E :
# IN DER DINGLICHEN REALITÄT:
Wien
Donnerstag, 30. November 2017
CHAMBER MUSIC
Vorstellung der neuen Nachdichtungen
VERLAGSABEND >>>> ARCO
>>>> Buchhandlung a.punkt
Brigitte Salandra
Fischerstiege 1-7
1010 Wien
20 Uhr
NEUES
Die Dynamik
hatte so etwas. Hab's öfter im Kopf abgespielt....
Bruno Lampe - 2018/01/17 21:27
albannikolaiherbst - 2018/01/17 09:45
Zwischenbemerkung (als Arbeitsjournal). ...
Freundin,
ich bin wieder von der Insel zurück, kam gestern abends an, die Wohnung war kalt, vor allem ... albannikolaiherbst - 2018/01/17 09:38
Sabinenliebe. (Auszug).
(...)
So beobachtete ich sie heimlich für mich. Zum Beispiel sehe ich sie noch heute an dem großen Braunschweiger ... Ritt auf dem Pegasos...
Der Ritt auf dem Pegasos ist nicht ganz ungefährlich,...
werneburg - 2018/01/17 08:24
Pegasoi@findeiss.
Den Pegasus zu reiten, bedeutet, dichterisch tätig...
albannikolaiherbst - 2018/01/17 07:50
Vom@Lampe Lastwagen fallen.
Eine ähnliche Begegnung hatte ich vor Jahren in...
albannikolaiherbst - 2018/01/17 07:43
findeiss - 2018/01/16 21:06
Pferde
In dieser Nacht träumte ich, dass ich über hügeliges Land ging, mit reifen, dunkelgrünen, im Wind raschelnden ... lies doch das noch mal
dann stimmt auch die zeitrechnung
http://alban nikolaiherbst.twoday.net/s tories/interview-mit-anady omene/
und...
Anna Häusler - 2018/01/14 23:38
lieber alban
sehr bewegend dein abschied von der löwin, der...
Anna Häusler - 2018/01/14 23:27
Bruno Lampe - 2018/01/11 19:30
III, 356 - Merkwürdige Begegnung
Seit einer Woche war die Wasserrechnung fällig und ich somit irgendwie gezwungen, doch noch das Postamt ... Bruno Lampe - 2018/01/07 20:34
III, 355 - … und der Gürtel des Orion
Epifania del Nostro Signore und Apertura Staordinario des einen Supermarkts - Coop. Seit dem ersten Januar ... Bruno Lampe - 2018/01/03 19:44
III, 354 - Neujahrsnacht e dintorni
Das Jahr begann mit einer unvorgesehenen Autofahrt bzw. mit der Gewißheit, mir am Vormittag Zigaretten ... albannikolaiherbst - 2018/01/03 15:16
Isola africana (1). Das Arbeitsjournal ...
[Mâconièrevilla Uno, Terrasse im Vormittagslicht
10.32 Uhr
Britten, Rhapsodie für Streichquartett]
Das ...
JPC

DIE DSCHUNGEL.ANDERSWELT ist seit 4968 Tagen online.
Zuletzt aktualisiert am 2018/01/17 21:27
IMPRESSUM
Die Dschungel. Anderswelt
Das literarische Weblog
Seit 2003/2004
Redaktion:
Herbst & Deters Fiktionäre
Dunckerstraße 68, Q3
10437 Berlin
ViSdP: Alban Nikolai Herbst
HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Der Autor diese Weblogs erklärt hiermit
ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen
Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle
und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft
der gelinkten/verknüpften Seiten hat der Autor keinerlei Einfluss.
Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten
aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung
verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb
des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für
Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Gästebüchern,
Diskussionsforen und Mailinglisten, insbesondere für Fremdeinträge
innerhalb dieses Weblogs. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen,
haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde,
nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung
lediglich verweist.
|